Eine demokratisierte Medizin schaffen, ist ein hehres Ziel. Doch wieviel und was muss der Patient tatsächlich wissen, um frei mitentscheiden zu können?
Wenn heute kranke Menschen Teil einer klinischen Versuchsreihe sind, müssen sie vorher darüber aufgeklärt worden sein. Und soll das bei einem operativen Eingriff anfallende Biomaterial (Gewebe, Nabelschnurblut etc.) für Forschungszwecke weiterverwendet werden, so muss ebenfalls zunächst die Zustimmung des Patienten eingeholt werden. Im Allgemeinen geschieht dies durch die Unterschrift unter ein an Informationen reiches Formular. Die Philosophie dahinter ist, dass nicht die Experten im weißen Kittel allein über den Körper eines anderen Menschen verfügen können. Gleichzeitig soll der Patient möglichst genau darüber Bescheid wissen, was mit ihm respektive Teilen seines Körpers passieren wird. Dass das noble Ideal einer demokratisierten Medizin damit gerade nicht realisiert wird, fanden Soziologen, die sich mit der Praxis des informed consent - so der Fachausdruck für diese Art der Einwilligung - auseinander setzten; sie trafen sich letzte Woche in Wien zu einem Workshop.
Man stelle sich vor: Eine Patientin einen Tag vor einer Brustverkleinerung im AKH Wien. Sie wird gebeten, ein sechs Seiten langes Formular zu unterschreiben. Wenn sie unterschreibt, wird das operativ entfernte Hautgewebe einem Diabetes-Forschungsprojekt zugute kommen. Was geht in der Frau vor? Ein Forschungsteam um Professor Ulrike Felt wollte es genau wissen. Die Wiener Wissenschafter beobachteten dazu den Informed-consent-Prozess und interviewten Patienten und Experten. Ein wichtiges Resultat ihrer Studie lautet: Die Patienten entscheiden sich weniger aufgrund einer detaillierten Auseinandersetzung mit den technischen Informationen. Stattdessen greifen sie auf allgemeine Vorstellungen und persönliche Erfahrungen zurück.
Forschung für alle
Die Wissenschaftsforscher bezeichneten diese Vorgehensweise als "informierte Unwissenheit". So begründeten viele die Spende damit, dass sie einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt und zur Entwicklung von Medikamenten leisten möchten. Eine Patientin etwa sagte: "Ich stellte mein Gewebe zur Verfügung, damit etwas Gutes damit gemacht wird. Und wenn etwas Gutes damit gemacht wird, [...] werden wir alle davon profitieren!" Wissenschaft und das medizinische System wurden dabei oft als ein öffentliches Gut beschrieben. Und da die Patienten ihr Gewebe nicht als einen Besitz ansahen, widerstrebte ihnen auch der Gedanke, für ein Stückchen Haut Geld zu nehmen. Auch wussten einige Spender genau, für welche Art von Forschung sie nichts hergeben würden: für Biowaffen etwa, oder Tier-und Klonversuche. Doch solche Informationen waren aus dem technisch gehaltenen Formular für den Laien nicht herauszulesen. Für Mediziner mag es offensichtlich sein, dass Hautgewebe eher ein Ersatz für Tierversuche sein kann, als solche zu fördern. Aber muss das ein Laie auch wissen? Zumindest ein Patient glaubte, aus der kleinen Anzahl an benötigten Proben schließen zu dürfen, dass er damit keine Industrie-nahe Forschung sponsern werde - und unterschrieb. Dass kurz vor einer solchen Operation die Gedanken auch völlig anderswo sein können, zeigte ein mehrere Wochen später geführtes Interview mit einer anderen Patientin: Sie konnte sich partout nicht daran erinnern, überhaupt ein Formular unterschrieben zu haben.
Professor Klaus Hoeyer von der Universität Kopenhagen wies in seinem Vortrag auf eine paradoxe Entwicklung in der Standardisierung von Informed-consent-Formularen hin. Das Ziel, die Autonomie des Patienten durch Informationspflicht zu stärken, sei damit gerade nicht erreicht worden. Im Gegenteil - es gebe weniger Verhandlungsspielraum und weniger Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Die Dokumentation habe den Dialog ersetzt, so seine Kritik. Oonagh Corrigan, Professorin an der Universität Plymouth, stimmte dem zu: Die Krankenschwestern könnten die Formulare dem Patienten nicht verständlicher machen. Ja, selbst Ärzte könnten manchmal nicht sagen, was mit dem gespendeten Material genau geforscht werde, wenn es an andere Labors weitergegeben wird.
Vertrag vs. Vertrauen
Die Folge: Die schriftlich dargebotenen Informationen können das Vertrauen nicht nur stärken, sondern auch schwächen. Corrigan zitierte dazu einen potenziellen Kandidaten eines klinischen Versuchs. Zum Arzt meinte er: "Sie kümmern sich ja nicht wirklich um mich, Ihnen geht es ja nur um Ihre Forschung." Das System funktioniert zwar zumeist: die Patienten werden behandelt und die Forscher können Forschung betreiben. Und trotzdem - das Vertrauen bleibt fragil. Und was wird passieren, wenn es einmal tatsächlich größere Vertrauensrisse geben sollte? Wetten, dass einige die Idee haben werden, sie mit mehr Informationen zu kitten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


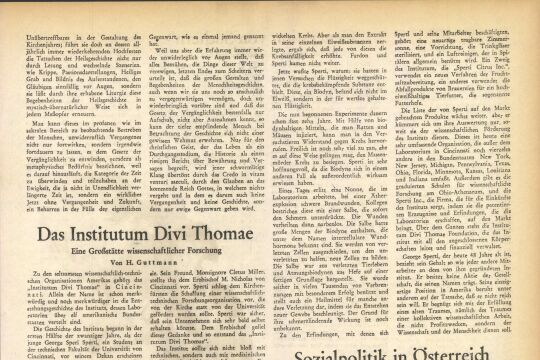


















































.png)




