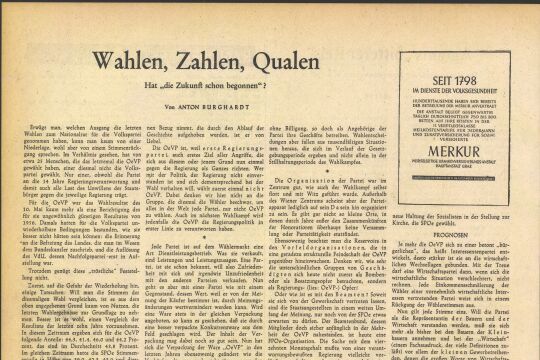Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nicht volle vier Jahre...
Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung sind in vollem Gange. Sie zeichnen sich diesmal durch eine besondere Schwierigkeit aus. Die von den beiden Parteien bestellten Unterhändler haben sich nämlich nicht nur über Form, Inhalt und beabsichtigte Dauer einer neuerlichen Zusammenarbeit zu einigen, sondern sie müssen sich gleichsam vor der Öffentlichkeit dafür entschuldigen, daß sie überhaupt bemüht sind, eine neue Koalition zustande zu bringen. Zunächst ist die Frage zu beantworten, warum die ÖVP ihren Wahlkampf praktisch gegen die Wiederbelebung einer großen Koalition geführt hat. Zwei Gründe waren hiefür maßgebend. Der erste war die schlechte Erfahrung, die die ÖVP in der letzten Periode der großen Koalition seit 1962 gemacht hat. Obwohl die Volkspartei damals über 82 Mandate — also nur eines unter der absoluten Mehrheit — verfügte, war es ihr vor allem seit 1964 nicht mehr möglich, die Sozialistische Partei von einer Oppositionsrolle abzuhalten, in die sich diese trotz ihrer Regierungsverantwortung selbst hineingespielt hatte. Seit dieser Zeit konnten prinzipiell bedeutsame Ministerratsbeschlüsse fast überhaupt nicht mehr gefaßt werden oder sie kamen nur im Wege von Kompromissen zustande, die sich vor allem dadurch auszeichneten, daß politische Wünsche gegeneinander abgewogen wurden, die sachlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten.
Es darf noch ein Element nicht übersehen werden, das vor allem psychologisch zu einer immer stärkeren Ablehnung des alten Koalitionssystems führte. Die Frauen und Männer, die sich 1945 zu gemeinsamer Arbeit zusammengefunden haben, wurden immer weniger. Der natürliche Abgang an Politikern, die 1938 in die Kerker geworfen wurden, sich dort zu dem gemeinsamen Versprechen, Österreich gemeinsam wieder aufzubauen, zusammenfanden, dezimierte die Gruppe von Österreichern, die man die „45er-Generation“ nannte, und junge Kräfte wuchsen langsam in das politische Geschehen, das sie nicht mehr wie die abtretende Generation aus reicher, langjähriger und bitterer Erfahrung betrachteten. Dazu kam, daß die großen Persönlichkeiten mit echter persönlicher Autorität, wie Raab und Figl, Helmer und Böhm, nicht mehr unter den Lebenden weilten. Damit fiel die Möglichkeit persönlichen und sachlichen Ausgleichs weg, und das Koalitionsgetriebe mußte immer schlechter funktionieren. So entstand das allgemeine Bedürfnis, dieses System durch eines abzulösen, das dem Wechselspiel von Regierung und Opposition freien Lauf lassen sollte. Die Volkspartei ging mit dieser Parole 1966 in den Wahlkampf und wurde damit von der Mehrheit der Wähler bestätigt. Die Wahlstrategen von 1970 vermeinten mit der gleichen Parole auch diesmal das gleiche Ziel zu erreichen.
Daraus entsprang der zweite Grund für die starre volksparteiliche Ablehnung des Systems einer großen Koalition.
Man glaubte, daß die zweifellos vorhandene Popularität des Bundeskanzlers so groß sei, daß seine Ankündigung, nur einer ÖVP-Einpar-teienregierung vorstehen zu wollen, den gewünschten Wahlerfolg bringen werde. Diese Meinung verfestigte sich sogar noch im Zuge des Wahlkampfes, in dem der Bundeskanzler, wohin er immer kam, von großen Menschenmengen freundlichst begrüßt wurde. Hier unterlag man wieder einmal dem Irrtum einer falschen Einschätzung der Wirkung von Wahlversammlungen.
Die große Überraschung
Der Antikoalitionspropaganda der Volkspartei stand das sozialistische Wahlziel gegenüber, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen, um sodann wieder als Juniorpartner — niemand glaubte, daß die ÖVP auch die relative Mehrheit verlieren
Dr. Klaus: Erfolglose Antikoalitionspropaganda ...
Photo: Wasohel werde — in die erneuerte große Koalition eintreten zu können. Am Ende stand ein Wahlergebnis, das niemand, am wenigsten die Sozialisten selber^eiÄartet hatte. Nun ist es Aufgab(4(^^^,eiorganisationen, die Ursachen zu klären, vor allem die Volkspartei wird eine genaueste Analyse durchführen müssen, wenn es ihr gelingen soll, innerhalb der kommenden Jahre ihren angestammten Platz als führende österreichische Partei wiederum zurückzuerobern. Insbesondere wird ihre Haltung gegenüber dem System von Regierungskoalitionen revidiert werden müssen. Dies nicht nur deshalb, weil die Wähler diesmal anders entschieden haben, als die Kärntnerstraße es erwartete, sondern auch aus einem verfassungsmäßigen Grund.
Man übersieht nämlich meistens, daß die Frage, ob in Österreich Koalitionsregierungen oder das Wechselspiel der politischen Kräfte am Platze sind, viel weniger von den Wählern als vielmehr von der Bundesverfassung entschieden wird, die ein zum Extrem ausgearbeitetes Proporzwahlsystem vorsieht. In einer parlamentarischen Demokratie mit einem Proporzwahlsystem, das noch dazu durch das sogenannte T'Hondsche Auszählungsverfahren zu einem Exzeß von Proporz wird, sind Koalitionsregierungen die Regel und Einparteienregierungen nur eine seltene und kurzfristige Ausnahme. Der in Österreich verfassungsmäßig gültige Proporz erlaubt einfach nicht die Bildung einer starken parlamentarischen Mehrheit durch eine Partei. Auch dort, wo z. B. die sozialistischen Parteien schwächer als In Österreich sind, kommt es bei einem gültigen Proporzwahlsystem immer zu Koalitionen unter mehreren konservativen Parteien, weil keine von ihnen die absolute Mehrheit erringen kann. Das österreichische Wahlsystem bedingt also auch das System einer Koalitionsregierung. Lehnt man also das System der Koalitionsregierungen ab, dann muß man zuerst das Wahlrecht ändern! Ein echtes Wechselspiel zwischen Regierungspartei und Opposition gibt es nur dort, wo es, wie in Großbritannien, das Einerwahlsystem gibt. Dieses System verbürgt in der Regel starke Mehrheiten und bewirkt im übrigen auch eine weitaus stärkere Mobilität der Wähler.
Rückschau und Ausblick
Faßt man die politischen Elemente, die in die gegenwärtige Situation hineinführten, zusammen, so ergibt sich folgende Übersicht:
1. Das Wahlergebnis von 1970 kam für alle völlig unerwartet, da man allgemein annahm, daß die ÖVP zwar die absolute Mehrheit verlieren, jedoch die relative Mehrheit mit gutem Abstand vor der SPÖ behalten werde. Da man außerdem — ebenso fälschlicherweise! — eine kleine Verstärkung der FPÖ annahm, standen auch schon Kombinationen einer Rechtskoalition zur Diskussion.
2. Die relative Mehrheit für die SPÖ stellte deren Parteiführung vor die unerwartete Aufgabe, ein Regierungsprogramm zu entwerfen, das nun natürlich mit den extensiven Wahlversprechungen einer großen Oppositionspartei belastet ist.
3. Die programmatische und propagandistische Ablehnung des Systems von Regierungskoalition durch die ÖVP erschwert es dieser, ihren Wählern begreiflich zu machen, daß man infolge des Wahlausganges nun doch gezwungen ist, über solche Möglichkeiten in Verhandlungen einzutreten. Die starken Strömungen in der bisherigen Regierungspartei, in Opposition zu gehen, resultieren aus dieser Situation.
4. Die ÖVP ist nun der mandatsmäßig stärkste Juniorpartner in einer Regierungskoalition; die Differenz von zwei Mandaten im Verhältnis 81:79 ist in ihrem Gewicht geringer als die schon dagewesene Differenz von 79:78, weil dieses seinerzeitige Wahlergebnis nur die Fortsetzung einer bestehenden Koalition mit geringfügiger innerer Gewichtsverschiebung bedeutete, während nun die Vorzeichen der Regierungspolitik umgekehrt werden müssen.
5. Der allgemeine Wunsch, die neue Koalition anders als vor 1966 zu gestalten, verkleinert die politische Existenzbasis einer solchen Koalition und engt ihre Handlungsfreiheit, d. h. ihre politische Effizienz bedeutend ein. Die Einigung auf ein großes und umfassendes Regierungsprogramm, dem die parlamentarischen Klubs der beiden Parteien dann zustimmen müßten, würde neuerlich die verfassungsmäßige Wirksamkeit des Nationalrats beschränken. Ein kleines Regierungsprogramm aber würde die Brüchigkeit eines solchen Systems bei der ersten parlamentarischen Abstimmung, bei der es um Grundsätzliches geht, erst recht beweisen.
6. Daraus ergibt sich mit fast zwingender Logik, daß an dieser Legislaturperiode, so wie die Dinge jetzt liegen, kaum ihre volle Dauer von vier Jahren zusprechen kann. Vielleicht ist das aber gar nicht das schlimmste, wenn man dem Wähler etwa in zwei Jahren neuerlich die Chance und damit den Auftrag gibt, im Lichte der Erfahrungen einer sozialistisch-volksparteilichen Koalition neuerlich zu entscheiden. Wenn man bis dahin außerdem das österreichische Wahlrecht seines Proporzcharakters entkleidet hätte, wären mit großer Sicherheit für die Zukunft eindeutige und wachsende parlamentarische Mehrheiten zu erwarten. Dann braucht man sich nicht mehr den Kopf über schwierige Koalitionsvereinbarungen zerbrechen, sondern nur mehr handfeste Wahlprogramme entwerfen. Auch dem Wähler würde damit die Entscheidung leichter gemacht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!