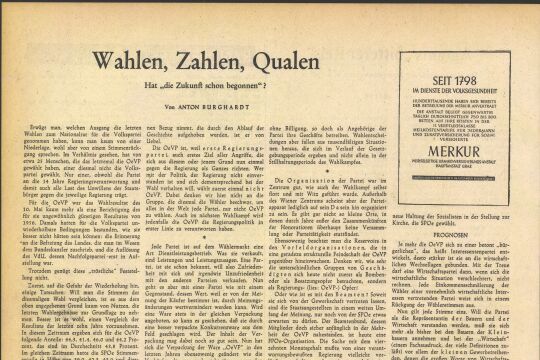Um 22.25 Uhr war alles vorüber. Zu diesem Zeitpunkt konnte am vergangenen Sonntag der Sprecher des Österreichischen Rundfunks bereits die unmittelbar bevorstehende Bekanntgabe des Endergebnisses der Nationalratswahlen 1962 durch den Bundesminister für Inneres ankündigen. Wenige Minuten später stand dieser vor dem Mikrophon. Mit einer Stimme, die eine persönliche Enttäuschung nur schwer verbergen konnte, teilte Bundesminister Afritsch mit, daß in den neuen Nationalrat 81 Abgeordnete der Volkspartei, 76 Sozialisten und I Freiheitliche einziehen werden.
Die Weichenstellung, die der österreichische Wähler an diesem Tag vorgenommen hatte, kündigte sich bereits an den ersten in der Hauptwahlbehörde einlaufenden lokalen Wahlergebnissen an. Sie zeigten deutlich, daß die Volkspartei wieder im Kommen war. Spätere Meldungen, die bereits Überblicke über einzelne Wahlkreise vermittelten, bestätigten den ersten Eindruck. Bald konnte man bereits von einem in ganz Österreich sichtbar werdenden „Trend“ sprechen. Die Stimmen der Volkspartei waren beinahe überall gleichmäßig gestiegen, mit ihnen konnten die Sozialisten nicht Schritt halten, und die Freiheitlichen traten — mit Ausnahme von Vorarlberg — durchweg am Platz, Ja erlitten sogar merkliche Einbußen. Die Ergebnisse von Wien, wo die Sozialistische Partei — im Vergleich zu 1959 — noch relativ am besten abschnitt, bremsten zwar die allgemeine Entwicklung, konnten sie jedoch nicht entscheidend korrigieren.
Das erwartete Rennen Kopf an Kopf fand diesmal nicht statt. Am Ende dieser kürzesten aller Wahlnächte stand fest, daß die Volkspartei 96.536 Stimmen gewinnen konnte (1959: 1,960.590; 1962: 2,024.579). Für die Sozialisten hatten nur 6655 Wähler mehr als bei den letzten Wahlen gestimmt (1959: 1,953.935; 1962: 1,960.590). Die Freiheitliche Partei mußte sogar ein Manko von 21.514 Stimmen beklagen; statt 336.110 Wähler, hatten diesmal nur 314.596 für ihre Kandidaten votiert. Der massierte Großangriff der Kommunisten auf das Grundmandat im Wahlkreis Wien-Nordost war gleichsam schon im Vorfeld zusammengebrochen. Große Überraschung. Entgegen einzelnen örtlichen Wahlen, deren Ergebnis die Annahme zu rechtfertigen schien, die KPÖ hätte den „Ungarnschock“ überwunden und ihre Kader aufgefüllt, fiel der Stimmenanteil der Kommunisten gleichfalls weiter, von 172.578 des Jahres 1959 auf 135.482. 7096 Wähler hatten wiederum der KPÖ den Abschied gegeben. Genugtuung im Hause Molden. Zu einem Mandat fehlen der Europäischen Föderalistischen Partei zwar viele, sehr viele Stimmen. 21.535 Wähler aber haben dem etwas überstürzt unternommenen Alleingang des Familienchefs in die Politik immerhin von der drohenden Gefahr, mit den Ergo-kraten und der „Partei der Vernunft“ in einem Atemzug genannt zu werden, befreit. Die Vision Otto Moldens, der 20 Abgeordnete seiner politischen Gruppe nicht beim nächsten, dafür aber beim übernächsten Urnengang ins Parlament einziehen sieht, scheint wohl zu hoch gespannt. Aber wer weiß? Realistisch gesehen haben Otto Molden und seine Gruppe nun eine gewisse Ausgangsbasis, um vielleicht einmal eine ähnliche Funktion im politischen Leben Österreichs auszuüben, wie sie der „Landesring der Unabhängigen“ in der Schweiz spielte und spielt. Auch soziologisch gibt es Parallelen. Dort stand freilich die wirtschaftlich mächtige, eigenwillige Persönlichkeit eines Gottlieb Duttweiler hinter der Gründung. Aber der rührige Familienclan Moldens könnte hier in die Bresche springen.
Das alles ist freilich Zukunftsmusik. Vielleicht. Wenn wir in die Gegenwart zurückkehren, so seihen wir zunächst, daß trotz aller Abnützungserscheinungen bei den beiden Regierungsparteien
— daran hat es in den vergangenen Jahren wirklich nicht gefehlt — die Opposition ohne Chance blieb. Der KPÖ nutzten weder ihre optisch relativ guten Plakate noch ihre mit ,,Richtstrahlern“ auf unzufriedene sozialistische Kreise ausgerichtete massive Propaganda. Die Forderung „Kommunisten ins Parlament“ fand kein Echo in den Herzen der österreichischen Arbeiter. Dabei hätten wir
— wir hoffen, hier richtig verstanden zu werden — es bestimmt nicht als Staatsnotstand angesehen, wenn entsprechend ihrer Stimmenanzahl vielleicht drei kommunistische Abgeordnete auf der äußersten linken Bank des Nationalrates Platz genommen hätten. Im Gegenteil. 3:162. Mit diesem Verhältnis wäre gegenüber Ost und West die Rolle der Kommunistischen Partei in Österreich optisch vielleicht noch wirksamer dargestellt worden. Wir haben aber das österreichische Wahlgesetz nicht als Ausnahmegesetz gegen die Kommunisten beschlossen, wir werden es ihnen zuliebe gewiß auch nicht ändern.
Mit „gedämpftem Trommelschlag“ sollte man auch im Lager der FPÖ das Wahlergebnis kommentieren — es sei denn, man lasse sich durch das Geschenk der Wahlarithmetik, die diesmal den Freiheitlichen mehr als günstig war, täuschen. Da wettert man durch Jahre gegen die schwarzrote Koalition, da beklagt man lautstark den Schillingschwund, da stellt man diesmal sogar erstmalig im Wahlkampf deutschnationale Ressentiments zurück, gibt Samtpfote und verlangt „Mehr Österreich“,und zu guter Letzt war es wieder nichts. Noch schlimmer. Trotz einer psychologisch nicht ungünstigen Ausgangsposition, die labile Elemente unter Umständen verleiten hätte können, ihrem Ärger einmal durch eine Stimmabgabe für die FPÖ Ausdruck zu geben, war der Refrain des Liedes vom „Schillingschwund“ doch nur ein „Wählerschwund“. Ein nicht geringer Teil potentieller FPÖ-Wähler hatten allem Anschein nach diesmal anders kalkuliert. Was soll uns eine auch um einige Mandate verstärkte machtlose Opposition? Sie gaben kühl rechnend ihre Stimme daher einer Volkspartei, in der man diese selbstverständlich nicht nur mit Dank annimmt, sondern da und dort auch bereit ist, diesen Wählern am warmen Ofen einer als „bürgerlich“ firmierten Ideologie ein gutes Plätzchen einzuräumen. Wähler sind überall willkommen, bei jeder Partei. Die Frage ist nur, ob die Honorierung deT Stimmen nach der Wahl nicht zu einem vermehrten Schwund, der an sich schon angegriffenen ideellen Goldreserven führt. Darüber wird noch zu reden sein.
Doch bevor wir das Haus des Wahlsiegers vom 18. November betreten, gebietet es unser Zartgefühl, dem „zweiten Sieger“ Besuch zu machen. Als „zweiter Sieger“ präsentiert sich in des bekannten Ausspruchs echtester Bedeutung die Sozialistische Partei unter ihrem Obmann, Vizekanzler Dr. Pittermann. Daß die Sozialistische Partei per Saldo keine Stimmeneinbußen erlitt, daß ihr die Wahlarithmetik außerdem wieder einen üblen Streich spielte, hat gewiß seine Richtigkeit. Auch. Aber das alles dürfte als Beruhigungspille für die Tatsache, daß eben die Volkspartei einen echten Zuwachs an die 90.000 Stimmen gegenüber der Sozialistischen Partei für sich gutbuchen konnte, von niemandem abgekauft werden. Wo liegen also die Wurzeln dafür, daß die SPÖ, welcher 1959 beinahe der große Sprung auf den ersten Platz im Staate gelungen war, sich diesmal — wenn auch nach Punkten — geschlagen geben mußte? Die persönliche Problematik von Dr. Pittermann ist die Problematik seiner Partei geworden.
Wo sind die Zeiten, in denen der Klubobmann Dr. Pittermann die Aufmerksamkeit breiter Kreise der Öffentlichkeit auf seine Person konzentrieren konnte? Es war seine beste Zeit. Auch seine Initiative zum „neuen Kurs“ der SPÖ, der für die Katholiken unter anderem zur Bereinigung der Konkordatsfrage beitrug, sei nicht abgeleugnet. Dann aber kam „Pittermann für jedermann“. Das ging 1959 noch gut, sehr gut sogar. In den folgenden Jahren trat die Durchsichtigkeit einer Politik der unverbindlichen Verbeugungen nach allen Seiten immer mehr zutage. Das Wieb nicht ohne Auswirkungen auf die Partei des Vizekanzlers, dessen notorisch schlechte Beziehungen zu dem Präsidenten de* Österreichischen Gewerkschaftsbundes alles andere als ein Staatsgeheimnis sind. Das blieb schließlich auch nicht dem Wähler verborgen. Jenem Wähler, der zwar eine Zusammenarbeit zwischen den beiden großen Parteien bejaht, der aber von Monat zu Monat ein immer geringeres Bedürfnis verspürte, die Geschäfte der Republik in die Hände von Bundeskanzler Doktor Pittermann zu legen. Dem Stil der Un-verbindlichkeit, de Mangels an Profil und Konturen verfiel auch vollends die sozialistische Propaganda. Zwar raschelte auch auf der anderen Seite viel Papier, aber die 79:78-Parole der Volkspartei erwies lieh in diesem Wahlkampf genauso wirksam wie 1959 die sozialistische des „Gleichgewichts“ und des nach einer Seite bedenklich geneigten Staatsschiffes. Mahnungen, wie jene Dr. Günther Nennings, in der „Zukunft“ die Propaganda attraktiver zu gestalten und damit auch einen größeren Anreiz zum Wählen der SPÖ zu schaffen, wurde in den Mühlen des Parteiapparates kurz und klein gemahlen. Aber das ist kein sozialistisches Vorrecht. Unabhängige Wortmeldungen sind, auch wenn sie von Freunden kommen, heute in keinem politischen Lager im Österreich gefragt.
Welche Konsequenzen wird die Sozialistische Partei aus dem Ausgang der Wahlen vom 18. November ziehen? Wird sie welche ziehen? Sie wird wohl müssen. Darüber sich zu äußern, ist zur Stunde wohl noch zu früh. Auch sind dies nicht in erster Linie unsere Sorgen und Probleme.
Darum wenden wir uns — last not least — dem Sieger vom 18. November zu, als der die Volkspartei klar und eindeutig angesprochen werden darf. Der Erfolg war schön, der Jubel darüber groß. Mit gutem Fug und Recht, hat doch der 18. November die Partei von dem „Trauma“ einer „automatischen Stimmenprogression“ der Sozialisten bei jedem Wahlgang befreit.
Nun, da die Freudenbecher geleert, die Siegesfackeln herabgebrannt sind, erhebt sich wie von selbst auch die Frage, wem dieser Sieg eigentlich zu verdanken sei. Es gibt Anzeichen dafür, daß einzelne Gruppen den Erfolg gerne in Pacht nehmen würden und im Aufwind des 18. Novembers ihre Segel hissen möchten. Dem gegenüber darf wohl festgehalten werden: Der Wahlsieg des 18. Novembers hat viele Gesichter. Das eines tatkräftigen „Wahlhelfers“ — des Gegners nämlich — haben wir bereits gezeichnet. Die anderen: Der Erfolg der Volkspartei in der Steiermark zeigt ohne Zweifel die Züge von Landeshauptmann Krainer wie hinter dem imponierenden Stimmengewinn in Tirol unter anderen jene des Innsbrucker Bürgermeisters Lugger sichtbar werden.In Niederösterreich begegnen wir aber ohne Zweifel Altbundeskanzler Figl, dessen „Popularitätskurve“ zumindest in den östlichen Bundesländern eine Höhe erreicht hat, wie vielleicht noch nie zuvor. Der Erfolg der Volkspartei zeigt aber nicht zuletzt die Gesichter jener vielen Neuwähler, die den Namen Volkspartei wörtlich nehmen. Die von ihr eine kraftvolle Vertretung der Lebensinteresien breiterSchichtenerw arten. Diese Neuwähler haben einen kritischen Blick. Sie zu enttäuschen, sie auf dem Altar „höherer wirtschaftlicher Interessen“ zu opfern, müßte sie nächstes Mal um so sicherer dazu bringen, den „anderen Stimmzettel“ in die Urne zu werfen. Diese Neuwähl er sind nicht sentimental, und ihre polirischen Bindungen werden keineswegs, wie noch bei der älteren Generation, für ein Leben lang eingegangen.
Wahlen werden gewonnen. Wahlen können auch wieder verloren werden. Das alles hat die Volkspartei seit 1945 — und wir mit ihr — im wechselvollen Gang der politischen Gezeiten schon erlebt. Wenn Bundeskanzler Gorbach, nachdem das als Bleigewicht erkannte Gleichgewicht wieder weggefallen ist, erkannte, „die Mehrheit bedeutet eine höhere Verantwortung“, so weiß er wohl — um ein Modewort zu gebrauchen — was auf ihn zukommt. Schon für die kommenden Regierungsverhandlungen wird seine Aktenmappe gewiß von manchen Freunden und auch von jenen, die sich als solche vorstellen, mit sehr widerspruchsvollen Forderungen übermäßig belastet werden.
Wir möchten zurückhaltend sein. Eine Erinnerung an die zwei interessantesten Ideen, die der ganze Wahlkampf gezeitigt hat, sei aber gestattet. Die eine betrifft die von Generalsekretär Dr. Withalm vorgetragene Forderung nach Ausbau und gesetzlicher Verankerung der „direkten Demokratie“. Hier wird erfreulicherweise ein altes Anliegen der „Furche“ in den Vordergrund der politischen Diskussion gestellt. Ein Ausbau der „direkten Demokratie“ durch, Volksabstimmungen und Volksbegehren kann aber auch, da wir aus grundsätzlichen wie aus realpolitischen Erwägungen vom berühmten Einschalten der „Dritten Kraft“ im Pariamen nichts halten, zum erstrebenswerten möglichen Korrektiv gegen eine Erstarrung der Koalition werden. Die andere Erinnerung betrifft die Zukunft der verstaatlichten Industrie. Staatspolitische Überlegungen verlangen, daß sie nicht jeweils vofi Wahl zu Wahl aus einer „Reichshälfte“ in die andere hinüberwechselt. Präsident Maleta hat hier einen Weg gewiesen, der auch für den Koalitionspartner gangbar erscheinen sollte.
Aus der kürzesten Nacht aller Wahlkämpfe treten wir in den neuen Tag. Mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Gefahren.