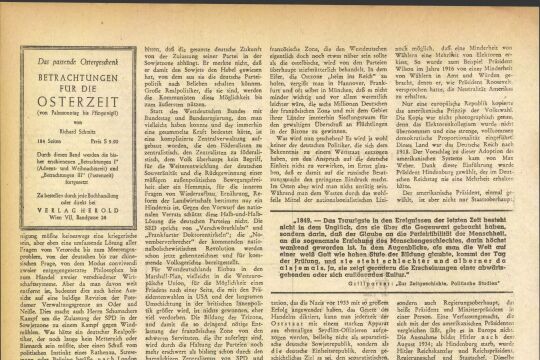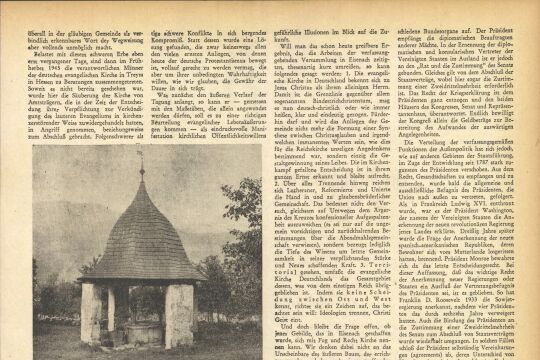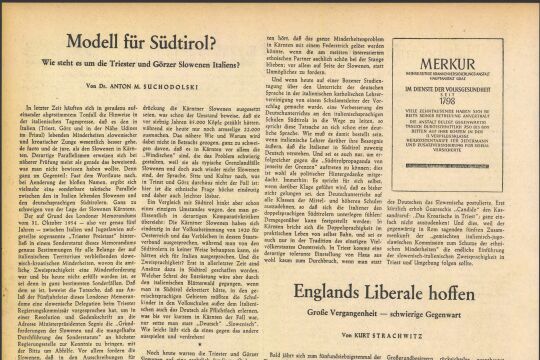Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Inönü und das Feuer
Am Vorabend der Wahlen zum türkischen Senat, die am 7. Juni abgehalten wurden, erlag der 67jährige Führer der „Gerechtigkeitspartei”, Ragip Gümüspala, mitten in den Wahlvorbereitungen einem Herzschlag. Mit ihm verlor die türkische Opposition nicht nur ihren Gründer, sondern auch den einzigen Mann in ihren Reihen, der Ministerpräsident Inönü zu gegebener Zeit hätte ab- lösen können,
Gümüspala schloß sich bei der Mairevolution 1960 als einer der letzten Generäle den Aufständischen an, trotzdem war er für kurze Zeit Generalstabschef, während der Herrschaft des „Komitees der nationalen Einheit”, wie die Militärjunta des heutigen Staatspräsidenten General Gürsel hieß. Infolge seiner gemäßigten Haltung dem gestürzten Men- deres und seinen Anhängern gegenüber, überwarf sich der verstorbene Politiker-General aber bald mit den übrigen Mitgliedern des Revolutions- komit s und ging in die Opposition. 1961 gründete er die „Gerechtigkeitspartei”, die bald die vor allem in den ländlichen Gebieten Anatoliens noch immer sehr zahlreichen Parteigänger der verbotenen Menderes’schen „Demokraten” an sich zog.
Partei ohne Programm
Bei den ersten freien Wahlen 1962 konnte die Gerechtigkeitspartei schlagartig 35 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen und gewann damit 158 von 450 Sitzen in der Nationalversammlung. Die „Republikanische Volkspartei” Ismet Inönüs erhielt knapp 173 Sitze und war gezwungen, eine Koalition mit zwei kleineren Parteien einzugehen. Gümüspalas erstes innerpolitisches Ziel war eine Generälamnestie für die in dem einjährigen Schauprozeß von Yassiada abgeurteilten Politiker und Prominenten des gestürzten Menderes-Regimes. An sonstigen brauchbaren innerpolitischen Initiativen ließ es die Gerechtigkeitspartei mangels eines einheitlichen Programmes freilich fehlen, so daß sie der von Regierung und Armee gleicherweise vorgebrachte Vorwurf, nur demagogische Opposition, ja Obstruktion zu betreiben, nijht ganz unberechtigt trifft. Das fehlende Konzept war auch der Grund, warum es Gümüspala nach dem eindeutigen Sieg seiner Partei bei den Gemeinderatswahlen im November 1963 nicht gelang, anstelle des infolge des Wahlergebnisses zurückgetretenen Inönü eine neue Regierung zu bilden. Präsident Gürsel hatte damals entgegen dem Willen der Armee den Oppositionsführer beauftragt, eine tragfähige Regierung zustande zu bringen und die Gerechtigkeitspartei sah ihre große Stunde gekommen. Der Versuch mißlang und Inönü mußte wieder einmal — wie schon so oft im Laufe seiner 50jährigen politischen Karriere — als „Retter des Vaterlandes” einspringen.
Die Juni-Wahlen zum Senat brachten nun einen neuerlichen Sieg der Gerechtigkeitspartei, die nunmehr über 78 Senatssitze verfügt, während die Republikanische Volkspartei nur 45 Senatoren stellt. Dieser Sieg kann jedoch nicht unmittelbar in einen realpolitischen Erfolg umgemünzt werden, da der 2. Kammer des türkischen Parlaments nur repräsentative Bedeutung zukommt. Es hat sich aber gezeigt, daß der Trend zur Opposition weiterhin anhält und es besteht kaum ein Zweifel, wer die 1966 fälligen allgemeinen Wahlen zur Nationalversammlung gewinnen wird. Auch der Ausgang des Vertrauensvotums, welches Ministerpräsident Inönü wenige Tage vor seiner Abreise in die USA von der Nationalversammlung verlangte, zeigt, über welch schmale Basis seine Regierung verfügt. Mit 200 Ja-, 196 Nein-Stimmen und zwei Stimmenthaltungen wurde Inönü das Vertrauen ausgesprochen. Diesen Vorsprung von vier Stimmen erachtete der Regierungschef für „ausreichend”, um seine Amerikafahrt anzutreten. Aus ihrer Sicht hatte ihm die Opposition nicht zu Unrecht das Vertrauen verweigert, da der schlaue alte Taktiker mit dem Vertrauensvotum, welches als Bestätigung seiner Zypempolitik gefordert worden war, versucht hatte, durch die Ausnützung der außenpolitischen Zwangslage seines Landes eine Aufwertung seines innenpolitischen Prestiges zu erreichen.
Wenig praktische Ergebnisse
Inönüs sommerliche „tour d’hori- zon” in die Hauptstädte der wichtigsten „Verbündeten” der Türkei brachte indes wenig praktische Ergebnisse. Der von Präsident Johnson angeregte Besuch Washingtons war die erste Auslandsreise eines türkischen Ministerpräsidenten seit Men- deres, wenn man von der Teilnahme Inönüs an den Begräbnisfeierlichkeiten für Kennedy absieht. Wiewohl die Unterredung mit Präsident Johnson in einer betont herzlichen Atmosphäre verlief und — wie es bei solchen Anlässen üblich ist — viel von der „Vertiefung der türkisch-amerikanischen Freundschaft” gesprochen und protokolliert wurde, ließ man im Weißen Haus keine Zweifel darüber aufkommen, daß die USA für keinen der streitbaren NATO-Partner einseitig Partei ergreifen werde. Die Initiative Johnsons zielte darauf ab, Griechenland und die Türkei zu direkten Verhandlungen über die Zypernfrage zu bewegen. Mit konkreten Plänen zur Lösung dieses Problems konnte und wollte der amerikanische Präsident nicht aufwarten. Während Inönü diesen Vorschlag sofort akzeptierte, hielt Griechenlands Premier Papandreou, der zwei Tage später in Washington eintraf, eine sofortige Begegnung mit seinem türkischen Kollegen für wenig zweckmäßig, da sie — wie er sich sarkastisch ausdrückte — „ein Gespräch zwischen zwei Schwerhörigen oder zwei Monologe” sein würde. Kein Wunder, daß die amerikanische Presse Papandreou mit weit weniger freundlichen Kommentaren bedachte als Inönü, ja selbst Präsident Johnson seine Verstimmung über diese Haltung nicht ganz verbergen wollte.
Die Besprechungen Inönüs mit Premierminister Home in London hatten neben dem in den USA im Vordergrund stehenden politischen noch einen juridischen Aspekt, da sowohl die Türkei als auch Großbritannien Signatarmächte der Zypernverträge von Zürich und London (1959) sind. Auch in London wurde jedoch versichert, man wolle im Streit um Zypern strikte Neutralität wahren, die britische Regierung anerkenne aber als Vertragspartei die unveränderte Rechtskraft der bestehenden Abkommen. Diese Meinung, die praktisch eine Unterstützung des türkischen Standpunktes darstellt, wurde — wenngleich in schwächerer Form — auch schon von den USA vertreten.
Nicht ganz so günstig klang das, was der türkische „good-will-travel- ler” auf der dritten Station seiner Reise, in Paris, zu hören bekam. Sofort nach Bekanntwerden der Einladung Johnsons an die Regierungschefs der Türkei und Griechenlands hatte sie nämlich General de Gaulle in seiner gewohnten Art, das Gesetz des Handelns an sich zu reißen, auch nach Paris eingeladen. Der französische Staatschef stellte von vornherein klar, daß er sich nicht direkt als Vermittler anbieten wolle und betonte, daß Frankreich wohl die Gültigkeit der Zypernverträge anerkenne — die von der Regierung Makarios und Griechenlands bekanntlich negiert wird — jedoch eine Revision für unvermeidlich halte. Dem Vernehmen nach soll de Gaulle persönlich den Anschluß Zyperns an Griechenland bei gleichzeitiger Gewährung der größtmöglichen Autonomie an die Insel-Türken befürworten, hütete sich jedoch davor, dies dem türkischen Ministerpräsidenten gegenüber auszusprechen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!