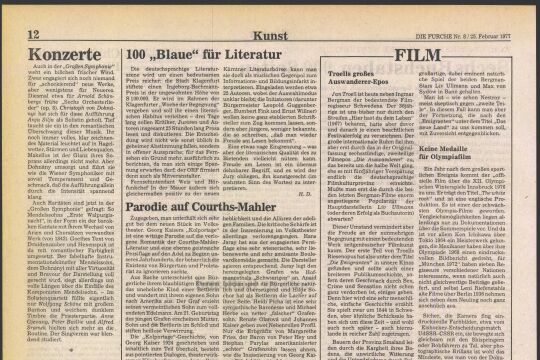Die Liebe, eine Torheit
Österreichs Filmschaffende haben ein distanziertes Verhältnis zu Liebe und Familie. Trotzdem werden sie nicht müde, in ihren Werken davon zu erzählen.
Österreichs Filmschaffende haben ein distanziertes Verhältnis zu Liebe und Familie. Trotzdem werden sie nicht müde, in ihren Werken davon zu erzählen.
Sehr oft, wenn es im österreichischen Film um Familie und Zusammengehörigkeit geht, drehen sich die Geschichten um persönliche Zugänge der Filmemacher - nicht selten sind es die eigenen familiären Hintergründe, die sie dazu bewegen, diese filmisch aufzuarbeiten; dabei steht meist ein beinahe selbsttherapeutischer Ansatz im Vordergrund der Erzählungen, selten bedarf es zusätzlich einer dramatischen oder dramatisierten Form. "Das Kind in der Schachtel" ist eine der jüngeren und der fundamentalsten Arbeiten zum Themenkomplex Familie im österreichischen Film. Regisseurin Gloria Dürnberger ist auch Protagonistin und durchstreift mit der Kamera ihre eigene Gefühlswelt in Bezug auf ihre psychisch kranke Mutter, die sie im Alter von acht Monaten zur Pflege freigab - in einer Schachtel, die sie auf den Boden stellte.
"Das Kind in der Schachtel" ist besonders durch den Aspekt einer Untersuchung am eigenen Schicksal geradezu prototypisch für den Umgang mit Familie im neueren heimischen Film. Hier gibt es genügend Beziehungs-Waisen, Menschen, die mit ihren Wurzeln nicht klarkommen oder sie gar nicht kennen.
Meine - keine? - Familie
Der Blick auf die Familie ist meistens distanziert und unterkühlt: Familiäre Sorgen strotzen im heimischen Film nicht vor Gefühl, sondern eher vor Nachdenklichkeit. "Meine keine Familie" zum Beispiel, der ebenfalls dokumentarisch und mit dem Regisseur als Protagonist an Identitäten forscht: Paul-Julien Robert wurde 1979 in der von Otto Muehl gegründeten Kommune Friedrichshof geboren und nimmt sich selbst als Ausgangspunkt für die Aufarbeitung dieser Zeit, unter der er bis heute in seinem sozialen Dasein leidet. Entlang der eigenen Befindlichkeit schlüsselt er auf, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund eine solche Kommune überhaupt erst denkbar scheint. Ein Einzelfall lässt bald ein umfassendes Gesellschaftsporträt entstehen.
Im Gewand eines Ensemble-Stücks verarbeitete Marie Kreutzer in ihrem Debüt "Die Vaterlosen" (s. Bild rechts) ebenfalls die Geschichte eines kommunenartigen Aufwachsens. Doch Kreutzer hat das Thema nur recherchiert und wuchs nicht selbst in einer Kommune auf. "Mich treibt seit jeher die Frage an, was Familie eigentlich ist, wie sie funktioniert und welche Modelle besser oder schlechter funktionieren", sagt Kreutzer. Das Familienbild ist immer auch definiert durch Werte, weniger durch Emotion. So bleibt "Die Vaterlosen" auffällig distanziert zu seinen Figuren, denn Gefühlskino ist das nicht. Vielmehr geht es um ein Verorten von Liebe in einer verrohten Welt.
Der österreichische Film ist unter diesem Aspekt näher an der Realität als andere Filmnationen: Hier gibt es keine tönenden Arien wie im hysterischen italienischen Kino, keine zum Kitsch arrangierten Bilder und Dialoge wie bei den Amerikanern, und auch der schier endlose Redefluss des französischen "Problemfilms" versiegt in Österreich. Bei uns wird mehr durch Schweigen gesagt als durch Reden. In dieser Hinsicht kommt der österreichische Film dem skandinavischen Understatement nahe: Vieles bleibt unausgesprochen, oft wird geschwiegen. Die Gefühle schwirren durch die Luft, manchmal kann man sie kurz spüren. Kein Wunder, dass "Die Vaterlosen" also ein wenig wie "Tilsammans" des Schweden Lukas Moodysson wirkt, auch, wenn ihm der typisch nordische Humor abgeht. Auch fällt auf, dass das heimische Kino mit Vorliebe die Schattenseiten familiärer Lebensformen untersucht; Ulrich Seidl ist meisterlich darin, hinter Fassaden spießbürgerlicher Idylle zu blicken, zugleich stilisiert er in seinen Filmen emotionale Bindungen zu brutalen Abhängigkeitsverhältnissen hoch -eine überzeichnete Art, wie nahe die Liebe beim Horror liegen kann. Ähnlich geschieht das in Veronika Franz' und Severin Fialas "Ich seh ich seh" (produziert von Seidl), der den Horror direkt in das Spannungsfeld zwischen Mutter und Kinder holt. Sogar der oft gescholtene "Kabarettfilm" hat seine Pointen zu einem Gutteil aus dem im Argen liegenden familiären Beziehungsgeflecht seiner Protagonisten bezogen. "Hinterholz 8" als Negativ-Schule für einen besseren Umgang mit der Familie? Wieso eigentlich nicht?
Eiskalte Emotionen
Gerade in den letzten Jahren haben sich viele heimische Filme den Lebens- und Beziehungsentwürfen der Gegenwart gewidmet: Dass Liebe kein Alter kennt, versucht "Anfang 80" festzustellen, Constantin Wulffs Doku "In die Welt" befasst sich angenehm unaufgeregt mit dem "Auf-die-Welt-kommen", Karl Markovics versucht sich mit "Superwelt" in einer Analyse ausgelaugter Menschen im Ehebetrieb und "Amour Fou" von Jessica Hausner (s. Bild oben) versteckt Sehnsüchte und Lebenslügen in einem sprachlich wie optisch strengen Korsett. Dieser Film ist weit entfernt von der eiskalten und doch emotionalen Wucht von Hausners Lehrer Michael Haneke, der in "Der siebente Kontinent" den geplanten Abschied einer Familie aus dem Leben in beengte Bilder gegossen hat.
Aber vielleicht hat Jessica Hausner mit "Amour Fou" mehr über die Liebe gesagt als die meisten anderen: Nämlich, dass sie eine Torheit sein kann. Und eigentlich auch sein muss.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!