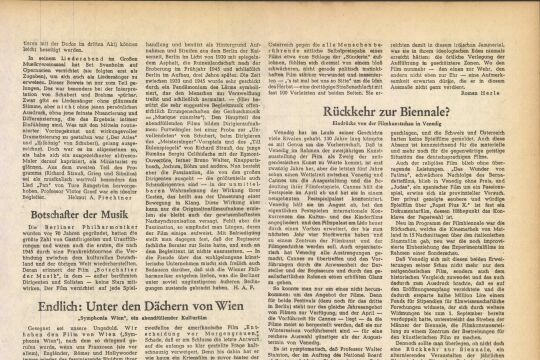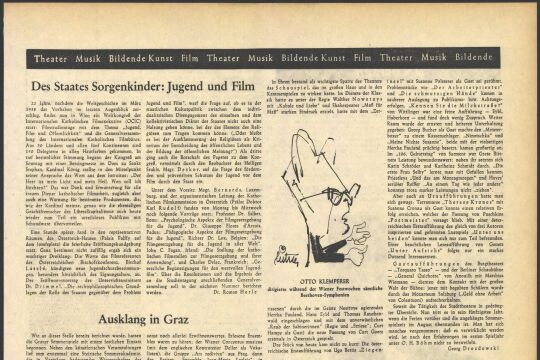Die 60. Filmfestspiele in Cannes prämierten nicht den Mainstream, sondern das aufstrebende Kino aus Osteuropa.
Zum 60. Jubiläum in Cannes sollte das Kino zelebriert werden, nicht das wichtigste Filmfestival der Welt. Deshalb ließ Festivalpräsident Gilles Jacob 33 international renommierte Regisseure (darunter Lars von Trier, Ken Loach, Wong Kar Wai, die Coen-Brüder oder Wim Wenders) dreiminütige Episoden über das Kino als Projektionsstätte von Bildern, Träumen und Sehnsüchten entwerfen. Das Filmexperiment mit dem Titel Chacun son cinéma (Jedem sein Kino), in Cannes uraufgeführt, setzt sich aus mal mehr, mal weniger gelungenen Kurzfilmen zusammen, deren Regisseure mal eitel, mal stilsicher, mal ironisch und zynisch, manchmal aber auch selbstverliebt über ihre Kunst berichten.
Qualität ohne Visionen
Die Präsenz mehrerer Regisseure, die bereits eine Goldene Palme erhielten, passte zum Jubiläumskonzept: Joel und Ethan Coen, Gus van Sant, Emir Kusturica oder Quentin Tarantino zeigten ihre neuesten Werke im Wettbewerb. Ein Wettbewerb, der zu den stärksten der letzten Jahre zählte, von großer Qualität, allerdings ohne neue Visionen. Etablierte Filmemacher erzählten, was sie am besten zu erzählen verstehen, anstatt sich auf neues Terrain zu wagen: Die Coens kehren mit No Country for Old Men zu ihrer alten Form aus Fargo-Zeiten zurück, Gus van Sant erwies sich mit Paranoid Park stilistisch einmal mehr als der zur Zeit beste Porträtist einer ziellosen amerikanischen Jugend. Michael Moore polemisierte mit Sicko gewohnt zynisch über Amerika - diesmal über das dortige Gesundheitssystem.
Der Österreicher Ulrich Seidl wiederum scheitert an seinem Stil: In seiner Ost-West-Parallelmontage Import/Export reproduziert er Hundstage, ohne dem Übel seiner Figuren auf die Spur kommen zu wollen. Seelenloses Kino, aber immerhin mit einer neuen Zutat: Noch nie endete ein Seidl-Film derart hoffnungsvoll.
Um es positiv zu sehen: Cannes zelebrierte Filmemacher, die ihren eigenen Stil gefunden haben und ihn pflegen. Zur Pflege gehört freilich auch Weiterentwicklung, und die fehlte. So wird aus großer Kunst schnell bloßes Kunsthandwerk.
George Clooney altmodisch
Ebenfalls ein Wiederholungstäter: Quentin Tarantino drehte mit Death Proof wenig überraschend ein B-Movie im Stile der 70er Jahre. Nur, dass diesmal die Kratzer, die linkischen Schnitte und die unsauberen Tonsprünge einer verstaubten analogen Filmkopie digital dazuimitiert wurden. Die Beschäftigung mit dem Film als Material schien vielen Regisseuren dieses Festivals ein besonderes Anliegen zu sein. Während sich George Clooney, der wohl altmodischste aller zeitgenössischen Filmhelden, in Steven Soderberghs Ocean's 13 sagen lassen muss, er wäre ein analoger Held in der digitalen Zeit, trifft genau diese Diagnose auf das Kino an sich zu: Filmmaterial aus Zelluloid verschwindet zunehmend aus dem Produktionsprozess, an seine Stelle treten digital gefilmte Videos, die den einzigartigen Film-Look via aufwändiger Computerprogramme imitieren - und so letztlich helfen sollen, in dieser teuersten aller Künste Geld zu sparen.
Kein Wunder also, dass viele der Kurzfilme aus dem Cannes-Jubiläumsfilm von der Endlichkeit des Kinos berichten. Eine Mahnung zur Erhaltung des Kinos als kollektiver Erlebnisraum. Widersprüchlich dazu wurde diese Kurzfilmsammlung in Cannes mit neuesten Projektoren digital auf die Leinwand projiziert. Wie übrigens Dutzende weitere Filme auch. Kritiker-Kollegen, die mit der Technik nicht vertraut sind, wunderten sich dann über die viel zu scharfen, seelenlosen und erkalteten Bilder, die diese Maschinen erzeugen.
"Film ist Technik"
Der Wandel zum digital projizierten (und damit beliebig manipulierbaren) Bild ist vielleicht jenes zentrale Thema, das bei diesem Festival von seinen Rezipienten am häufigsten übersehen wurde. Denn beim Kinofilm zählt eben nicht allein der Inhalt, sondern auch und vor allem die Form, in der er präsentiert wird. Oder, wie es der türkischstämmige deutsche Regisseur Fatih Akin gegenüber der Furche radikal auf den Punkt brachte: "Film ist Technik": Die Form bestimmt daher auch maßgeblich den Inhalt, die Botschaft.
Dabei ist es gerade Akins Film Auf der anderen Seite, der hier in ganz klassischer, fast altmodischer Weise von der Verständigung der Kulturen und von der Vermengung von Identitäten erzählt. Akins zweigleisige, sehr emotionale Geschichte, die von einem Deutschtürken erzählt, der nach Istanbul geht, und von einer türkischen Polit-Aktivistin, die sich vergeblich um Asyl in Deutschland bemüht, ist nicht nur ein zutiefst politischer Film geworden, sondern ist auch ein Paradebeispiel für die perfekte (technische) Konstruktion einer Geschichte, die mit Kinobildern erzählt wird. Die der Jury unter dem Vorsitz von Stephen Frears vergab an Akin den Drehbuchpreis. Selten hat eine auf Papier entworfene Filmkonstruktion außerhalb des profitorientierten Hollywood-Mainstreams besser funktioniert als hier.
Darin liegt ein großer Zwiespalt: Das Festival braucht die Stars und ihre dümmlichen Filme - und umgekehrt. Draußen auf der Croisette dürfen die Fotografen die modifizierten Oberweiten von Pamela Anderson bewundern oder über die Drogengeschichten von Joaquin Phoenix spekulieren. Drinnen aber, unter dem berühmten Cannes-Logo mit der Palme, hat die Kunst das Sagen. Es ist immer wie-der verwunderlich, wie dieses Festival die Balance aus Boulevard und Anspruch meistert und dabei noch alle Beteiligten zufrieden stellt.
Sieger, die es schwer haben
So haben die Preise für die Japanerin Naomi Kawase (Großer Preis der Jury) und ihren Film Der Trauerwald, für Maler Julian Schnabel (Regiepreis für Le Scaphandre et le Papillon) und für den bemerkenswerten französischen Schwarzweiß-Zeichentrickfilm Persepolis (Preis der Jury) vor allem jene Werke geadelt, die es an der Kinokasse vermutlich schwer haben werden. Filme, die Gift sind für den produzierenden Teil der Filmwirtschaft. Jene Leute, die auch gerne die 35mm-Projektoren durch digitale Geräte ersetzen und so die Magie des Kinos ausknipsen würden.
Auch die Goldene Palme für 4 Monate, 3 Wochen and 2 Tage des Rumänen Cristian Mungiu ist ein Problemfall für die Wirtschaftler: Ein sprödes, aber unheimlich packendes, grausames Abtreibungsdrama aus dem kommunistischen Rumänien der 80er Jahre, fantastisch gespielt und von Beginn an als Sieger favorisiert. Kinobesucher müssten sich nach solchen Filmen sehnen: Mungiu gelingt intensives, kompromissloses Kunstkino, das fesselt. Eigenschaften, die man von Hollywood schon lange nicht mehr erwarten kann.
Der Siegerfilm und etliche andere überzeugende Produktionen zeigten: Während sowohl die Filme aus den USA, aus Westeuropa und auch aus Asien einen schwächeren Jahrgang erwischt haben, kommen die wirklich spannenden Geschichten heute aus Osteuropa.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!