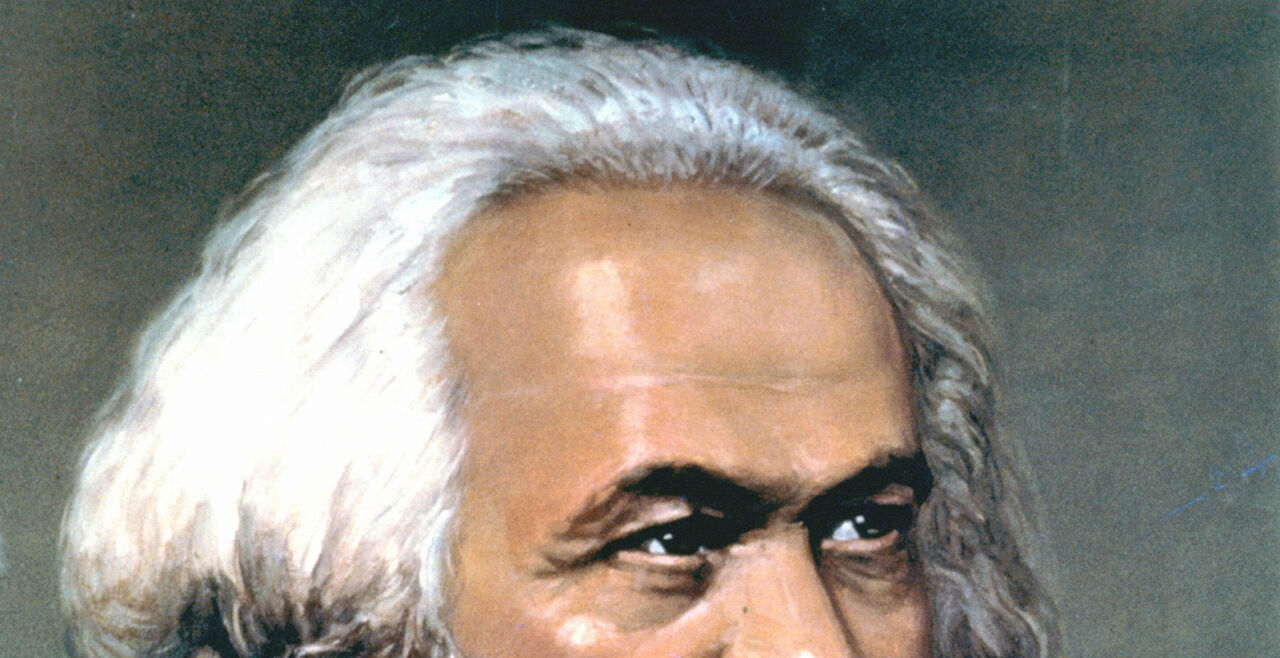
Philosophie der Arbeit: Mehr als Mühsal
„Die Jungen wollen nicht mehr arbeiten“, hört man heute oft. Ist das so? Eine historische Reise in die Philosophie der Arbeit.
„Die Jungen wollen nicht mehr arbeiten“, hört man heute oft. Ist das so? Eine historische Reise in die Philosophie der Arbeit.
Die Philosophin Hannah Arendt schreibt ihrer Gegenwart Mitte des 20. Jahrhunderts zu, eine „Arbeitsgesellschaft“ zu sein. Sie reflektiert damit die Verherrlichung der Arbeit, die seit dem 17. Jahrhundert stattfinde, und kritisiert einen Zeitgeist, der neben der Verpflichtung zum Arbeiten andere Tätigkeiten vernachlässige – Tätigkeiten, die Arendt als „höhere“ und „sinnvollere“ begreift.
Obgleich uns Arbeit in der abendländischen Moderne als existenziell anthropologische Grundkonstante menschlicher Tätigkeit erscheint, war in der Antike Arbeit nicht bestimmender und sinnstiftender Wert, sondern vor allem notwendiges Übel. Wenn wir heute Freizeit über diejenige Zeit definieren, wo nicht gearbeitet wird, so galt in der Antike Arbeit genau umgekehrt als Nicht-Muße (neg-otium).
Ins Reich des Häuslichen, des oikos, verbannt, war die Arbeit den niederen Ständen, Frauen und Sklav(inn)en vorbehalten. Die Polis-Bürger dagegen konnten sich neben den politischen Angelegenheiten ganz der Muße widmen, etwa Kunst, Wissenschaft, Philosophie. Auch in der jüdisch-christlichen Tradition gilt Arbeit primär als Mühe und Beschwernis, weshalb ihre Notwendigkeit gerne moralisch begründet wird. So heißt es im berüchtigten Paulusbrief: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“
Arbeit wird als Pflicht gegenüber der Gesellschaft gedacht. In der Neuzeit rückt Arbeit nicht nur theologisch-ethisch, sondern auch immer mehr politisch und wissenschaftlich in den Fokus. Die klassische Ökonomie entsteht. Begründet der frühe Aufklärer John Locke die Entstehung des Eigentums noch mit der privatistischen Aneignung der Natur durch Arbeit, rückt für den ersten Nationalökonomen, Adam Smith, die Arbeit als Quelle von gesamtgesellschaftlichem Wohlstand in den Fokus. Im Übergang von der feudalen zur kapitalistischen Gesellschaftsform, die sich vor allem durch private Akkumulation und (Früh-)Industrialisierung auszeichnet, stellt sich die Frage, wem die Arbeit und der dadurch geschaffene Mehrwert gehört.
Befreiung von Arbeitszwängen
Karl Marx beschreibt dazu die Entstehung der doppelt „freien“ Lohnarbeiter(innen): Frei von ständisch-feudaler Beherrschung, aber auch frei von Eigentum an Produktionsmitteln, sind die Arbeiter gezwungen, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Die Arbeitskraft selbst wird zur Ware am Markt. Entgegen unserer heute gebräuchlichen und ideologisch verbrämten Unterscheidung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist Geben und Nehmen, wenn es um Arbeit geht, also genau umgekehrt gelagert.
Arendt wirft Marx vor, die Arbeit als allein produktive menschliche Tätigkeit zu glorifizieren, wenngleich sie um sein Ziel einer Befreiung von notwendigen Arbeitszwängen weiß. Dass Arbeit nicht erst im Kapitalismus fetischisiert wird, zeigt sich schon am von Marxʼ Schwiegersohn Paul Lafargue verfassten Manifest „Recht auf Faulheit“ als polemische Reaktion auf die seiner Ansicht nach verfehlte sozialistische Forderung des 19. Jahrhunderts auf ein Recht auf Arbeit. In treffender Erweiterung von Arendt charakterisiert der Soziologe Robert Castel unsere Gegenwart als „Lohnarbeitsgesellschaft“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


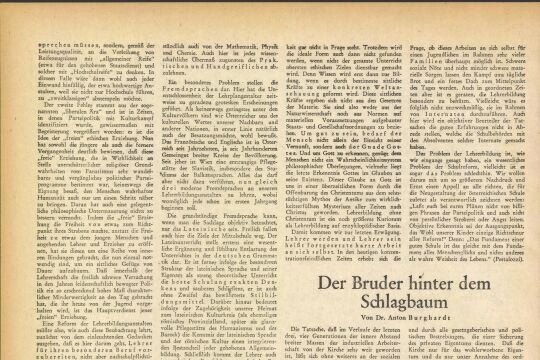























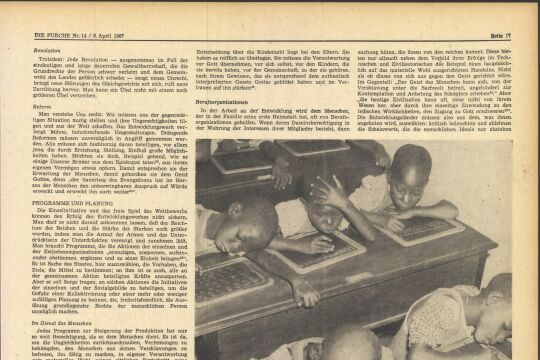
















































.png)


.png)
















