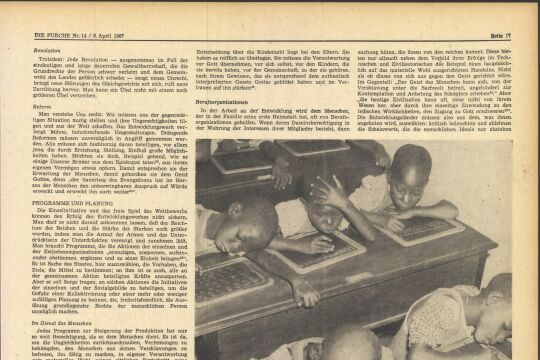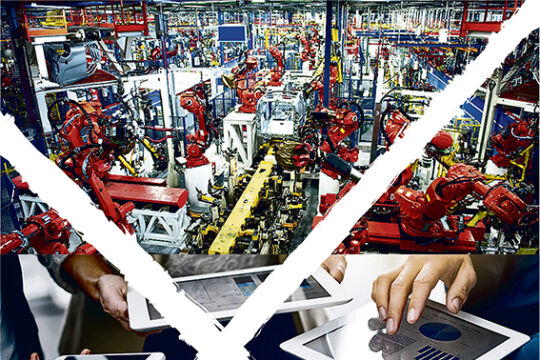Die Vision einer solidarischen Gesellschaft
Wenn alles zum Markt wird, dann ist auch die Armut nur eine Frage der Geldverteilung. Aber Armut hat nicht nur mit Geldmangel zu tun, meint der Autor dieses Beitrags in provokanten Thesen.
Wenn alles zum Markt wird, dann ist auch die Armut nur eine Frage der Geldverteilung. Aber Armut hat nicht nur mit Geldmangel zu tun, meint der Autor dieses Beitrags in provokanten Thesen.
Wir sollten uns auf das Verschwinden der komfortablen Arbeitslandschaft der Vergangenheit einstellen. Das Arbeitsvolumen sinkt, das gut geschützte Normalarbeitsverhältnis wird zu einem Restposten, die Erwerbsbiographien werden diskontinuierlich, das Leben wird unplanbar. Sozialsysteme, die auf kontinuierliche Vollzeit-Erwerbsarbeit zugeschnitten sind, versagen zunehmend als soziales Auffangnetz.
Als Hauptproblem werden die mit dieser Entwicklung einhergehenden monetären Verarmungsprozesse angesehen. Als Lösung bieten sich alle möglichen Arten von Grundsicherungen an (siehe S. 2, Anm. d. Red.). Sie sollen die armutserzeugenden Eigenschaften der neuen Arbeitswelt ausgleichen, vor allem die Verringerung und die Unstetigkeit der Einkommen.
Es gibt keine - menschlichen Ansprüchen - genügende Alternative zu einer Grundsicherung. Heute gilt: Ohne Geld ist der Mensch kein Mensch. Wenn alles zum Markt wird, dann entwickelt sich auch die soziale Frage immer ausschließlicher zu einer Frage der Geldverteilung. Aber muß man das hinnehmen? In welchem Ausmaß hat Armut wirklich mit Geldmangel zu tun? Betrifft die oft verwendete Formel von "Armut inmitten des Wohlstands" nicht nur Personen, sondern verarmen wir alle in bestimmten Bereichen des Lebens? Und hat dies mit unserer manischen Fixierung auf bestimmte Arten des (Schein-)Reichtums zu tun?
Die Orientierung auf eine bloß monetäre Grundsicherung läuft Gefahr, daß sie ungewollt zum Verbündeten der "neoliberalen Invasion" (Bourdieu) wird. Damit könnte sich die neoliberale Vision endlich ein soziales und demokratisches Mäntelchen umhängen.
Immerhin ist die Konzeption der Grundsicherungen ein Kind des Verteilungsdenkens. Sie schöpft ihre sozialpolitische Kraft aus der monetären Ökonomie. Sie ist sozialpolitisch gespiegelte Interessenökonomie. Man baut dabei auf soziale Qualität durch Geld und - von der Durchsetzung her - auf die Architekturen des Staats- und Gesellschaftsgefüges der Moderne. Beide Prämissen sind aber nicht mehr zeitgemäß.
Die bisher weitgehend unreflektiert gebliebene Liaison von Arbeitssystem und Sozialpolitik mit einer quantitativen, die konkreten Inhalte von Produktion und Produktionsfolgen ausblendenden Wachstumsphilosophie müßten aufgekündigt werden.
Grundsicherungen ändern vorerst nichts an der qualitativen Problematik des heutigen Wachstumsprozesses. Dieser produziert keinen wirklichen Reichtum mehr. Die Parallelität von monetärem Wachstum und menschlichem Reichtum ist der Geldökonomie abhanden gekommen. Das Wachstum ist destruktiv geworden, seine Bilanz ist negativ. Die nicht monetären Reichtumsfelder, zum Beispiel die Nichterwerbsarbeit, werden verdrängt, abgewertet und prekarisiert. Die Erwerbsarbeit gerät unter einen schrankenlosen Rationalisierungsdruck.
Die Natur, eine Reichtumspenderin höchster Qualität, wird demoliert und achtlos verschlissen. Das für ein befriedigendes Leben erforderliche sozio-kulturelle Umfeld wird ausgetrocknet. Menschengerechte Zeitstrukturen lösen sich auf. Verheerend sind die Auswirkungen auf Tätigkeiten außerhalb des Erwerbssektors, auf jene Arbeit, die durch Konvivialität und Kooperation, durch eine nicht tauschförmige Verknüpfung produktiver Leistungen und eine Einbettung in kulturell geprägte Umfelder gekennzeichnet ist. Diese unverzichtbare Brücke zwischen Warenwelt und Lebenswelt wird morsch und droht einzustürzen.
Ein neuer Reichtum Sollten Grundsicherungen an dieser verhängnisvollen Dynamik nichts ändern, so lösen sie das Armutsproblem nur vordergründig. Sie wären nur eine armutspolitische Notbremse. Grundsicherungen sollten daher nicht Freizeit (Nicht-Arbeit, Einkommensausfälle) finanzieren, sondern autonome lebensweltliche Tätigkeit außerhalb der Marktökonomie. Sie sollten eine Tätigkeitsgesellschaft konvivialer, selbstbestimmter, in Gemeinschaften, Familien und Vereinigungen erbrachter Arbeit stützen. Wir brauchen eine starke und entwicklungsfähige zweite Ökonomie. In sozio-kulturelle Zusammenhänge und Sinnstrukturen eingewobene Tätigkeiten bilden die Grundlage für eine neue Art von - allerdings in Geld nicht messbarem - Reichtum. Sie verbinden die Fülle der auf Märkten produzierten Waren und Dienstleistungen mit einem selbstgestalteten, lebensweltlichen, nichtrationalisierten Kosmos, in der der Mensch und nicht Artefakte und Sachzwänge herrschen.
Wo aber ist das Subjekt solcher Großreformen? Wann, wo und wie tritt es auf den Plan? Oder sollte man sagen: Woher kommt die Erhellung? Sind nicht die Menschen vom ökonomischen Denken zerfressen? Definieren sie sich nicht als Monaden, ihr Leben als Aufeinanderfolge von Tauschprozessen, ihre Besitzstände als politisch unantastbar und die Welt als Kaufhaus?
Ja und nein. Jedenfalls ist dies keine Frage einer naturgesetzlich bestimmten ökonomischen Überlegenheit der Konkurrenzökonomie. Es ist vielmehr eine Frage der Deutung der Welt, der Definition von Reichtum und Armut - und damit ein Problem jenseits der Politik.
Wenn wir den Übergang von einer Ökonomie der bloßen Quantität und der Unbeherrschbarkeit der Wachstumsfolgen in eine durch Qualität bestimmte wollen, dann muß eine andere Sichtweise des Verhältnisses von "Ich" und "Gesamtheit" zur allgemeinen metapolitischen, globalen und geistigen Grundlage des Denkens und Handelns werden. Zwei zentrale Denkkategorien, gleichzeitig zwei große Irrtümer der Moderne, die Begriffe "Interesse" und "Ich", wären, jedenfalls in ihrem gewalttätigen Absolutheitsanspruch, zu verabschieden.
Die Konstruktion des isolierten Individuums ist die grundlegende Glaubenswahrheit des Neoliberalismus, der ganzen Moderne, einschließlich der alten Sozialpolitik. Die neue, zweite Ökonomie der Postmoderne orientiert sich nicht mehr an Interessen, Nehmen, Vorteil, Gier, Haben und Tausch, sondern an Werten, Produkten, Künsten, Haltungen und Ethiken. Damit wird der Mensch vom Nehmer zum Geber, das Leitbild der Arbeit eher Kunst, Spiel, Sport, Hilfe, aber auch Selbstzweck. Eine Logik und Ökonomie des Gebens kann, wie sich nachweisen läßt, funktionieren. Sie ist einer hochkomplexen, eng verflochtenen und solidarischen Ökonomie angemessener und daher zeitgemäßer als die alte Interessenökonomie.
Ende des Egoismus?
Diese Vorstellung kann nicht als abgehobene "zivilisationskritische" Vision denunziert werden. Die Überwindung der egozentrischen, linearen Befreiungsideologie der Moderne ist immerhin der gemeinsame Horizont der Komplexitätswissenschaften, der philosophischen Kritik der Moderne und einer entwickelten Steuerungstheorie der Postmoderne. Die festgefügten Begriffe, Architekturen, Strukturen lösen sich auf. Politik hat es mit dynamischen, unkontrollierbaren und extrem schnellen Fraktalen zu tun. Aus der Sicht abstrakter Gesellschaftstechnologien (Staat, Recht, Demokratie) ist die postmoderne Gesellschaft subjektlos und quallenartig, also nicht mehr bearbeitbar und gestaltbar. Gerade deswegen ist sie aber das perfekte Feld für die Entfaltung raffinierter Strategien aller jener, denen nicht am Wohl des Ganzen liegt, sondern die sich bereichern wollen.
Mehr Sein als Haben Diese Gesellschaft ist zum Dschungel geworden, unsteuerbar, unübersichtlich, irrational. Sie ist biologisch geworden und eher einem Lebenwesen als einer Maschine ähnlich. Das lineare Interessendenken, das der Architektur und Physik des alten Kapitalismus und des alten Verfassungsstaates entsprach, stellt daher keine angemessene Grundlage für die Steuerung und Veränderung eines solchen postmodernen Systems dar.
Nur eine Synthese radikal konstruktivistischen Denkens mit den Überlegungen zur Beherrschung von extremer Komplexität in den Systemwissenschaften kann das Dilemma lösen. Dazu bedarf es aber zu "Selbst"-Bewußtsein gelangter Subjekte, die dazu fähig sind, sich jenseits der wölfischen Gesetze des Dschungels gegenseitig zu verpflichten, ein gemeinsames Leitbild vom guten Leben zu vereinbaren und sich als Teil einer sinnvollen Ordnung zu begreifen, egal, ob dies ihren aktuellen Interessen jeweils entspricht oder nicht. Eine andere Art von Kohäsion postmoderner Gesellschaften ist nicht denkbar. Solche Verträge eröffnen die faszinierende Option, gemeinsam die wichtigen Dinge des Lebens zu definieren, also etwas zu tun, was die Interessengesellschaft der Moderne geflissentlich unterlassen hat, da sie befangen im Geld- und Wachstumskonsens, alles "Wichtige" im Leben, wie Sloterdijk treffend diagnostiziert, zur Privatsache erklärt hat.
Die Begriffe arm und reich haben sich einer neuen Erzählung zu stellen, die dem abstrakten Geldreichtum einen zwar wichtigen, aber keinen dominierenden und alles andere unterwerfenden Platz zuweist. Mit einer Philosophie des Gebens, der Konzentration auf das Werk, und eines immer wieder auch kontemplativen Lebens würden sich die produktiven Potentiale, die durch das Tauschprinzip eingekerkert sind, in ungeahnter Weise entfalten können.
Der Autor ist Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Salzburg und Abgeordneter zum Salzburger Landttag.