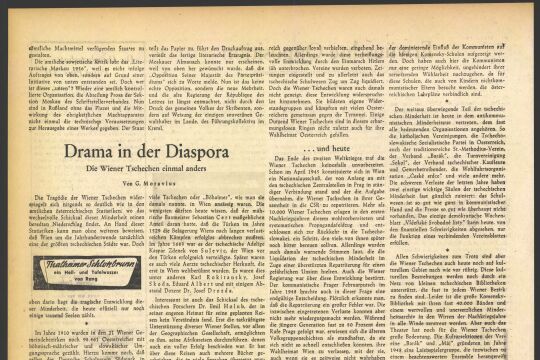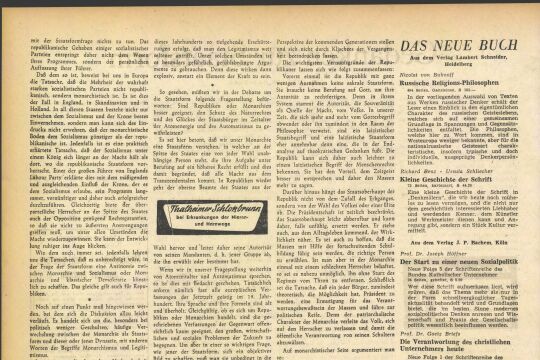Ein völlig unaktuelles Thema. Denn wen interessiert im Zeitalter der Schönheitskonkurrenzen und der höchsten Hochkonjunktur die Politik und wen schon gar die Intellektuellen? Die ob ihrer Fortschrittlichkeit mit Recht berühmten Amerikaner haben seit jeher diese Sorte von Menschen mit jenem Mißtrauen betrachtet, das „gesundem Volksempfinden“ entspricht und sich als gesellschaftliches Leitbild die Unternehmerpersönlichkeit, den Geldmacher, erwählt. Mag sein, daß sich die Kommunisten eben gern für das Gegenteil dessen entscheiden, was die Amerikaner tun, möglicherweise kommt es daher, daß bekanntermaßen die kommunistischen Regierungen recht weit vom Volksempfinden überhaupt entfernt sind; jedenfalls sind die Sowjets für die Intellektuellen (wenn auch nur für die gehorsamen). Konsequenterweise fahren ihre Raketen in den Himmel, während die amerikanischen sich häufig, entgegen der Widmung, in die Erde bohren.
Schon diese Ereignisse zwingen einem den Schluß auf, daß das gesunde Volksempfinden bei der Einschätzung der Intellektuellen wie der Politik irrt. Reizvoll ist es also, die Bedeutung beider Faktoren und auch deren Zusammenhang zu untersuchen.
Vielfach begeht man den Fehler, zu glauben, daß der Akademiker dem Intellektuellen entspreche, daß sich die beiden Begriffe nahezu decken oder zumindest dieser der Oberbegriff jenes sei. Es handelt sich aber um zwei grundverschiedene, sauber zu trennende und in ihrer Verschiedenheit historisch belegbare Typen.
Ein Intellektueller ist ein Mensch, der seine Position zur Welt auf Grund einer rationalen Analyse aller Gegebenheiten bestimmt und darnach handelt. Das heißt, daß er sein Weltbild mehr oder minder frei von Ressentiments, Vorurteilen oder unterbewußten Faktoren bildet. Dieses Weltbild darf nicht mit irgendeiner „wertfreien“ Einstellung verwechselt werden';i denn Werte“kSfftferr sehf'woh+ Tattötiäl begriTFeh “und in “däs'Tätiöni“äle““We'ItDitd “eingebaut werden. So kann sich religiöse Erkenntnis durchaus auf intellektueller Basis vollziehen. Die Existenz eines vollkommenen Weltbildes setzt allerdings eine umfassende Bildung, die Kenntnis der vielen Ausdrucksformen des Lebens voraus. Geht man nämlich nur von einem Wissensgebiet aus, dann ist es unmöglich, die gemeinsamen Komponenten aller festzustellen, man hält eine Nebensache für entscheidend und kommt zu einem einseitigen — einem „ver-hatschten“ Weltbild. Daher muß ein Intellektueller wenigstens einiges aus der Politik, Wirtschaft, Soziologie und Staatslehre, der Literatur, bildenden Kunst, Musik und Philosophie wissen.
Hingegen sind die Akademiker Angehörige eines Standes, der schon fast die Charakteristika einer Klasse trägt. Auf Grund ihrer Ausbildung besetzen sie gehobene Positionen in Staat und Wirtschaft, schließen sich recht erfolgreich gegen den Zustrom fremder Elemente ab und zeigen einen — soweit dies in einer Zeit kultureller Nivellierung noch möglich ist -eigenen Lebensstil. Ihre Bildung ist heute mitunter lückenhaft und ihr Wissen beschränkt sich zumeist auf das unmittelbare Gebiet ihres Berufes. Ihr Weltbild ist zur reinen Schablone erstarrt und erbt sich Generationen hindurch fort. Natürlich findet man unter den Akademikern die meisten Intellektuellen, denn die Mittelschul-und Universitätsbildung schafft die Basis zur intellektuellen Entwicklung, aber der Akademiker an sich ist weit davon entfernt, ein Intellektueller zu sein.
Die Intellektuellen hingegen können begrifflich niemals einer bestimmten Klasse angehören, da sich die Klassenzugehörigkeit im allgemeinen nach anderen Faktoren richtet als nach analytischer Prüfung der Umweltphänomene. So waren die Intellektuellen im Laufe der historischen Entwicklung bei sehr verschiedenen Klassen zu finden. Ganz gleichgültig, welcher sie entstammten, standen sie zumeist an der Spitze jener Gruppe oder Kiasse, die daranging, eine historische Sendung zu erfüllen. Sie bildeten die aktivsten Elemente des Christentums im frühen Mittelalter — man denke nur an die dynamische Kraft und kulturelle Wirksamkeit der Orden —, sie waren die Träger des Humanismus und die Elite der revolutionären Bewegungen von 1789 bis 1848. Dieselbe Rolle spielten sie im Rahmen der Volksbewegung, die den Liberalismus ablöste.
Allerdings konnte man während langer Epochen die Akademiker tatsächlich fast durchweg als Intellektuelle bezeichnen, ihre Abwertung vollzog sich erst in neuerer Zeit, als der moderne Staatsapparat und die sich entwickelnde Wirtschaft eine immer größere Zahl von akademisch gebildeten Fachleuten benötigten, aber keine Universalisten. Sie gerieten überdies zwischen die für den sozialen Entwicklungsprozeß maßgebenden Gruppen. Man brauchte sie nämlich, aber auf Grund ihrer gesellschaftlichen Position — auch sie hatten nur ihre Arbeitskraft anzubieten — wurden sie kaum oder immer weniger auf der einen Seite als ebenbürtig anerkannt, was sich — wie allgemein bekannt — in der relativ immer schlechteren Bezahlung ausdrückte. Da sie anderseits das schon geschilderte Monopol auf bestimmte gehobene Positionen im Produktionsprozeß besaßen, entstand bis in die jüngste Zeit auch keine Verbindung mit der Arbeiterschaft, so daß die Akademiker, zwischen den großen Klassen stehend, in jene typisch kleinbürgerliche Position herabsanken, die für Gruppen charakteristisch ist, welche bei der stürmischen wirtschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrhunderts auf der Strecke blieben — wie etwa das Kleingewerbe — und die sich gegen ihre unerfreuliche gesellschaftliche Position in faschistischen Abenteuern aufbäumten. Man denke daran, daß die „Nationalen“ noch heute in der Akademikerschaft weit stärker sind, als ihrem Stimmenanteil bei den Wahlen entspricht.
Da Regieren doch irgendwie eine Sache des Geistes ist, läßt es sich verstehen, daß den Intellektuellen im Rahmen jeder Regierungsform — zumindest seit Beginn der Neuzeit — einiges Gewicht zukommt. Es besteht also die Vermutung, daß sie auch im Rahmen der Demokratie wesentliche Funktionen ausüben.
Soll die Demokratie richtig funktionieren, dann müssen sich die Regierenden an den Auftrag der Wähler halten. Das wird heute eben in der Form realisiert, daß eine Partei ihr Programm offeriert und — wenn dieses von den Wählern akzeptiert wird — in ihrer Tätigkeit daran gebunden ist. Verstößt sie dagegen, dann hat der Wähler spätestens in einigen Jahren die Gelegenheit, sie durch Entzug seiner Stimme zu bestrafen.
Dieses demokratische Prinzip ist im heutigen Österreich nicht nur die Basis der Staatsform, sondern auch einer Unzahl anderer Vereinigungen, seien es Körperschaften öffentlichen Rechts, seien es Interessenvertretungen. Dennoch murren die Mitglieder ständig und sind mit ihren Funktionären alles eher denn zufrieden. Am wenigsten natürlich die Staatsbürger mit ihrer Regierung. Allgemein wird dieses eigenartige Phänomen dadurch begründet, daß die Funktionäre unabhängig von der Meinung und den Anschauungen der Mitglieder agieren. Das bestätigte sich sogar, als die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ihre Angehörigen darüber abstimmen ließ, ob diese eine Altersversorgung wünschten. Dabei erwies sich, daß die Mitglieder, im Gegensatz zu der von der Kammer offiziell vertretenen Theorie, in ihrer überwältigenden Mehrheit für die Einführung der Pensionsversicherung waren.
Nun ergibt sich allerdings eine logische Schwierigkeit. Wie kommt es denn, daß in einer demokratischen Organisation — also in einer Organisation, in der Vergehen der Gewählten unnachsichtig bei der nächsten Wahl geahndet werden — die Führer dauernd ohne oder manchmal sogar gegen den Willen der Wähler handeln? Die modische neoliberale Theorie weiß dafür die Antwort, daß dieser Zustand aus der ungeheuren Größe der zeitgenössischen Organisationen stamme. Diese kollektivistischen — ein alle negativen Erscheinungen erläuterndes Zauberwort — Monstren erstickten das Individuum! Nun hat sich aber die Bevölkerung Europas in den letzten Jahrzehnten nicht so übermäßig vermehrt und die Organisationen sind heute nicht* um soviel größer als in der Vergangenheit, da sie noch nicht „kollektivistisch“ waren und ihre Mitglieder noch kein Unbehagen fühlten. Es ist daher unerklärlich, warum sie gerade jetzt ihren Angehörigen über den Kopf wachsen.
Die Ursache dieser Erscheinung liegt aber nicht, wie die Neoliberalen sagen, bei den Führern, sondern bei den Geführten. Jede demokratische Organisation lebt von der Parteinahme ihrer Mitglieder, davon, daß sie ihr einen Auftrag erteilen oder ein Programm bestätigen. Um aber wirklich Partei ergreifen zu können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Der einzelne muß in der Lage sein, die von einer Organisation zu bewältigenden Probleme zu überblicken, und muß bereit sein, in irgendeiner Form mitzuarbeiten. Diese Mitarbeit muß nicht darin bestehen, daß er Funktionen übernimmt. Es genügt, wenn er die Organisationsleitung kontrolliert, die Möglichkeiten ausnützt, welche der Kritik institutionell eingeräumt sind, und letztlich reicht schon das Bestreben aus, die eigene Auffassung in der Organisation in den dafür vorgesehenen Bahnen durchzusetzen.
Diese Voraussetzungen sind heute aber nicht mehr gegeben! Das hervorstechende Kennzeichen der Periode nach dem zweiten Weltkrieg ist — abgesehen von den weltpolitischen Ereignissen — die zunehmende materielle Sättigung. Das und die rapid um sich greifende Genußsucht schleifen nicht nur die politischen Gegensätze ab, was ja erfreulich wäre, sondern lähmen das politische Interesse überhaupt. Die technische Entwicklung, besonders der Fortschritt in der Reproduktion von Bild und Ton; der Zusammenbruch verbindlicher sittlicher und kultureller Gesellschältsfofrhen machen uns gegenüber cTen von ... ., , - - , f*. _ ,tüchtigen Unternehmerpersonlichkeiten in Fülle.hergestellten primitiven Reizen empfänglich. Dieses von vielen Zeitgenossen gierig verschlungene Lebenselixier hat zur Folge, daß für echte geistige Tätigkeit, für mühevolles rationales Denken — und jedes wahre Denken ist mühevoll — weder Platz noch Zeit bleibt. Damit können aber die dargelegten Voraussetzungen kaum mehr erfüllt werden, damit die Demokratie funktioniere.
Die Lektüre von Illustrierten und die Betrachtung von Heimatfilmen, ja auch die Kenntnis der Boulevardpresse reichen nicht aus, um das Mitglied einer Organisation überhaupt über Tatsachen zu informieren, deren Kenntnis für die kritische Würdigung der Führenden nötig ist. Das blinde, passive Hingegebensein an die Früchte der Veignügungsindustrie, die Scheu, überhaupt irgend etwas zu tun, was nicht unmittelbar dem Erwerb oder dem Vergnügen dient, schließt die Mitarbeit in der Organisation aus.
Kann nun der einzelne die Aufgaben und die Tätigkeit einer Gemeinschaft nicht mehr übersehen, wirkt er an ihren Taten nicht mit, dann fühlt er sich mehr und mehr als Fremder. Er sieht die Funktionäre selbstherrlich agieren und eine Politik betreiben, die ihm nicht behagt und die er nicht versteht. Dem setzt er nun nicht eigene Handlungen entgegen, sondern er läßt es dabei bewenden, sich beiseite geschoben zu fühlen. Ja darüber hinaus fühlt er die geringsten Verpflichtungen, die sich aus seiner Mitgliedschaft ergeben, als Belästigung und unzulässige Einschränkung der persönlichen Freiheit.
Fehlt den Funktionären die geistige Basis in der Masse, dann sind sie gezwungen, im Interesse der Desinteressierten unabhängig zu handeln. Das einzige kritische Echo, das ihnen allenfalls zu Ohren kommt, ist unqualifiziertes „Raunzen“, das von vornherein ausschließt, daß man es ernsthaft würdigt. Damit ergäbe sich zwangsläufig allmählich eine Situation, die einer neuen Art „aufgeklärtem Absolutismus“ gliche.
Natürlich begrüßen viele Funktionäre diesen Zustand und gebrauchen die ihnen gegebene Freiheit und Verantwortungslosigkeit mit Wonne. Es gibt eben in der Geschichte selten einen Prozeß, der einseitig verläuft, da nach einer gewissen Zeit immer Wechselwirkungen entstehen. Überdies wird der ursprünglich als Mangel empfundene Zustand durch Gewohnheit zur Institution. Heute ist es bekanntlich schon so, daß mitunter der beste Wille zur Mitarbeit an der geschlossenen Abwehrmauer von autonomen Funktionären zerbricht.
Eine entscheidende Funktion übte jedenfalls der Intellektuelle in jeder Aktion aus, die sich gesellschaftliche Reform zum Ziel setzt. Wenn er auch — wie schon erwähnt — in allen politischen Systemen kraft seiner geistigen Qualitäten eine bedeutende Rolle spielte, so nimmt er im Rahmen der Demokratie eine Schlüsselposition ein. Er kann noch die beiden individuellen Voraussetzungen der Demokratie erfüllen — daß es die deutschen Intellektuellen in außerpolitischen Fragen offenbar nicht können, ist doch eher atypisch — an ihm kann sich die Welle der Neoprimitivität brechen, ja er könnte sogar der Entwicklung eine andere Richtung geben.
Das ist nicht ganz mühelos, denn es erfordert, einen beträchtlichen Teil seines Lebens der res publica zu widmen, ja darüber hinaus auf seine Mitbürger, sei es auch nur durch sein Vorbild, pädagogisch zu wirken. Man muß sich dessen bewußt sein, daß kaum eine historische Epoche den Intellektuellen mit solcher Verantwortung beladen hat, wie die unsere.
Alle diese Gedanken müßten auch bei einer Reform des Schulwesens eine Rolle spielen. Gewiß kann man nicht aus allen Schülern Intellektuelle machen, aber man wird nicht umhin können, den Bürgern recht viele intellektuelle Züge durch die Erziehung einzuprägen. Denn — auch wenn dies manchen „volkhaften“ Politikern nicht paßt — wahre Demokratie ist ohne ein Mindestmaß an Intellektualität nicht denkbar I