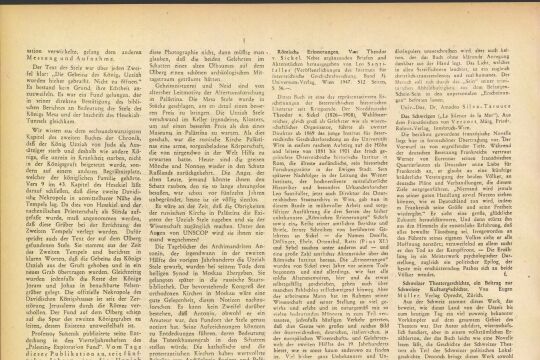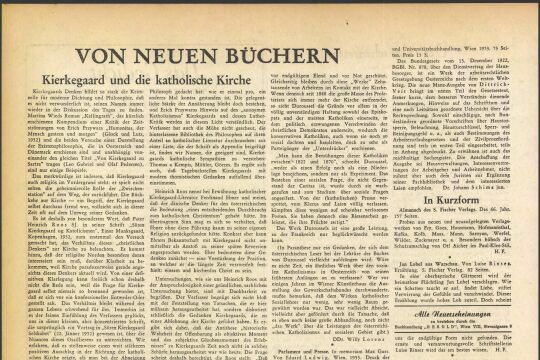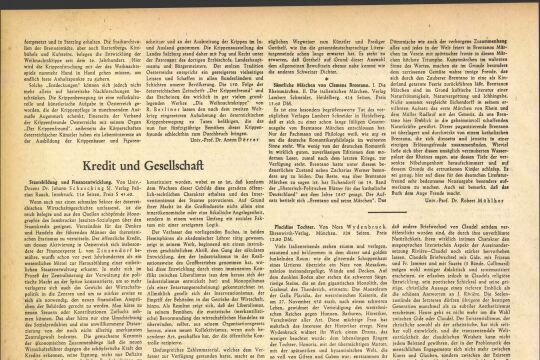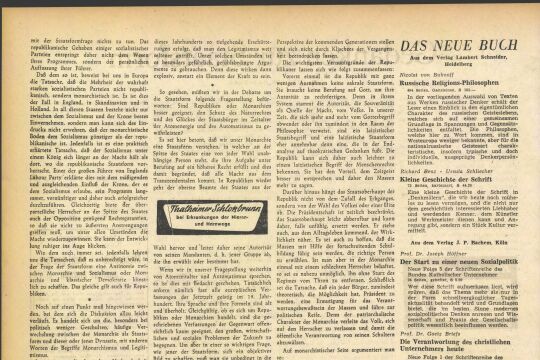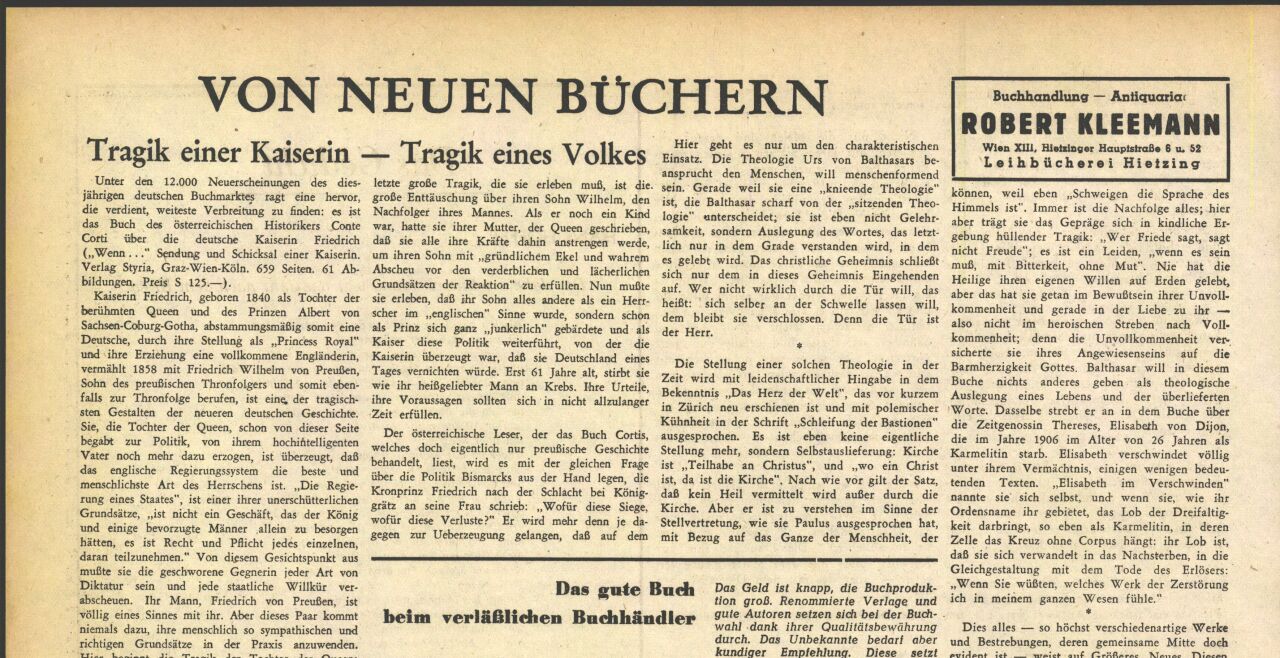
Dramen II. Von Hugo von Hofmannsthal. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. S. Fischer Verlag. 543 Seiten. Preis 21 DM.
Rückblickend auf das gesamte dramatische Werk Hofmannsthals kann man die in dem vorliegenden Band vereinigten Stücke aus den Jahren 1903 bis 1906 als Werke der Krise bezeichnen. „Elektra", vor allem in der Vertonung durch Richard Strauss bekanntgeworden, bedeutet weniger Erneuerung der Antike als vielmehr rhetorisch-artistische Wiederbelebung des Barocktheaters. „Das gerettete Venedig“, nach dem Stoff eines alten Trauerspiels von Thomas Otway, ist die letzte Tragödie Hofmannsthals im traditionellen Genre und in der Nachfolge Shakespeares und der Romantiker. Die beiden Oedipus-Stücke von 1905 und 1906 zeigen die ungeheure Anstrengung, ein Kunsttheater großen, feierlichen Stils zu etablieren, da sich die normale Sprechbühne zu verweigern schien. — Hofmannsthal hat diese Linie später nicht weiter verfolgt, auch nicht im „Turm", der zwar erst 1927 vollendet, aber schon 1902 begonnen wurde und auf Calderon zurückgeht. Diese Stücke waren bekannt und sind sowohl in (freilich längst vergriffenen) Einzelausgaben und im Rahmen der Editionen von 1926 und 1931 erschienen. Herbert Steiner teilt dazu einige nicht sehr wichtige Ergänzungen mit: zur „Elektra" drei Varianten des Operntextes, ferner Vorstudien und später gestrichene Stellen für die Oedipus-Tragödie. Dagegen werden fünf dramatische Entwürfe aus den Jahren 1900 bis 1904, die 1936 als Sonderdruck der Johannes-Presse erschienen waren, jetzt allgemein zugänglich: „Leda und der Schwan",
„Jupiter und Semele", „Die Söhne des Fortunatus“ und „Pentheus". Für die Einsicht in Hofmannsthals Arbeitsweise sind diese Skizzen sehr aufschlußreich. Am Anfang war bei Hofmannsthal eine fast wild wuchernde Fülle von Motiven und Gestalten, die erst im Laufe der Arbeit durch Reduktion, Zusammenziehung, Verkürzung und Konzentration zu Bühnenfiguren und „Handlungsträgern" werden. Also durchaus der entgegengesetzte Vorgang wie beim Schreiben eines Thesenstückes, wo die Marionetten an den Gedankenfäden baumeln oder hin- und hergezogen werden. Freilich war die Fülle der Gesichte bei Hofmannsthal oft so groß, daß vieles unvollendet blieb, wie wir wissen: nicht nur die hier mitgeteilten Entwürfe.
einzelmenschlichen Wohlfahrt, die der Kategorie „Lebensstandard“ weichen muß. Auf diese Art werden nun die Postulate der liberalen Erwerbswirtschaft ad absurdum geführt.
Der Prozeß der Enthumanisierung des betrieblichen und unternehmerischen Leistungsvollzuges findet sein Ende in den Konzentrationsformen etwa von Konzern und Holding, denen, gemäß ihrer Struktur, menschliche Bezüge durchweg fehlen müssen. Gleichzeitig aber fehlt jenen, die diese Gebilde geschaffen haben, die Einsicht in das Wesen der Wirtschaft, die doch eine Veranstaltung zur allgemeinen Versorgung darstellen soll. Insoweit ist der alte Liberalismus nicht nur unmenschlich, sondern ebenso unwirtschaftlich.
Da, wo der Liberalismus endet, setzt nun der Kollektivismus an. In jenem Ausmaß, in dem sich kollektivistische Denkweisen realisieren und zu ökonomischen Wirklichkeiten werden, in jenem Ausmaß, in dem aus Sehnsüchten und Ressentiments wie Zwangsvorstellungen kollektivistische Wirtschaftsweisen werden, zeigt sich, daß auch der Kollektivismus im Prinzip nicht mehr ist als eine Stufe im dauernden Bemühen von Führungsschichten, das individuelle Einkommen ihrer Angehörigen zu sichern oder zu steigern. Auch der Kollektivismus vermag nicht die dialektische Einheit von Gesellschaft und Einzelmensch zu verwirklichen. Die Form des Kollektivismus, zu wirtschaften, ist in der Art der Menschenführung und in der hierarchischen Gliederung des Betriebes von jener des Liberalismus alter Prägung höchstens durch das Gewicht der unternehmerischen Macht unterschieden. Oft sind sogar die Manager, derer sich der Kollektivismus bedient, die gleichen, die schon seinem Vorgänger ihre Dienste geliehen haben.
Konstituiert zeigt sich die kollektivistische Wirtschaftsweise als ein auf die Mehrung unternehmerischen Ertrages bedachtes Handeln. Die Eigentümereliten wurden durch Einkommenseliten abgelöst. Ihr Verzicht auf Eigentumstitel wird durch ein relativ hohes Einkommen reichlich belohnt, gar nicht zu reden von den Konsumprivilegien, die ihnen die Gelegenheit geben, in einer Art Demonstrationsluxus das Gewicht ihrer Machtposition auszuweisen. Es hat also auch der Kollektivismus die faktische Herrschaft des Menschen über den Menschen nicht aufzuheben vermocht; diese besteht in der Form der Herrschaft der Manager über die Nichtmanager weiter. War früher die Freiheit privatisiert, so wird sie jetzt rationiert.
Die liberale Wirtschaftsweise ist der Versuchung erlegen, individuelle Eigentumsmacht ohne Bindung an das gemeine Wohl zu nutzen. Eben derselben Versuchung hat nun auch der Kollektivismus nicht zu widerstehen vermocht, da, wo er praktiziert werden kann. Die einen sagen „Profit“, die anderen „Prinzip“. Die einen sagen „Reichtum“, was notwendig Nicht-Reichtum und Armut voraussetzt, die anderen sagen zwar „Wohlfahrt“, meinen aber Wohlfahrtsprivilegien. Gemeinwohl wird, wie ehedem, dem Privatwohl von
Führungsschichten gleichgesetzt, die eben Gesellschaft wie Staat repräsentieren.
Seit einem Jahrhundert sind die Besten unseres Kontinents bemüht, den Teufelskreis des bruchlosen Wechsels der nur verschieden etikettierten Formen der Profitwirtschaft zu durchbrechen und insbesondere zu einem neuen Begriff der Freiheit vorzustoßen.
In einem neuen Begreifen der Freiheit wird diese als eine Wirklichkeit gesehen, u. a. als eine Möglichkeit, allgemeine Wohlfahrt in ungleich größeren Maßen zu sichern als bisher. In der industriellen Gesellschaft, als der gegenwärtig repräsentativen Darstellungsform der Wirtschaftsgesellschaft, heißt das, Anknüpfen an die humane Situation des vorkapitalistischen Ein-Mann-Betrie- bes, an die nahtlose Verbindung von Kapital und Arbeit. Selbstverständlich unter Bedacht- nahme auf die modernen industriellen Erzeugungsweisen, die sozial indifferent sind und die Freiheit des Werktätigen keineswegs aufheben.
. Das bedeutet etwa Mitbestimmung, freilich nicht als übler Trick oder als patriarchalische Geste.
Das bedeutet Vergenossenschaf-, t u n g des Erzeugungsprozesses, wenn auch nur da, wo es sachlich zu rechtfertigen ist und die Position des Genossenschafters, gewahrt bleibt.
Das bedeutet — freilich vorsichtig dosiert — Miteigentum in den unterschiedlichsten Formen. Liberalismus und Kollektivismus sind Kinder der gleichen Mutter. Das zeigt sich drastisch in den Extremförmen der nur mehr formell privatwirtschaftlich geführten Großbetriebe und in den Unternehmungen des staatskapitalistischen Sektors, ln dem Zwischenreich, in dem wir leben, befinden sich beide in der Position von D y o p o 1 i- sten; sie sind gleichstarke Wettbewerber. In der Arena der politischen Auseinandersetzungen sind die Farben der beiden Spielpartner grell verschieden. Der Zuschauer wegen. In der Wirklichkeit des Alltags aber tragen sie die gleiche Farbe und die Zeichen ihrer Blutsverwandtschaft.
Macht ist auf Dauer nicht teilbar. Jeder der beiden Dyopolisten sinnt daher auf Liquidation des unbequemen Partners. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung läßt uns aber, nicht hoffen und ist ohne positiven sozialen Nutzen. Wer immer Sieger sein wird, die soziale und ökonomische Despotie wird bleiben. Wehn wir dies erkennen,, ist es unsere Pflicht, alle Bemühungen um, die Durchsetzung eines neuen Humanismus, besser einer neuen gesellschaftlichen Humanität, zu begrüßen. Freilich wünschen wir uns dabei nicht einen Humanismus, der in vollendeter Objektivferne lediglich bemüht ist, antike Denkweisen zu kanonisieren und in einem akademischen Intellektualismus und in einem von kalter Liebe getragenen Pathos erstarrt ist. Wir sollen aber auch den Mut haben, alles, was geeignet erscheint, den gesellschaftlichen Atavismus zu überwinden, zu begrüßen. Es sei als Personalismus, als So- lidarismus, als freiheitlicher Sozialismus oder als sozialer Liberalismus vorgestellt. Die gesellschaftliche Unordnung ist ein Komplex, den man nicht durch eine Methode liquidieren kann. Das anzunehmen wäre Vermessenheit und sektiererische Unduldsamkeit.
Es ist daher geboten, über die Zäune eigener vorgefaßter Meinungen hinweg, alles zu fördern, jede Institution und jede Idee, was darauf gerichtet ist, den Menschen in die seiner Natur gemäße Position einzusetzen. Das bedeutet in der „sozialen Frage“: alle Bemühungen fördern, die auf die Sicherung der Position des einzelnen und nicht eines Abstraktums „Mensch“ gerichtet sind. Das heißt, bemüht sein, nicht die „Arbeiterschaft“ befreien, sondern den Arbeiter, nicht die „Menschheit“, sondern den Menschen. Dabei muß der Freiheit der Charakter eines auch ökonomischen Gutes zugemessen werden. Wir dürfen sie nicht allein als subjektive Entschlossenheit verstehen, objektiven Gesetzlichkeiten zu folgen, sondern als eine Gelegenheit, spontan aus dem Gewissen heraus zu handeln.
Wir sollen es aber nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß ein Bekenntnis zur Freiheit, als einer auch gesellschaftlichen Wirklichkeit, nicht in der Form von Utopismus und Romantizismus abgelegt werden kann. Beide führen, wenn sie sich als Institutionen festzusetzen vermögen, wieder zu einer Despotie sui generis. Die heroischen Versuche, den gesellschaftlichen und innerhalb desselben den ökonomischen Prozeß zu vermenschlichen, werden in einer Weise bekämpft, der man Fairneß kaum nachsagen kann. Dabei bilden sich grotesk scheinende Interessengemeinschaften heraus, die nur verständlich sind, wenn man den Stammbaum der Partner kennt. Wie immer aber der Widerspruch gegen uie Versuche einer Neuqrdnung sein mag, die Zeit arbeitet tür den neuen Humanismus, die Wirklichkeit schreitet auf ihn zu.
Die Erste Wiener Sozia le Woche, deren Referaten der oben wiedergegebene Vortrag entnommen ist, wurde vom Institut für Sozialpolitik und Sozialreform in der Zeit vom 19. bis 21. November veranstaltet. Das Forum bestand aus geladenen Gästen, aus Sozialwissenschaftlern, Sozialpraktikern, Politikern, Journalisten und aus Führern der katholischen Jugend.
Den ersten Vortragsabend, dem unter anderen Präsident Dr. H u r d e s und Bundesminister Dr. D r i m m e 1 beiwohnten, eröffnete der Vertreter der westdeutschen katholischen Sozialen Wochen, Univ.-Prof. Dr. G. Fischer (München), der den Versuch, auch in Wien die Institution Sozialer Wochen zu schaffen, begrüßte. Sodann sprach Univ.-Prof. Dr. A. M. K n o 11, der einen umfassenden und instruktiven Ueber- blick über die bisher vom Institut geleistete Arbeit gab. Hierauf hielt Dr. Burghardt den oben wiedergegebenen Festvortrag, an den sich eine kurze, aber inhalts- und kontroversreiche Diskussion anschloß, die wahrscheinlich noch ihre Fortsetzung finden wird. Der zweite Tag war den Fachreferaten Vorbehalten. Einleitend sprach Direktor Dr. Wittmann (Graschnitz) über die
Probleme des Dorfes und gab in einer ergreifenden Darstellung einen erschütternden Einblick in den Prozeß der Liquidation des alten Dorfes. Im zweiten Vortrag beschäftigte sich Dr. F. Hohen- s i n n mit Fragen der amerikanischen Lohnpolitik. Den Abschluß bildete ein Vortrag des Sozialreferenten der Kübel-Werke in Worms, Doktor Sah m. Der Vortragende legte an Hand der Verhältnisse, wie sie in seinem Betrieb herrschen, den Beweis vor, daß die Vermenschlichung des Betriebes durchaus möglich und keineswegs eine Sache bloßer theoretischer Diskussion ist. Der letzte Tag sah zuerst Prof. Dr. D u v e r n e 11 von der Sozialakademie in Dortmund am Vortragspult. Der Redner, einer der führenden Sozialpädagogen Westdeutschlands, gab einen reich- belegten Abriß der Versuche in Westdeutschland, über die Aenderung der Betriebsverfassung strukturelle sozialökonomische Wandlungen mitherbei- führen zu helfen. Als letzter Vortragender sprach Nationalrat Köck — in seiner Eigenschaft als Arbeiterführer und als Politiker — über den neuen Arbeitertyp und seine Organisationen.
An den beiden letzten Tagen schlossen sich den Referaten umfangreiche Diskussionen an, die, wie Univ.-Prof. Dr. Knoll in seinem Schlußwort feststellte, derart waren, daß man von einer Renaissance der christlich-sozialen Diskussion sprechen konnte, die seit 1945 so gut wie abgebrochen worden war.