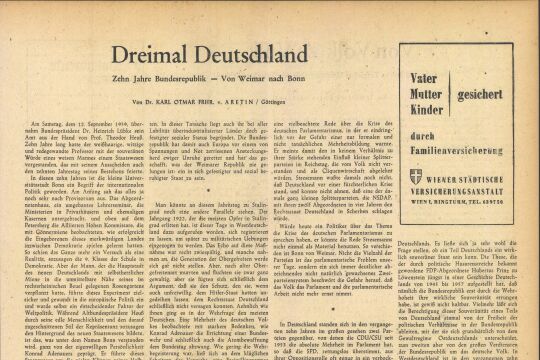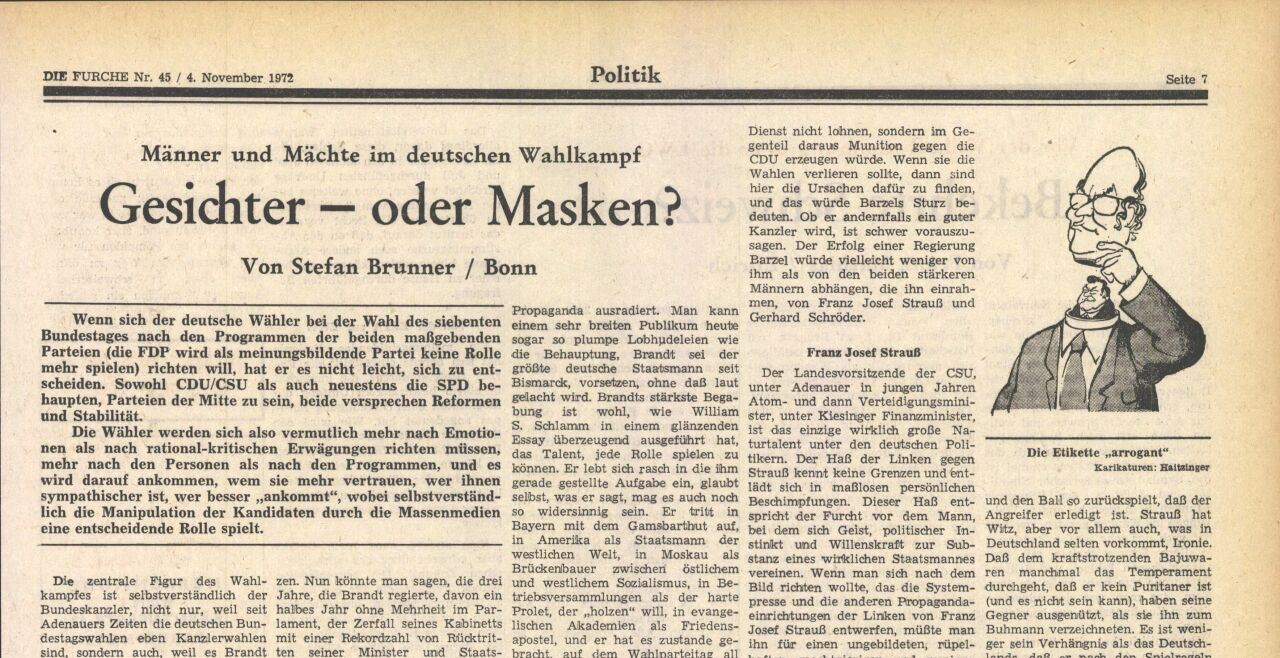
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gesichter — oder Masken?
Wenn sich der deutsche Wähler bei der Wahl des siebenten Bundestages nach den Programmen der beiden maßgebenden Parteien (die FDP wird als meinungsbildende Partei keine Rolle mehr spielen) richten will, hat er es nicht leicht, sich zu entscheiden. Sowohl CDU/CSU als auch neuestens die SPD behaupten, Parteien der Mitte zu sein, beide versprechen Reformen und Stabilität. Die Wähler werden sich also vermutlich mehr nach Emotionen als nach rational-kritischen Erwägungen richten müssen, mehr nach den Personen als nach den Programmen, und es wird darauf ankommen, wem sie mehr vertrauen, wer ihnen sympathischer ist, wer besser „ankommt“, wobei selbstverständlich die Manipulation der Kandidaten durch die Massenmedien eine entscheidende Rolle spielt.
Wenn sich der deutsche Wähler bei der Wahl des siebenten Bundestages nach den Programmen der beiden maßgebenden Parteien (die FDP wird als meinungsbildende Partei keine Rolle mehr spielen) richten will, hat er es nicht leicht, sich zu entscheiden. Sowohl CDU/CSU als auch neuestens die SPD behaupten, Parteien der Mitte zu sein, beide versprechen Reformen und Stabilität. Die Wähler werden sich also vermutlich mehr nach Emotionen als nach rational-kritischen Erwägungen richten müssen, mehr nach den Personen als nach den Programmen, und es wird darauf ankommen, wem sie mehr vertrauen, wer ihnen sympathischer ist, wer besser „ankommt“, wobei selbstverständlich die Manipulation der Kandidaten durch die Massenmedien eine entscheidende Rolle spielt.
Die zentrale Figur des Wahlkampfes ist selbstverständlich der Bundeskanzler, nicht nur, weil seit Adenauers Zeiten die deutschen Bundestagswahlen eben Kanzlerwahlen sind, sondern auch, weil es Brandt und der raffinierten Propaganda der Linken gelungen ist, um den Führer der SPD einen Nimbus zu spinnen, der stärker sein könnte, als die zahlreichen Argumente, mit denen die Opposition gegen Brandts Regierungsstil und Leistungen zu Felde zieht. Brandt hatte schon als Regierender Bürgermeister von Berlin eine starke Ausstrahlung, und die Union hat damals noch mitgeholfen, den ehemaligen norwegischen Major und Partisanenberater aufzubauen, da er als Repräsentant des rechten Flügels der SPD galt. Die Wahlparole der CDU von 1969: „Herr Brandt kann Deutschland nicht regieren“, kam dann nicht an. Sie wirkte provozierend und hat wohl auch dazu beigetragen, Brandt zu der Bildung einer Justamentkoali-tion gegen die stärkste Partei zu reizen. Nun könnte man sagen, die drei Jahre, die Brandt regierte, davon ein halbes Jahr ohne Mehrheit im Parlament, der Zerfall seines Kabinetts mit einer Rekordzahl von Rücktritten seiner Minister und Staatssekretäre, der Inflationsprozeß und die schwächliche Außenpolitik hätten der damaligen Parole doch noch recht gegeben. Das wird aber kaum durchschlagen, wenn es der Union nicht gelingt, den Mythos vom „Friedenskanzler“ zu zerstören, als der Brandt sich vorstellt und als der er von den Propagandisten der Linken gemanagt wird.
Anfangs hat man Brandt nicht ganz ernst genommen. Man sagte ihm allzu große Liebe zu starken Getränken nach („Willy Brandy“, „Kognak-Willy'“), glossierte seinen rhetorischen Stil, sprach viel von seiner Vergangenheit als Volksfrontpolitiker, Trotzkist, Parteigänger des rotspanischen Regimes und Autor antideutscher Propagandaschriften in der norwegischen Emigration. Das alles aber wurde von der linken
Propaganda ausradiert. Man kann einem sehr breiten Publikum heute sogar so plumpe Lobhudeleien wie die Behauptung, Brandt sei der größte deutsche Staatsmann seit Bismarck, vorsetzen, ohne daß laut gelacht wird. Brandts stärkste Begabung ist wohl, wie William S. Schlamm in einem glänzenden Essay überzeugend ausgeführt hat, das Talent, jede Rolle spielen zu können. Er lebt sich rasch in die ihm gerade gestellte Aufgabe ein, glaubt selbst, was er sagt, mag es auch noch so widersinnig sein. Er tritt in Bayern mit dem Gamsbarthut auf, in Amerika als Staatsmann der westlichen Welt, in Moskau als Brückenbauer zwischen östlichem und westlichem Sozialismus, in Betriebsversammlungen als der harte Prolet, der „holzen“ will, in evangelischen Akademien als Friedensapostel, und er hat es zustande gebracht, auf dem Wahlparteitag all das als sein Programm zu verkünden, was er drei Jahre lang verdammt hat: den Bankrott seiner Regierung stellt er als Ergebnis einer Hexenjagd dar, mit einer Träne in der verkratzten Stimme spielt er den Märtyrer.
Neben dem mythifizierten Brandt hat der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Rainer Barzel, keinen leichten Stand. Barzel war nur einmal für kurze Zeit Bundesminister gewesen und hatte keine Gelegenheit, sich besonders auszuzeichnen. Als er gegen erhebliche Widerstände in der eigenen Partei Vorsitzender und Kanzlerkandidat geworden war, begannen die linkskonformen Massenmedien sein Image herabzudrük-ken. Sie hängten ihm die Etikette „arrogant“ an, was sich rasch herumsprach, obwohl es nichts als eine Erfindung ist. Die Eloquenz Barzels, seine noble Sachlichkeit, von der er auch in hitzigen Debatten nicht abweicht, seine Bildung und seine bezwingende Logik gelten seither vielen Wählern als Beweise für eben jene „Arroganz“, die wohl nur darin besteht, daß er gescheiter ist als die meisten seiner Gegner und nie auf das Niveau herabsteigt, auf dem sich einzelne Sprecher der Linken bewegen. Was man Barzel wirklich vorwerfen kann, sind ein nicht imbedenklicher Mangel an Stehvermögen und ein nur schwach entwickelter politischer Instinkt. Beides erwies sich am 17. Mai, als er seine Fraktion — die ihm bis auf etwa 30 Unentwegte folgte — zur Stimmenthaltung bei der Abstimmung über die Ostverträge bewog. Was immer ihn dabei leitete, er hat jedenfalls nicht vorausgesehen, daß ihm die SPD diesen
Dienst nicht lohnen, sondern im Gegenteil daraus Munition gegen die CDU erzeugen würde. Wenn sie die Wahlen verlieren sollte, dann sind hier die Ursachen dafür zu finden, und das würde Barzels Sturz bedeuten. Ob er andernfalls ein guter Kanzler wird, ist schwer vorauszusagen. Der Erfolg einer Regierung Barzel würde vielleicht weniger von ihm als von den beiden stärkeren Männern abhängen, die ihn einrahmen, von Franz Josef Strauß und Gerhard Schröder.
Der Landesvorsitzende der CSU, unter Adenauer in jungen Jahren Atom- und dann Verteidigungsminister, unter Kiesiniger Finanzrninister, ist das einzige wirklich große Naturtalent unter den deutschen Politikern. Der Haß der Linken gegen Strauß kennt keine Grenzen und entlädt sich in maßlosen persönlichen Beschimpfungen. Dieser Haß entspricht der Furcht vor dem Mann, bei dem sich Geist, politischer Instinkt und Willenskraft zur Substanz eines wirklichen Staatsmannes vereinen. Wenn man sich nach dem Bild richten wollte, das die Systempresse und die anderen Propagandaeinrichtungen der Linken von Franz Josef Strauß entwerfen, müßte man ihn für einen ungebildeten, rüpelhaften, machtgierigen und gewinnsüchtigen, für einen skrupellosen und gemeingefährlichen politischen Abenteurer halten. Nichts davon stimmt. Strauß — von Haus aus klassischer Philologe, aber schon in jungen Jahren als Dandrat (Bezirkshauptmann) zur Politik abgeschwenkt — ist ein ungewöhnlich gebildeter Mann, einer der wenigen deutschen Politiker, mit denen man über Geschichte reden kann, sprachenkundig, ein geschickter Taktiker, zielbewußt und weitblickend. Er ist ein glänzender Redner, der ebenso ein Forum von Fachleuten wie eine Volksversammlung zwei Stunden lang in Spannung halten kann, der jeden - Zwischenruf sofort auffängt und den Ball so zurückspielt, daß der Angreifer erledigt ist. Strauß hat Witz, aber vor allem auch, was in Deutschland selten vorkommt, Ironie. Daß dem kraftstrotzenden Bajuwaren manchmal das Temperament durchgeht, daß er kein Puritaner ist (und es nicht sein kann), haben seine Gegner ausgenützt, als sie ihn zum Buhmann verzeichneten. Es ist weniger sein Verhängnis als das Deutschlands, daß er nach den Spielregeln des Bonner Parlamentarismus nicht Kanzler werden kann.
Der unmitteUbare Gegenspieler von Strauß in den letzten Debatten des alten Bundestages und im Wahlkampf ist der Superminister Helmut Schmidt, dem Brandt nach Schillers Rücktritt die wichtigen Ressorts Finanzen und Wirtschaft anvertraut hat. Ehemaliger Oberleutnant der Panzerwaffe, ist Schmidt der Typus des Karrieristen, ehrgeizig, brutal, wendig und wandlungsfähig, in keiner Weise ideologisch gebunden, energisch ein einziges Ziel ansteuernd: deutscher Bundeskanzler zu werden. Sein eigentlicher Feind ist Brandt, dem er vorläufig den Steigbügel halten muß, dessen Sturz ihm aber erst den Weg ins Palais Schaumburg öffnen kann. Die Schwierigkeit für Schmidt liegt darin, daß er nicht zum Zuge kommt, wenn Brandt diesmal siegt, und daß es 1976 zu spät für ihn sein könnte. Daher laviert er zwischen dem Kurs der „linken Mitte“, den Brandt zu steuern vorgibt, und den radikalen Jusos, die in vier Jahren die Partei in der Hand haben werden. In seinen Anfängen machte sich Schmidt einen Namen als schnoddriger Redner und Zwischenrufer. Man kannte ihn in ganz Deutschland nur als „Schmidt-Schnauze“. Später verzichtete er auf den Kasernenfoofton und gab sich staatsmännisch. Denkt man sich ihn als Nachfolger Brandts, dann erinnert man sich an das Wort des Staatssekretärs Kiderlen-Wächter, der einst einem fremden Diplomaten auf der Hofjagd sagte: „Erschießen Se den Kaiser nit, der nach ihm kommt, is no schlimmer.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!