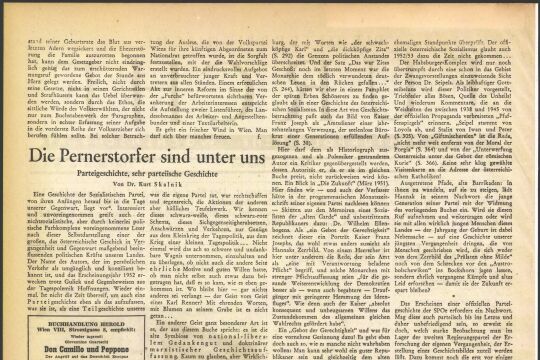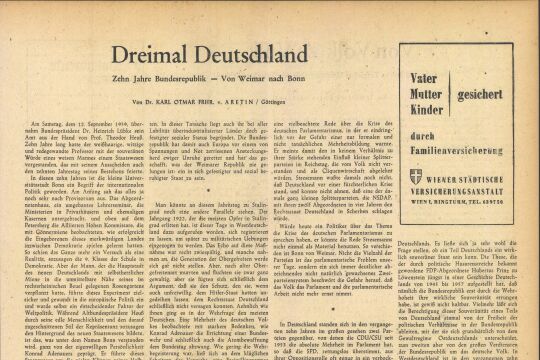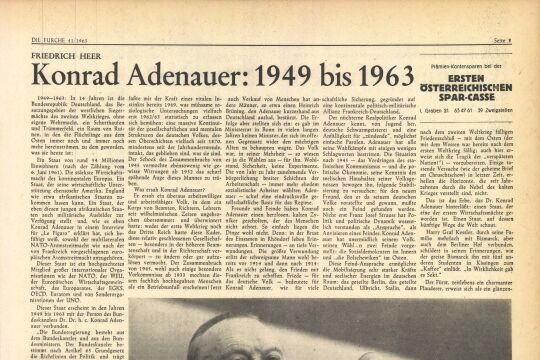Das „Kronprinzenproblem“ ist seit langem eine der meistbesprochenen politischen Fragen in der Bundesrepublik Deutschland, eine der wenigen, die ein breiteres Publikum wirklich interessieren. Es ist zugleich eine der ernsten Sorgen der CDU — vielleicht ihre schwerste. Je näher die Bundestagswahlen kommen, von denen uns freilich noch gute 13 Monate trennen, desto wichtiger wird die • Kronprinzenfrage, aber desto schwieriger wird es auch, für sie noch eine befriedigende Lösung zu finden. Vielleicht aber ist es dazu für die CDU auch schon zu spät, weil nämlich — und hier beginnt die Sache grotesk und mysteriös zu werden — inzwischen die SPD die Antwort erteilt hat. Ob Adenauers Nachfolger Willy Brandt heißen wird, das mag noch immer strittig sein, aber daß „Adenauers Kronprinz“ in den Augen zahlloser deutscher Wähler eben dieser Willy Brandt ist, das ist eine der bemerkenswertesten Tatsachen der deutschen Politik. Und da die Begründung dafür nicht so sehr in politischen Vorgängen als in psychologischen Momenten liegt, die für die Massendemokratie bezeichnend sind, handelt es sich auch gar nicht um ein ausschließlich deutsches, sondern um ein allgemeines Problem, das den Staatsmännern und Managern demokratischer wie autoritärer und' halbautoritärer Staaten gleichermaßen zu denken geben sollte.
Die deutsche Demokratie der letzten zehn Jahre ist ein patriarchalisches Regime und nicht — wie manche Kritiker überhitzt behaupten — eine Einmanndemokratie, Diktatur und Alleinherrschaft Adenauers. Die Opposition ist nie unterdrückt worden, sie hatte volle Redefreiheit und machte von ihr den ausgiebigsten Gebrauch, sie ist sogar im Besitz der wichtigsten Schlüsselstellungen der öffentlichen Meinungsbildung, und auch in der CDU/CSU hat Adenauer keineswegs immer seinen Willen durchgesetzt. Er hat oft komplizierte Manöver ausführen müssen, um ans Ziel zu kommen; da er ein erfahrener und geschickter Steuermann ist, merkt man es nur nicht ohne weiteres, wenn er manövriert. Das Geheimnis seiner Macht und seiner zwei großen Wahlsiege (195 3 und 1957) liegt auch nicht nur in seinen unbestreitbaren Erfolgen, sondern im Wesen seiner Persönlichkeit. Man hat vom Vaterkomplex der Deutschen gesprochen, worunter man keineswegs, wie die Freudianer, einen unterbewußten Haß gegen den Vater, sondern die Sehnsucht nach väterlicher Führung, väterlicher Fürsorge, väterlicher Güte und väterlicher Strenge meint. Er mag vom Begriff des Landesvaters herkommen, von der Monarchie, die den Deutschen 1918 plötzlich genommen wurde, ohne daß es eine von den Vorteilen der Republik überzeugte Mehrheit gegeben hätte. Es war Eberts Verhängnis, daß er über die vielen Hürden, die Freund und Feind in seine Bahn stellten, nicht dazukam, in die Rolle des Landesvaters einzuspringen. Er hatte das Format dazu, aber die Masse der Kleinbürger empfand den Sattlergesellen als einen Stiefvater, dessen man sich schämen müsse, und der Fehltritt Mutter Germanias war ihnen überhaupt nur als eine Frücht “des „Verrates“ verständlich. Um so williger nahmen diese Schichten Hindenburg als Landesvater in die Reihe der legitimen Staatsoberhäupter auf. Wenn man will, kann man diesen Komplex bis auf mythische Ursprünge zurückverfolgen: auf den getreuen Ekkehard und auf Wotan. Dieser Archetypus war zu allen Zeiten viel gefragt. Das Väterliche nun fehlte den führenden Leuten des Hitler-Reiches ganz und gar. Weder der Großtyrann selbst noch einer seiner Kumpane hatte auch nur die geringste Spur von Väterlichkeit. Vielleicht hat aber auch eben darum die konservative wie die liberaldemokratische Opposition kein rechtes Gegenbild entwickeln können. Weder Wilhelm IL und der letzte preußische Kronprinz noch die an sich blassen Idole der Republik von Weimar boten Ansatzpunkte für die Entstehung eines patriarchalischen Gegenbildes zu Hitler. Bezeichnend, daß der Volkswitz gern auf den „alten“ Kaiser Wilhelm I. zurückgriff und daß am ehesten das Bismarck-Bild Zugkraft erlangte. Als Hitler und Goebbels das merkten, stellten sie vorübergehend den alten Fritz zurück und lenkten die Tradition wie die Propaganda auf Bismarck als Vorläufer des Führers hin. Aber sie hatten Pech. Die „Bismarck“ versank im Atlantik.
1957 entdeckten oppositionelle Publizisten, Adenauer sei kein Vater, sondern ein Großvatertyp. Sie wollten ihn damit lächerlich machen und den Vaterkomplex der Wähler aushöhlen. Das mißlang völlig. Vater oder Großvater, das spielt keine Rolle, und wenn es einen Unterschied ausmacht, dann nur in dem Sinne, daß dem Bilde des Großvaters ein Zauber anhaftet, den das Vaterbild nicht immer hat. In einer Zeit, die durch das „Haus ohne Väter“, durch den furchtbaren Aderlaß des Krieges und durch eine Überzahl verwaister Kinder gekennzeichnet ist, war ohnehin der Großvater weithin ah die Stelle des Vaters getreten. Der trotz der Last seiner Jahre noch für Töchter, Schwiegertöchter und Enkel sorgende, sie oft auch versorgende Großvater, einzige Brücke in eine Vergangenheit, in der noch Sicherheit war, einziger Zeuge und Bürge dafür, daß man überhaupt in einer Ahnenreihe steht, einen legitimen Namen trägt und gewisse Rechtsansprüche geltend machen kann, erhält mythischen Glanz. In dieses Bild trat Adenauers Person ein. Hatte er nicht schon vor langen Zeiten einem Gemeinwesen vorgestanden? War er nicht ein Würdenträger der Republik von Weimar gewesen? Aber trotzdem eben kein damals schon verbrauchter Politiker, kein gescheiterter Parteimann, kein Mitschuldiger aus der bankrotten Vätergeneration und kein Mitläufer Hitlers. Mit sicherer Hand führt er den Staat, schweigsam, autoritär, aber zuverlässig und gut. Die Nation kann sich ohne Sorgen den Freuden des Wirtschaftswunders überlassen. Der „Alte“ macht es schon richtig. Er wird die Macht nicht mißbrauchen, er wird keine Experimente machen und keine zulassen, er wird nicht für irgendwelche nationalen Wunschträume den sicheren Boden aufgeben, auf den er uns 1948/49 gerettet hat. Natürlich meutert man manchmal gegen ihn. Man schimpft, kräftig sogar, macht sich ein bisserl lustig über den alten Herrn; man erzählt Witze und Anekdoten, in denen er aber, auch wenn sie# von Haus aus giftig gemeint waren, am Ende doch immer als ein sehr sympathischer, überlegener, menschlich nachsichtiger Herr erscheint.
Zum patriarchalischen Regenten aber gehört der Kronprinz. Das Kaiserbild bedarf aus tiefenpsychologischen Gründen der Ergänzung durch das Bild des legitimen Erben. Wo bliebe die Sicherheit, wenn man nicht wüßte, wer nachkommt? Man bescheidet sich nicht mit dem Trost, es sei durch Institutionen dafür gesorgt, daß alles glatt abläuft. Nicht was nachher sein wird, interessiert in erster Linie, sondern wer nachher kommen soll. Je mehr sich das deutsche Volk in den patriarchalisch-demokratischen Stil einlebte, desto lauter rief es nach der Nominierung des Kronprinzen. Es ist die Tragik Adenauers, daß er diesen Ruf mißverstand, daß er gereizt und verärgert auf jede Anregung und Frage reagiert, daß er von dem Kronprinzen nichts wissen und den Mann nicht vor sich sehen will, der einst nach ihm regieren wird. Auch das hat Parallelen und Vorbilder in der Geschichte der Monarchien. Hier entspringen ia die klassischen Kronprinzentragödien. Und sieht der gekrönte Herrscher schon den Sohn, der einst die Krone tragen soll, nicht ohne schmerzliche Gefühle in die Rolle hineinwachsen, so hegt er vollends gegen den Thronfolger, der nicht sein leiblicher Nachkomme ist, Mißtrauen und andere zwiespältige Gefühle — man denke an Franz Joseph und Franz F iinand.
Unmittelbar nach der Wahl von 1957 tauchte in der adenauerfreundlichen Presse die Anregung auf, er solle in der Halbzeit, 1959, die Gelegenheit benützen, rühmlich, nämlich „nach oben“, abzugehen, sich zum Bundespräsidenten wählen zu lassen, diesem Amt neuen Glanz und eine stärkere Stellung zu verleihen, zugleich eine Hand am Steuer zu behalten und selbst noch seinen Nachfolger auszuwählen und zu installieren. Als es soweit war, wollte er davon nichts wissen, fügte sich dann widerstrebend doch in das scheinbar Notwendige, das jedenfalls von der übergroßen Mehrheit der Nation Gewollte, und entzog sich mit einem Salto mortale im letzten Augenblick wieder der Aufgabe, die der Logik des patriarchalischen Regimes entsprochen hätte. Er fand sofort viele Lobredner, die seinen Entschluß als übereilt, den neuen als weise bezeichneten. Und fast alle, die wütend waren und sich verschworen, sie würden ihm ins Gesicht sagen, daß er eine Dummheit gemacht habe, klatschten Beifall, als er mit einigen Witzen über die Schicksalsfrage hinwegging. Auch als er vor wenigen Monaten auf dem Parteitag zu Karlsruhe die Kronprinzenfrage damit abtat, es seien genügend viele Anwärter da und es sei undemokratisch, jetzt schon einen zu nominieren, schluckte des autoritären Großvaters allergetreueste Opposition Widerspruch und Bedenken wortlos hinunter. Damals hätte man dem Kanzler bereits sagen können.
daß sich die Partei vielleicht um die Nominierung des Nachfolgers prellen lasse, nicht aber die Nation. Aus taktischen Gründen, aus Erwägungen sehr ernster Art, die ihm die Außenpolitik diktierte, aus Sorge um Berlin und in dem Bestreben, die demokratische Welt durch ein Aufgebot von Sprechern des ganzen Volkes für die Sache Deutschlands mobil zu machen, hat Adenauer den Regierenden Bürgermeister von Berlin, den Sozialdemokraten Willy Brandt, seit dem Herbst 1958 immer wieder „herausgestellt“. Brandt war als Wortführer des rechten Flügels der SPD jahrelang der einzige einflußreiche Sozialdemokrat, der Adenauers
außenpolitisches Konzept in großen Umrissen bejahte. Adenauer hatte gute Gründe, Brandt gegen Wehner und Ollenhauer auszuspielen. Er sah aber nicht voraus, daß er damit auf den leeren Sockel des Kronprinzen das Bild Brandts stellte, der nicht nur dem Alter nach, sondern auch als Typus durchaus dem entspricht, was sich die Wirtschaftswunderkinder von einem Kronprinzen Adenauers erwarten. Im gewissen Sinn gehört Brandt in die Kategorie von neuen Männern mittleren Alters, die von Dänemark bis Amerika, von Frankreich bis Österreich heute im Kommen ist und mit der die SPD bei Kommunalwahlen seit einem Jahr geradezu großartige Erfolge erzielt. Das sind keine bloßen Vermutungen. Man stößt heute in der Bundesrepublik im Gespräch mit Wählern jeden Alters, sofern man eben Durchschnittswähler anredet und den bewußten zehnten oder elften Mann, der nicht emotional, sondern rational entscheidet, übergeht, immer wieder auf die Ansicht, Brandt sei eben der Kronprinz — nicht etwa der SPD, sondern Adenauers —, er sei „d e r Nachfolger“, und es sei richtig und beruhigend, daß der alte Herr endlich den kommenden Mann nominiert habe, damit wir ruhig schlafen können. Es ist ein Vorgang, der sich im Unterbewußtsein abspielt, der aber Geschichte machen kann. Bis zur Entscheidung wird noch einiges Wasser den Rhein hinabfließen, den Rhein und auch die Spree...
Ob die CDU von sich aus einen Kronprinzen überhaupt noch nominieren kann, ob sie ihn noch „managen“ könnte und ob er bei den Wählern noch ankommt, ist eine offene Frage. Es spricht viel dafür, daß sie es teuer bezahlen wird, in der Politik, ihren Grundsätzen entgegen, die kinderlose patriarchalische Familie zum Leitbild erhoben zu haben.