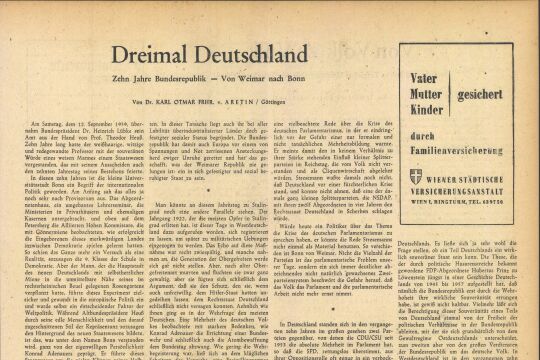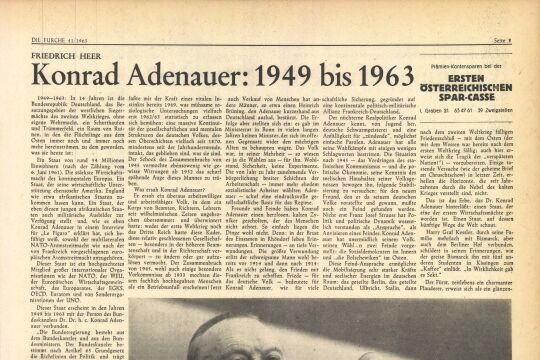Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Endlich eine konstruktive SPD?
Es ist etwas mehr ab ein Jahr her, daß wir an dieser Stelle anläßlich der Bundespräsidentenwahl die schicksalschwere Frage stellten, ob in Deutschland unter Adenauer eine Entwicklung möglich ist, die zu einer echten Vertiefung und Verankerung der Demokratie beiträgt. Es ist nicht so. sehr der Jahrestag, der uns noch einmal diese Frage vor Augen führt, als vielmehr zwei Ereignisse der letzten Wochen: die Bundestagsdebatte um die deutsche Außenpolitik und das Ende der Deutschen Partei, womit das Kabinett Adenauer endgültig ein Kabinett der CDU/CSU geworden ist.
Der Bonner Korrespondent der Schweizer Zeitung „Die Tat“ meinte über die deutsche Reaktion nach dem Scheitern der Pariser Gipfelkonferenz: „Es ist, als ob dies alles in diesen Tagen ganz • fern wäre und die Deutschen höchstens am Rande beträfe.“ Diese zweifellos richtige Beobachtung übersieht die Tatsache, daß die Gipfelkonferenz, so paradox es klingen mag, für Deutschland und für Adenauer gar nicht günstiger ausgehen konnte, als es geschehen ist. Die Angst vor einer wodka- beziehungsweise whiskyseligen amerikanisch-russischen Verbrüderung trieb noch im April den greisen Kanzler bis nach Japan. Davon ist nach Paris keine Rede mehr. Der schon in die Rolle des ewigen Friedensstörers abgedrängte deutsche Bundeskanzler war glänzend rehabilitiert, die Eisenhowersche Politik des freundlichen Grinsens ad absurdum geführt.
Da in Deutschland seit Bismarcks Zeiten die Innenpolitik nur ein Anhängsel der Außenpolitik ist, schien dieses Ergebnis für die Regierungspartei, die sich langsam für den Wahlkampf 1961 rüstet, nur angenehme Aspekte zu besitzen. Da verdarb ihr eine radikale Schwenkung der sozialdemokratischen Opposition weitgehend das Konzept.
Bisher als eingeschworene Gegner der deutschen Aufrüstung auf eine friedliche Koexistenz mit dem Osten festgelegt, benutzten die Sozialdemokraten die Gelegenheit des Pariser Debakels, um sich der vom Kanzler vertretenen Außenpolitik zu nähern. Man konnte nicht gut den künftigen Kanzlerkandidaten und Berliner Bürgermeister Willy Brandt zum Symbol erheben und gleichzeitig einer friedlichen Koexistenz das Wort reden, wenn gerade diese Stadt sozusagen zum Monte Pasubio des kalten Krieges wird. Die erste Reaktion der Regierungspartei war die eines Bären, dem sich ein besonders lästiger Zeck ins Fell gesetzt hat. Die zugkräftige Parole von der gemeinsamen Außenpolitik in gefahrvoller Zeit wurde mit einer Reihe von Fragen beantwortet, die man so formulierte, daß leicht erregbare Sozialisten darob in die Luft gehen mußten. Aber das Feuerwerk blieb aus. Hatten sich die Sozialdemokraten bisher noch jedesmal vom Kanzler in die Falle, das heißt in den zwar begreiflichen, aber politisch nicht verwertbaren Zorn verleiten lassen, so behielten sie diesmal die Nerven und reagierten nicht einmal auf das in Notzeiten vom Kanzler so beliebte rote Tuch seiner Behauptung, die Sozialdemokraten seien der Untergang Deutschlands. Dafür hielt der als Kommunist und linker Außenseiter verschriene Herbert Wehner in der Bundestagsdebatte vom 30. Juni eine Rede, die der CDU/CSU jede Möglichkeit nahm, sich mit billigen Angriffen aus der Affäre zu ziehen. Sie schickte ihrerseits zwei verhältnismäßig junge Mandatare, Majonika und Baron Guttenberg, vor, beide glänzende Redner, die zwar Wehner den Rang nicht streitig machen konnten, die Rede des Tages gehalten zu haben, aber doch die Debatte zu einem wirklichen Ereignis werden ließen. Das Bemühen um die gemeinsame Außenpolitik hatte die ersten greifbaren Ergebnisse gezeitigt. Damit ist auch der erste Ansatz zu einer wirklich konstruktiven Opposition gefunden, die für eine Vertiefung und Verankerung des demokratischen Gedankens so notwendig ist.
Daß die CDU/CSU der Entwicklung mit Mißtrauen gegenübersteht, ist verständlich. Eine gemeinsame Außenpolitik nimmt ihr die zugkräftigsten Wahlschlager und lenkt das Interesse auf die Innenpolitik, in der sowohl Bundesinnenminister Schröder wie Bundesverteidigungsminister Strauß beträchtliche Schwächen zeigen. Notstandgesetzgebung, versteckte Angriffe gegen eine nicht ganz regierungstreue Presse, von denen der Justizmißbrauch im Falle Friedmann der offenkundigste war, sowie allzu markige Reden von Bundeswehrgeneralen, wie jener des Brigadegenerals von Hobe aus dem Bundesverteidigungsministerium, der dem deutschen Volk vorwarf, 1945 nicht richtig durchgehalten zu haben, und damit verteufelt nahe an die berühmte Dolchstoßlüge kam, gedeihen besser im Zwielicht, als wenn sie allzu sehr diskutiert werden. Mit seiner Rede brachte Wehner auch die bisherige Position der SPD zur Bundeswehr ins Schwanken, und es war durchaus berechtigt, wenn Strauß mit der Frage konterte, wie sich die SPD zur deutschen Aufrüstung stelle? Hier freilich wird es fraglich, ob die Mitglieder, und die SPD ist nun einmal eine Mitgliederpartei, Wehner und der Parteileitung folgen werden. Die Mitgliedschaft der SPD hat nämlich offenbar noch nicht erkannt, daß die Stellung zur Bundeswehr schon längst keine Ansichtssache, sondern eine hochpolitische Frage ist, die zu vernachlässigen auf die Dauer einen wesentlichen innenpolitischen Faktor verlieren heißt. Es wird sich zeigen, wieweit eine ressentimentgeladene Mitgliederschaft, wie in der Weimarer Republik, die SPD-Führung hindern kann, Politik zu machen. Positiv bleibt, daß sich in Brandt und Wehner zwei Politiker abzeichnen, die dem Kanzler insofern gewachsen sind, als sie sich von ihm nicht ärgern lassen und mehr können als Nein sagen. Wer Adenauer den Rang streitig machen will, muß eine echte Alternativlösung entwickeln. Wenn sie dies wirklich in Angriff nehmen, was dem biederen Ollenhauer nie gelang, werden Brandt und Wehner selbst dann zu Hoffnungen der deutschen Demokratie, wenn sie sich 1961 nicht gegen Adenauer durchsetzen können.
Vor diesem Ereignis ist das Ende der vierten Bundestagsfraktion, der Deutschen Partei, etwas in den Hintergrund getreten. 9 von 15 Abgeordneten der Deutschen Partei, darunter alle Minister, sind zur CDU übergetreten. Nun ist das für Koalitionspartner Adenauers nichts Neues. Im Juli 1955 traten die BHE-Minister Oberländer und Kraft zur CDU über, Juni 1956 gründeten die FDP-Minister eine neue, nicht lebensfähige Partei, weil sie in Konflikt mit ihrer Fraktion gerieten, die ihnen zuwenig Eigenständigkeit gegenüber Adenauer vorwarf. Seit Adenauer erklärte, der Deutschen Partei 1961 keine Schützenhilfe zur Überwindung der Fünfprozentklausel mehr geben zu wollen, war diese Entwicklung vorauszusehen. Die Gedanken Übertretender hat ein Bayernparteiabgeordneter 1953 in die klassischen Worte gekleidet: „Aus is! Die Wähler laffa uns davo, schaun ma, daß ma nachkemma,!“ Recht viel anders verhält es sich auch heute nicht. 1955 handelte die CDU bei diesen verschiedenen Übertritten HeTrn Oberländer ein, und wenn die Zeichen nicht trügen, dann kann es sein, daß ihr das neue Mitglied Seebohm (Verkehrsminister) mit seinen Sonntagsreden bald ähnlichen Kummer bereiten wird. Das Ende der Deutschen Partei hat keine großen Auswirkungen. Dieses Ereignis kann allerdings 1961 Rückwirkungen zeitigen, wenn die CDU/CSU keine 50 Prozent erreichen sollte und sich nach Koalitionspartnern umsehen muß. Ob sich dann noch jemand findet, der mit Adenauer in ein Kabinett geht, scheint nach den Erfahrungen des BHE, der FDP und der DP fraglich.
Jedoch ist damit nichts oder nur wenig über die eingangs zur Diskussion gestellte Frage gesagt, ob unter Adenauer eine Entwicklung zur Demokratie möglich ist. Diese Frage trifft nicht nur den politischen Stil des großen alten Mannes, sondern sie ist mehr noch eine Frage nach der Alternative zu ihm. Wenn von der SPD wirklich eine solche entwickelt wird, dann wird sich auch in der Innenpolitik manches abschleifen, was nach elf Jahren Regierungszeit für den Aufbau einer demokratischen Substanz gefährlich scheint. Eine Opposition, ein Parlament erhäl nie mehr Rechte, als sie sich nimmt. Vom Neinsagen erwachsen keine Rechte. Deshalb ist in einer Demokratie die Opposition für ihr Funktionieren mindestens ebenso wichtig wie der Stil der Regierungspartei. In diesem Sinn erweckt die letzte Bundestagsdebatte manche Hoffnungen für den Stil der deutschen Demokratie.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!