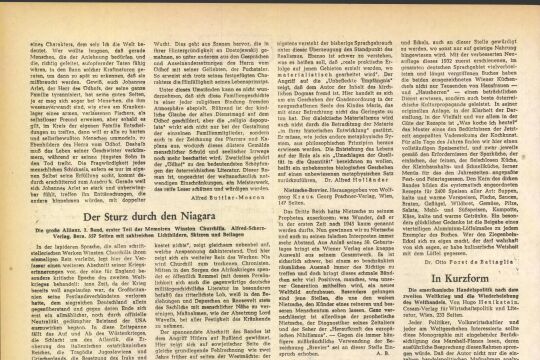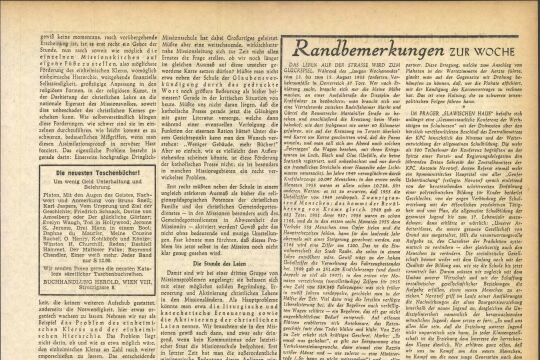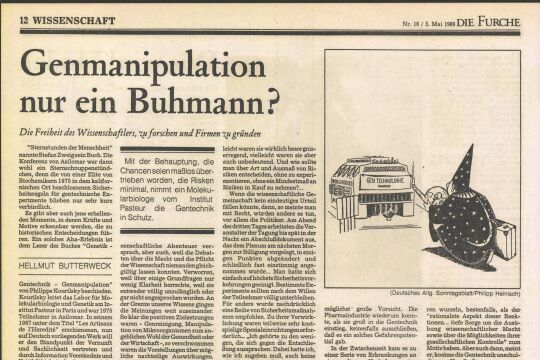Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kongreß der Superhirne
Kürzlich tagte in Graz der internationale Kongreß der „Mensa“ (vom lateinischen Wort für Tisch) des Vereines der Superintelligenten: Der internationale Klub, für dessen Mitgliedschaft man einen höheren Intelligenzquotienten (IQ) benötigt, als ihn 98 Prozent der Bevölkerung haben, brachte nach Österreich eine Reihe prominenter Gäste. Sind aber Mensa- Mitglieder wirklich so intelligent, wie sie selbst meinen?
Am Anfang war ein Test. Als 1905 die französischen Ärzte Alfred Binet und Theodore Simon den ersten Intelligenztest zusammenstellten (der heute modernisiert als „Stanford-Binet- Test“ noch in Gebrauch ist) wußten sie noch nicht, was da auf die Menschheit zukam.
Heute liegen in Psychologenschränken aus aller Welt einige Dutzend verschiedener Intelligenztests, die zwar in der Grundkonzeption und Fragestellung teilweise unterschiedlich sind, aber immer auf dasselbe hinauswollen: Die Intelligenz eines Menschen auf den wissenschaftlichen Prüfstand bringen.
Die Uneinigkeit unter Fachleuten bleibt aber aufrecht. Bekommt der gelernte Buchhalter Müller bei einen), viele rechnerische Fragen beinhaltenden Test den IQ-Wert von 127 heraus (was eine ausgeprägte Intelligenz ausdrückt), kann er bei einem Symboltest mit Schwerpunkt auf- praktisches Können und Vorstellungsvermögen bei 119 landen. Das zweite Ergebnis macht ihn also „dümmer“.
Die Frage, was nun Intelligenz eigentlich sei, ist auch äußerst strittig. Der deutsche Psychologe Peter Lauster, selbst Verfasser eines Tests, weicht aus: „Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest mißt.“
Bei Kindertests kann etwa nach Gegensätzen gefragt werden: „Der Hase ist ängstlich, der Löwe ist. ..“
Wird jetzt nicht der Begriff „mutig“, sondern „stark“ oder „mächtig“ eingesetzt, so ist die Möglichkei^einer Falschbeurteilung durch den Testenden durchaus gegeben.
Auch setzen eine ganze Reihe von Tests abendländische Vorkenntnisse voraus. Ein Beduine mit „fremdartiger“ Kultur wird solche Tests kaum bestehen und den Erfolg eines Grenzdebilen verbuchen.
Die internationale Mensa-Organisation, deren Schwerpunkt in den USA liegt, hat diese Probleme jedoch nicht. Die rund 220 Delegierten aus fünf Kontinenten, die in Graz tagten, unterhielten sich über Höhlenforschung, Intelligenz und menschliches Überleben, antike Geometrie, die Wichtigkeit des Denkens und sogar über die Kunst, glücklich zu leben.
Das Elitäre am Verein will die Mensa ausgeschaltet wissen. „Es kommen viele Leute zu uns, bestehen die Tests und können es dann einfach nicht glauben. Hausfrauen, Schüler, Studenten, aber auch Kaufleute, Professoren, Angestellte“, sagt Ferdinand Heger, Generalsekretär des österreichischen Mensa-Klubs.
Die Voraussetzung für eine Mensa- Mitgliedschaft ist dann gegeben, wenn dem Testergebnis zufolge der Prüfling zu den „oberen“ zwei Prozent Intelligenz-Mensch gehört. Die Wissenschaftlichkeit ist vorhanden: Die sogenannte Gaußsche Glockenkurve (nach dem Göttinger Mathematiker Carl Friedrich Gauß benannt) ist eine Zufallsverteilungskurve, die dann gegeben ist, wenn eine große Anzahl zufälliger Dinge oder Ereignisse gemessen werden soll.
So auch die Intelligenz: Der Durchschnitt der Bevölkerung (rund 37 Prozent) verfügt über den durchschnittlichen Intelligenzquotienten von 100. Zwölf Prozent der Menschen haben jeweils am benachbarten Ende der Skala Platz: Sie sind „dümmer“ oder „gescheiter“ als der Durchschnitt. Mensa-Mitglieder müssen sich am extremen Ende der Skala aufhalten: Die obersten zwei Prozent eben.
Die österreichische Mensa ist mit 503 Mitgliedern eine relativ starke Sektion der internationalen Vereinigung. Von den 503 Österreichern sind 111 weiblichen Geschlechts, 31 sind unter 19 Jahren. Übereinen akademischen Titel verfügen „nur“ 130.
Prominentester Gast des gutorganisierten Kongresses war C. Northcote Parkinson, Begründer des „Parkin- sonschen Gesetzes“.
Prominente Österreicher sind bis auf Georg Mautner Markhof. in den Mitgliederlisten nicht zu finden. Mangelndes Interesse oder nicht bestandene Aufnahmsprüfung?
Gastspiele japanischer Theatertruppen haben im Westen in den letzten Jahren den Zuschauern wahre Begeisterungsstürme entlockt. Ist es nur das „Theater für das Auge“, das auch ohne Sprachkenntnisse eine Beziehung möglich macht? Denn vor allem das Kabuki, das klassische japanische Volkstheater, vermag durch den Farbenreichtum, die kostbaren Kostüme aus Seidenbrokat und die luxuriöse Bühnenausstattung den europäischen Zuschauer zu fesseln.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!