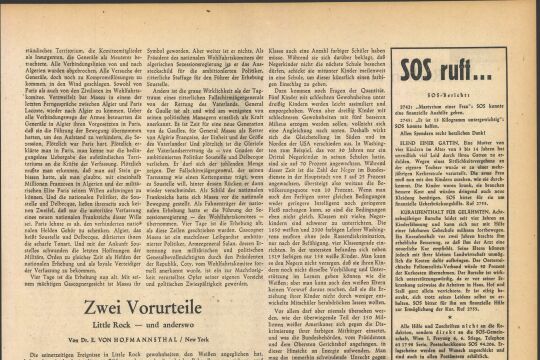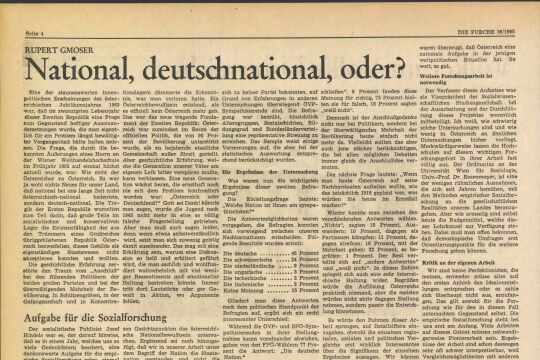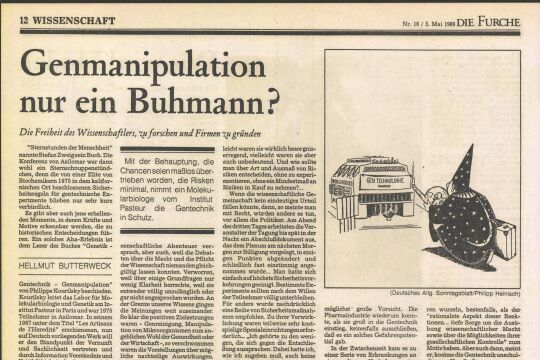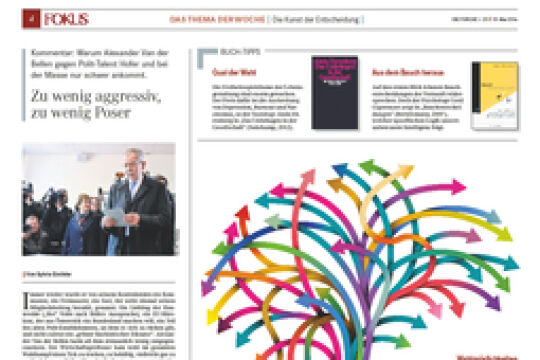Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ist Intelligenz meßbar?
Mit der Intelligenz ist es so eine Sache. Kein Wissenschafter kann sie definieren, aber ein Durchschnittsmensch weiß recht genau, ob sein Nachbar intelligent ist oder nicht.
Erstaunlich daran ist, daß wir mit schamloser Zuversicht seit Jahrzehnten die Intelligenz, „g” für „general intelli-gence factor”, auf einer Skala in Punkten messen: als Brustumfang, Taillen-und Hüftmaß der menschlichen Begabungen. Man meint offenbar, mit ausgetüftelten IQ (Intelligenzquotient)-Tests die Fähigkeiten eines Kindes ebenso zu erfassen wie mit dem Messen der Oberweite die Schönheit eines Körpers.
Die Maße - sei es ein IQ von 140 oder das Weitentrio 100/65/95 - sind keinesfalls wertlos. Sie beschreiben je-
80 Prozent Vererbung, 20 Prozent Umwelt? doch nur einige Details. Ihre Bedeutung haben sie nur in einem bestimmten Bezugsrahmen.
Die sich in den Heimatländern der IQ-Tests, USA und Großbritannien, seit einigen Jahren formierenden Testgegner argumentieren denn auch rahmenbezogen:
• Personen mit einem anderen kulturellen Hintergrund als dem des Landes, in dem die Tests gestaltet werden, sind immer benachteiligt.
• Die meisten Tests brechen alle Menschen über den anglo-amerikanischen Maßstab.
• IQ-Tests begünstigen Mittelklassekinder, weil die Frageformulierungen auf die Kultur- und Sprachkenntnisse der (amerikanischen) Mittelklasse zugeschnitten sind.
Tatsache ist, daß die amerikanische Negerbevölkerung und die Indianer im Schnitt beträchtlich schlechter als weiße Nordamerikaner, daß hingegen Chinesen (in den USA) und Japaner (in den USA und in ihrer Heimat) besser als weiße Nordamerikaner abschneiden. Weit unter den Chinesen liegen auf der Durchschnitts-IQ-Liste die Ma-layen, während die Eskimos (in ihrer Heimat) mit den Weißen gleichziehen.
An diesem Punkt wird die IQ-Sache peinlich und rutscht in einen zweiten, weit älteren Streit: Wieweit wird Intelligenz vererbt, wieweit durch Umwelteinflüsse geformt?
Vererbungsfans (oft als Rassisten beschimpft) meinen, daß 80 Prozent der Intelligenz den Menschen mitgegeben werden, und nur 20 Prozent durch fördernde oder bremsende Milieubedingungen beeinflußbar seien.
Ümweltfans (oft als Gesellschaftsrevoluzzer beschimpft) meinen, daß das ererbte Potential durch fördernde Einflüsse nicht nur voll entwickelt, sondern auch weit überschritten werden könnte.
Die Vererbungstheoretiker parieren solchen Milieuoptimismus mit Zwillings-Versuchen. Sie sortieren die Umwelteinflüsse bei eineiigen Zwillingen, die getrennt aufgewachsen sind, aus. Da diese Kinder oder Erwachsenen erbgleich sind, müssen alle Unterschiede zwischen ihnen auf Umwelteinflüsse zurückgehen. Das Ergebnis ist die magische Verhältniszahl 80 : 20 mit kleinen Abweichungen.
Nun ist aber Intelligenz eine weit kompliziertere Sache als ein und dieselbe Geste und Frisur oder dieselbe Wetterfühligkeit bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen. So komplex, daß selbst der aus Deutschland stammende britische Vererbungsfan Hans Jürgen Eysenck die Unterschiede in den Durchschnitts-IQs verschiedener Rassen nicht auf mehr oder weniger Intelligenz in der Erbmasse zurückführen mag.
Anders der Amerikaner Arthur R. Jensen, Bildungspsychologe an der Univeristät von Kalifornien in Berkeley. Er rechnete mit Akribie all das aus den Resultaten von IQ-Tests heraus, was als Kultur- oder Rassenvorurteil gewertet werden kann. Auch die so-zioökonomischen Verzerrungen und die Sprachhindernisse wurden mit statistischen Methoden entfernt. Das Resultat: Schwarze US-Amerikaner schneiden nach wie vor schlechter ab als weiße. Jensen zieht den Schluß, daß die schwarzen Amerikaner weniger vom Faktor „g” hätten. Und zwar vererbterweise und rassefixiert.
Spätestens hier wäre zu fragen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen herangezogen werden, um das zu messen, was nach den IQ-Tests Intelligenz ist. Jensen - er sei hier stellvertretend für viele Psychologen genannt - stellt diese Frage nicht.
Für die Macher der IQ-Tests ist „g” wohl das, was erfolgreiches Lernen, Können und Verhalten im westlichen Abendland heutiger Prägung garantiert. Intelligenz in diesem Sinn kann in anderen Zeiten und anderen Kulturen völlig unbedeutend sein. Wir aber haben die IQ-Intelligenz mitsamt der Konsumgesellschaft in alle Welt exportiert. Und erwarten jetzt, daß alle Menschen unseren „g”-Maßstäben entsprechen.
Zum Glück für die anregende Vielfalt der Menschheit tun sie dies nicht. Denn schon die Neugeborenen sind verschieden: die weißen sind reizbar und ungeduldig, die chinesischen von stoischer Ruhe und leicht tröstbar, die Navajo-Säuglinge, so fand der Chikagoer Verhaltensforscher Daniel G. Freed-man heraus, sind noch friedlicher als die fernöstlichen.
Zu dem kann ein geschickter Sozialwissenschafter jeden beliebigen IQ-Test einwerfen: einen, bei dem die niedrigste Schicht besser besteht als die High Society, einen, den nur Indianer lösen können oder einen, in dem nur die Mädchen reüssieren.
Das Beispiel mit den Mädchen wurde übrigens bereits durchexerziert: die frühen Versionen des „Standford-Binet-Tests” (der älteste IQ-Test) zeigten unterschiedliche Ergebnisse bei Buben und Mädchen. Auch wenn belegt ist, daß weibliche Säuglinge eher auf Gesichter und männliche auf Dinge reagieren, darf nicht sein, daß die Mäd-
,,Intellektueller Völkermord” chen sprachliche ufid die Buben räumliche Spezialisten sind (als Gruppe gesehen, Begabungen einzelner Individuen können dem zuwiderlaufen). Der Test wurde in seiner Fragestellung so lange geändert, bis beide Geschlechter gleich abschnitten ...
Es wäre also leicht, IQ-Tests so auszustatten, daß schwarze Kinder weißen überlegen sind.
Weil diese Dinge aber nicht gefragt sind, bleibt es dabei: US-Neger haben im Schnitt einen IQ, der um 15 Punkte (!) unter dem der Weißen liegt. Jensen wird von vielen amerikanischen Psychologen öffentlich verdammt. Der (schwarze) Psychologe Robert L. Williams zeiht ihn des „intellektuellen Völkermordes”.
Als „intellektuellen Völkermord” könnte man auch das andere Extrem bezeichnen, jene UNESCO-Deklaration, welche die Gleichwertigkeit der Völker mit Uniformität verwechselt und feststellt, es gebe keine Wesensunterschiede zwischen den Menschen verschiedener Kulturkreise.
Selbst in Mitteleuropa ist das Thema „Ist Intelligenz vererbt oder umweltbedingt?” brisant. Die Diskussion um die Schulreform spiegelt dies.
Gegen solche Grundsatzdebatten, die sich auf Vererbung und Umwelt als Gegensätze stützen, gibt es aber eine neue Front: Genetiker und Biologengegen Erziehungswissenschafter und Psychologen.
Der Chikagoer Genetiker Richard Lewontin zählte 1972 die für 17 verschiedene Blutsysteme zuständigen Gene aus. Er kommt zu dem gleichen Schluß wie IQ-Kritiker (die betonen, daß die individuellen Unterschiede innerhalb einer Gruppe weit größer seien als die Unterschiede bei den Durchschnitts-IQs zwischen mehreren Gruppen): 85 Prozent der genetischen Unterschiede sind zwischen den Individuen einer Rasse zu finden, und nur 15 Prozent zwischen den Rassen.
Der britische Biologe Steven Rose bezeichnet den Streit zwischen Verer-bungs- und Milieutheoretikern als hoffnungslos überholt. Es gehe um die Zusammenschau von genetischen und Umweltfaktoren, nicht um das Auseinanderzählen. Für Rose sind die IQ-Tests ein Zirkelschluß, der einen Stoff, den Faktor „g” erst erfindet, um dann festzustellen, daß man, wenn man wenig „g”-Stoff geerbt hat, untauglich ist.
Die Intelligenz setzt sich nach Rose aus drei großen Bereichen zusammen: dem biologischen, dem der persönlichen Geschichte eines Individuums und dem seiner sozialen Situation. Jeder Bereich hat mehrere Komponenten (der biologische etwa Vererbtes und durch den Hormonhaushalt des Körpers ständig Geregeltes und Verändertes). Dieses für jeden Menschen anders funktionierende Zusammenspiel sei -so Rose - unmöglich mit einer einzigen Meßzahl, die zudem noch stark ideolo-gisiert sei, zu erfassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!