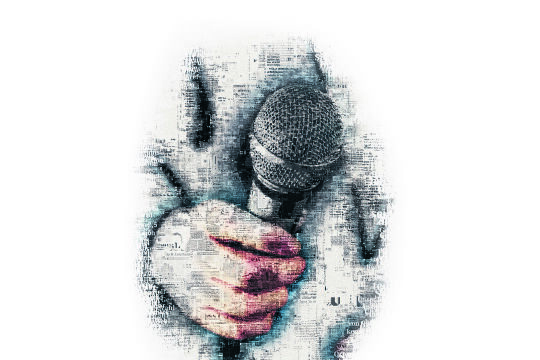Die Krise beherrscht das Denken, das Bewusstsein, die Befindlichkeit – was immer die einzelnen daraus für Konsequenzen ziehen mögen. Auch diejenigen, die sich in ihrer Lebensführung und ihrem Konsumverhalten davon nicht irritieren lassen – und das dürften zum Glück gar nicht so wenige sein – haben es im Hinterkopf: Wir sind in der Krise. Und jeder weiß, ohne dass es weiterer Erläuterungen bedürfte, was damit (wenigstens ungefähr) gemeint ist: Es ist die Rede von der globalen Finanzkrise.
In gewöhnlichen Zeiten „kriegen“ wir ja höchstens „die Krise“, wenn das Wetter oder das Fernsehprogramm schlecht ist oder das Bier ausgeht. Und in der österreichischen Innenpolitik gilt jeder Bassenastreit schon als Regierungskrise. Es „kriselt“ in der Koalition, heißt es dann, was phonetisch eine richtige Assoziation zulässt: Die Krise ist hierzulande eher nur als „Kriserl“ geläufig.
Viel Aktionismus, …
Oder besser: war, denn jetzt haben wir eben eine wirkliche Krise, eine, die „sehr weltweit“ ist, wie Sozialminister Hundstorfer im ORF-Report treffend bemerkte, weswegen die Politik jetzt gefordert ist, „Antworten zu geben“ (wiederum Hundstorfer).
Die Krise hat also ihre begriffsmäßige Krise überwunden und die Ernsthaftigkeit ihres Wortsinns wiedergewonnen, in dem Herausforderung und Chance gleichermaßen stecken. Da fügt es sich, dass in wenigen Wochen Barack Obama hinter dem imposanten Schreibtisch im Oval Office Platz nehmen wird. Von ihm, dem künftigen US-Präsidenten, wird ja nicht weniger als ein globaler Paradigmenwechsel in Politik und Wirtschaft erwartet, und es hat den Anschein, als ginge davon eine gewaltige Sogwirkung aus: Etliche europäische Politiker haben gewissermaßen den Obama in sich entdeckt (wie Frankreichs Präsident Sarkozy) oder lassen ihn von unbestechlich-kritischen Kommentatoren entdecken (wie Wolfgang Fellner bei Werner Faymann). Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Das Problem ist nicht Obama – der wird allem Anschein nach seine Sache sehr gut, also nicht alles anders, aber vieles besser machen – doch darum geht es hier gar nicht. Bedenklich stimmt, dass in der Mischung aus „Krise“ und „Obamanie“ Politik eine beinahe quasireligiöse Aura zugesprochen bekommt (man beachte, wer und was zurzeit aller bzw. alles „gerettet“ wird), derer sich die Protagonisten nur allzu gerne bedienen.
… wenig Substanz
Nun ist schon klar, dass die fortwährende Diskreditierung von Politik, Staat, öffentlicher Hand, die von bestimmten Kreisen in den letzten Jahren nassforsch betrieben wurde, so dumm wie falsch war. Aber gibt es einen Grund anzunehmen, dass es Politikern immer und einzig um das Gemeinwohl zu tun ist? „Man will der eigenen Wählerschaft in der Stunde der größten Not besonders große Tatkraft demonstrieren“, hält NZZ-Chefredakteur Markus Spillmann lapidar fest. Dieser nüchterne Befund dürfte der Realität ziemlich nahe kommen.
Eine der wenigen, die der Versuchung zur Selbststilisierung als „Retter aus der Krise“ widerstehen, ist Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel – die damit freilich zur Buhfrau auf der europäischen Bühne geworden ist. Doch auf lange Sicht könnte sich ihre Haltung als die richtige erweisen – wenn ins allgemeine Bewusstsein durchgesickert ist, was die (gewiss nicht CDU-nahe) Süddeutsche Zeitung dieser Tage geschrieben hat: Sarkozy habe bisher „viel Aktionismus an den Tag gelegt und damit wenig Substanz erzeugt“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!