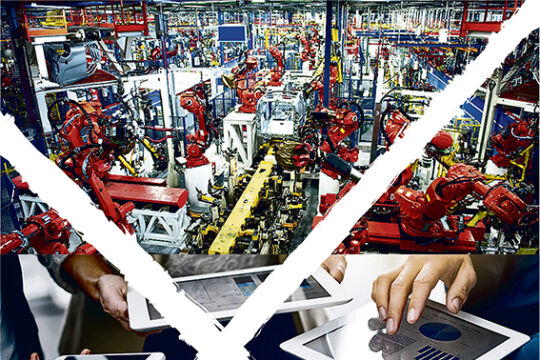Vom Schlaf der Freiheit
Wenn der Nationalstaat zunehmend an Bedeutung verliert, dann müßte der neue Bezugsrahmen eine politische Bürgergesellschaft sein.
Wenn der Nationalstaat zunehmend an Bedeutung verliert, dann müßte der neue Bezugsrahmen eine politische Bürgergesellschaft sein.
Der Sinn des politischen Gemeinwesens liegt in der Gestaltung der Freiheit. Geht der öffentliche Sinn für Freiheit verloren, so ist das Gemeinwesen schutzlos. Leitideen wie diese gehören seit der Antike zum abendländischen Kulturgut. Charles de Montesquieu, Immanuel Kant und viele andere Denker haben diese Idee der freiheitlichen Selbstverfassung ins bürgerliche Zeitalter getragen. Hannah Arendt hat sie aufgegriffen, um zu verstehen, weshalb die europäischen Demokratien vor den faschistischen und nationalsozialistischen Massenbewegungen nahezu widerstandslos in sich zusammengebrochen waren. Es scheint, als würde diese Leitidee demokratischer Politik nicht nur unter dem totalitären Ansturm, sondern auch in der Normalität demokratischer Praxis verlorengehen.
Gegenwärtig wird die Idee der politischen Freiheit von der Maxime der wirtschaftlichen Nützlichkeit und der praktischen Umsetzbarkeit erdrückt. Inzwischen greift der Schaden - wie Rostfraß - die Grundlagen an. Etwas ganz Wichtiges für das Überleben der westlichen Industriegesellschaft geht verloren: die Erfahrung einer freien Bürgergesellschaft, die sich nicht nur als bedürftig begreift, sondern selbstbewußt das Gemeinwesen gestaltet. Aus diesem Selbstbewußtsein erwächst der "Geist der Demokratie". Er zeigt sich darin, daß die Bürger fähig sind, sich öffentlich über Zwecke und Ziele des Gemeinwesens zu verständigen und danach zu handeln. Ihn wachzuhalten, beinhaltet die Übernahme öffentlicher Verantwortung, nicht im Sinne eines Amtes, sondern im Sinne einer immer wieder neu gestifteten öffentlichen Einmischung.
Diese Dimension freiheitlicher Politik taucht gegenwärtig nur sporadisch auf, da die politische Bühne von zwei Seiten her besetzt ist. Einerseits scheint Politik den wirtschaftlichen Zwängen und Interessen hinterherzulaufen; sie erscheint nach außen hin als Funktion wirtschaftlicher Entgrenzung. Andererseits wird Politik nach innen hin mehr und mehr auf staatliche Regelungsverfahren reduziert. Diese Tendenzen werden sich im Zuge der Entgrenzung der Märkte und des Funktionsverlustes der Nationalstaaten weiter verstärken. Die Auflösung alter Sicherheiten und Bindungen wird Politik mehr und mehr darauf reduzieren, die sozialen Folgelasten des technologischen Wandels zu regeln. Dies wiederum stärkt die Abhängigkeit der Bürger vom Staat als dem Versorger. Als Folge davon ist die sinnstiftende Aufgabe der politischen Öffentlichkeit verlorengegangen. Jener selbstgestellte Auftrag der Bürger seit der Antike: das öffentliche Gemeinwesen in Freiheit zu gestalten, er ist an den Staat delegiert worden.
Diese Perspektive, die in den modernen Demokratien immer vorhanden war, tritt gegenwärtig umso mehr hervor, je mehr die praktischen Probleme ausschließlich unter dem Aspekt ihrer Finanzierbarkeit und Regelbarkeit betrachtet werden. Dabei verschwindet allmählich jene öffentliche Sphäre, in der immer auch der politische Sinn des Gemeinwesens aufscheint. Die westlichen Demokratien haben sich einem technokratischen Pragmatismus verschrieben, der politische Ideen nur mehr für störend hält und alle Sinnfragen in funktionale Regelungsverfahren auflöst. Doch jetzt zeigt sich, daß man die Rechnung ohne die Wirtin gemacht hat. Am Beispiel der deutschen Republik wird dies besonders deutlich. Wie alle westeuropäischen Demokratien hat sich auch die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft auf den Grundkonsens "Gute Demokratie = florierende Wirtschaft + starke Institutionen" verständigt. Das öffentliche Selbstvertrauen beruht weithin auf der Bindung des Demokratieverständnisses an die florierende Wirtschaft. Immer dann, wenn Strukturkrisen auftraten, entstanden tiefe Verunsicherungen, in denen sichtbar wurde, was den Deutschen fehlte: ein Verständnis von Gemeinwesen, das von Bürgern getragen wird, die ihr Vertrauen eben nicht nur von der florierenden Wirtschaft abhängig machen. Nach der deutschen Vereinigung 1990 treten diese Probleme jetzt noch schärfer hervor. In der alten wie der neuen deutschen Republik wird Demokratie auf einen wirtschaftlichen und sozialen Zweckverband reduziert, der das Bedürfnis nach politischer Sinnstiftung immer wieder entstehen läßt (so zum Beispiel ex negativo in der permanenten ostdeutschen Unzufriedenheit), aber nicht stillen kann, weil er alle Sinnfragen auf Finanzierbarkeit und Regelungsverfahren reduziert.
Wie bedeutsam politische Sinnstiftung ist, und wie schwierig es ist, sie aus einer scheinbar vollständig ökonomisch und technokratisch verplanten Gesellschaft heraus zu beleben, wird auch an der Debatte über Arbeitslosigkeit deutlich. Gegenwärtig werden ganze Berufssparten aus dem Arbeitsprozeß ausgesondert. Doch auch die beste staatliche Versorgung kann nicht regeln, wie sich denn der Arbeitslose als Bürger verstehen soll. Denn seit Beginn der Moderne wird die öffentliche Anerkennung des Bürgers über die Arbeit bestimmt. Nur wer gut arbeitet, ist Bürger, von dieser Maxime der protestantischen Ethik zehrt das öffentliche Selbstverständnis nach wie vor. Wer aber nicht arbeitet, weil er zufälligerweise aus dem Arbeitsprozeß herausgefallen ist, welchen Bürgerstatus hätte er noch? Ein politisches Gemeinwesen, das den gegenwärtigen Strukturwandel überstehen will, müßte den Bürgerstatus von Innehaben einer Arbeitsstelle eher trennen. Dies ist schon allein deshalb notwendig, weil vielen Bürgern gegenwärtig nicht nur das politische, sondern auch das private Selbstbewußtsein abhanden zu kommen droht. Den Gedanken einer politischen Bürgerschaft neu zu beleben, macht nur Sinn, wenn ein allgemeines Bedürfnis nach einer öffentlichen Sphäre entsteht, in der die politische Anerkennung nicht einseitig von der wirtschaftlichen Leistung abhängig gemacht wird.
Das Dilemma, politische Ideen aus unpolitischen Gesellschaften heraus zu stiften, ist in allen westlichen Gesellschaften präsent. Wer den Debatten über die europäische Einigung folgt, gewinnt den Eindruck, als hätten sich alle Akteure darauf verständigt, daß Europa die Summe seiner Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen, seiner sozialen Probleme und seiner gemeinsamen Verwaltung sei. Eine politische Union erscheint allenfalls in juristischen Termini. Es fehlen sinnstiftende Ideen, ja, es scheint auch das Bedürfnis nach Ideen zu fehlen. Sie erscheinen überflüssig, da noch immer auf die alte Gleichung "selbstregulierende Sinnstiftung des Marktes plus Fürsorgefunktion des Staates" vertraut wird. Ein Ausweg aus dem Dilemma ist noch nicht in Sicht. Aber ohne eine Art symbolischer Bürgergesellschaft kommen die modernen Demokratien auf Dauer nicht aus. Dazu scheint folgendes unabdingbar zu sein: n Die symbiotische Verwachsenheit des Sozialbürgers mit dem politischen Bürger muß aufgehoben werden; sonst wird immer mehr Menschen verwehrt, Bürger zu sein, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Die subtile Diskriminierung derer, die aus dem Arbeitsnetz herausfallen, bedroht die Demokratie. Das politische Gemeinwesen muß unabhängiger vom wirtschaftlichen Interessenverband werden. Dann könnte sich die mentale Bindung an den Staat lockern, denn sie stärkt Immobilismus und Bürokratie. Die Bürger hätten die Chance, ihre Würde als Bürger zu erhalten und dem Gemeinwesen etwas geben zu können, selbst wenn ihnen die Arbeitsstelle abhanden gekommen ist.
n Wenn denn die Diagnose stimmt, daß der Nationalstaat im Zuge der internationalen Verflechtung peu a peu an Bedeutung verliert, dann müßte der neue Bezugsrahmen eine politische Bürgergesellschaft sein, die ihr Selbstbewußtsein aus der grenzüberschreitenden Fähigkeit zur Stiftung der politischen Freiheit zieht und nicht nur aus der Zugehörigkeit zu einem nationalen Staatswesen. Demokratie braucht einen Ort, aber die muß nicht der alte Nationalstaat oder der neue europäische Super-Staat sein. Die europäische Perspektive besteht eben nicht darin, einen bürokratisierten Groß-Staat erstehen zu lassen, der die nationalen Gesellschaften aufsaugt. Ihr Sinn läge vielmehr in einem symbolischen Brückenschlag über einem Netz von innereuropäischen nationalen, transnationalen, aber auch regionalen Zusammenschlüssen. Dieser symbolische Brückenschlag ist die freiheitliche Verfassung der politischen Gemeinwesen. Ein solcher Brückenschlag erscheint aber nur möglich, wenn jede Gesellschaft - ob nun national oder transnational verfaßt - über ein politisches Selbstbewußtsein verfügt, das auf gemeinsamen Erfahrungen der politischen Freiheit und der Fähigkeit beruht, diese Erfahrungen umzusetzen.
Problematisch erscheint, daß diese Debatte von Politikern geführt werden müßte, die nicht zusammengeschrumpft sind auf die Statur von Verwaltungsbeamten, sondern politisch denken können und wollen. Die politische Klasse müßte wieder lernen, zu lernen. Sie wird dies nur dann tun, wenn sie von einer wachen Öffentlichkeit dazu angehalten wird. Eine solche Öffentlichkeit wird nur dann bestehen können, wenn Bürgerinnen und Bürger ihren Auftrag ernst nehmen, das politische Gemeinwesen immer wieder zu beleben.
Die Autorin lebt als Politikwissenschafterin und Publizistin in Deutschland.
Buchtip DER SCHLAF DER FREIHEIT Politik und Gemeinsinn im 21. Jahrhundert. Von Antonia GrunenbergRowohlt-Verlag, Reinbek 1997.öS 248,