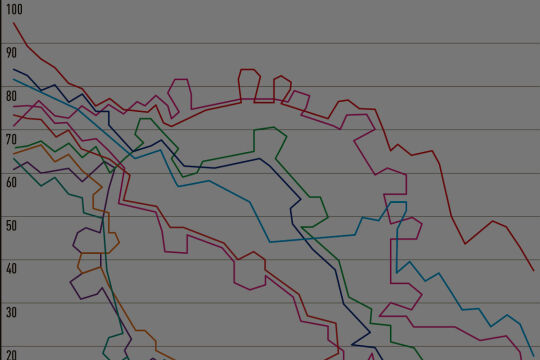Krise ist ein produktiver Zustand - man muss ihr nur den Geschmack der Katastrophe nehmen", meinte einst der Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Vielleicht hatte er Recht. Oder doch nicht? Ein Blick auf die aktuelle Situation rund um die griechischeuropäischen Wirrnisse zeigt, wie schwer eine eindeutige Antwort fällt.
Als vor drei Jahren das gesamte Euro-System an der Kippe stand, war es eine richtige Entscheidung, Zeit zu kaufen. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, versicherte damals, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Gemeinschaftswährung zu retten. Sein Versprechen verhinderte den ungeordneten Zerfall von Euro-Land und ermöglichte die Schaffung eines permanenten Stabilisierungsfonds (ESM) und der Bankenunion. Außerdem wurde seit damals der Großteil der griechischen Schulden auf Gemeinschaftsfonds umverteilt. Mit dem Vorteil, dass das europäische Bankensystem durch eine Griechenlandpleite nicht mehr im Mark erschüttert werden kann und dem Nachteil, dass die Kosten einer Staatspleite direkt auf die Budgets aller Euro-Länder durchschlagen.
Der Plan B, den es nicht gibt
Jedenfalls erreichte man, dass ein eventueller Austritt Griechenlands aus dem Euro mittlerweile als verkraftbar gilt und die versammelten Finanzminister bis zuletzt vorgeben konnten, nicht erpressbar zu sein. Sie vermittelten sogar den Eindruck, für den unwahrscheinlichen Fall des Scheiterns der Verhandlungen über einen "Plan B" zu verfügen. Seit wenigen Tagen wissen wir nun: den Plan B gibt es nicht.
Dazu kommt, dass der Preis der gekauften Zeit in den letzten Monaten ins schier Unermessliche gestiegen ist. Die EZB gewährte nämlich in der trügerischen Erwartung einer politischen Einigung den griechischen Banken Liquiditätshilfen von über 80 Milliarden Euro. Dies ermöglichte griechischen Bürgern, Geld von ihren Banken abzuziehen und auf ausländische Konten zu überweisen. Die Politik jedoch wusste die teure Schützenhilfe der Notenbank nicht zu nützen und versagte auf beiden Seiten des Verhandlungstisches.
Die Positionen waren zuletzt unversöhnlich. Einerseits schien ein substanzieller Schuldennachlass wegen der unzumutbaren Vergleichswirkung gegenüber Ländern wie Spanien und Portugal, die sich den Troika-Regeln gebeugt haben, undurchführbar. Andererseits hätten widersinnige neue Sparzwänge die angeschlagene Konjunktur nur noch stärker abgewürgt.
Nun bleibt Griechenland wohl nur der Weg zurück in eine eigene Währung und die damit verbundene Chance, seine wirtschaftliche Zukunft wieder selbst zu verantworten, wie andere Nicht-Euro-Länder auch. Solidarität mit dem EU-Mitglied Griechenland heißt in dieser Situation, das Land auf dem Weg in die währungspolitische Autonomie zu unterstützen, statt auf unerfüllbaren Auflagen zu bestehen. Dieser Befreiungsschlag kommt zwar teurer als alle anderen Lösungen, er scheint aber unvermeidlich. Und jedenfalls produktiver als eine Euro-Dauerkrise mit permanentem Katastrophengeschmack.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!