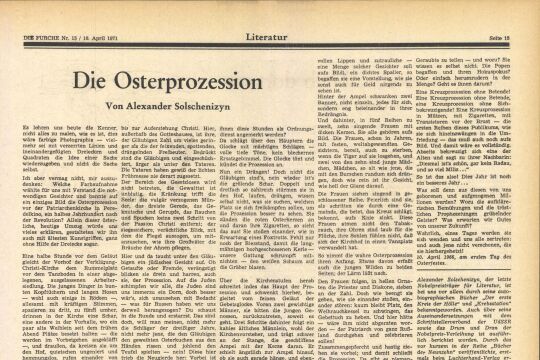Gut, dass die Fahrt ins rumänische Ardud für die Furche nicht der erste Besuch eines Roma-Dorfes war. Zu positiv wären die Eindrücke dieses Musterprojekts gewesen. So aber hat man vorher schon ausreichend Schlimmes gesehen, um über dieses Hoffnungszeichen froh zu sein.
Sie näht an einem Hemd, schon seit Jahrhunderten, denn jedes Jahr ist ihr nur ein Nadelstich erlaubt. In Ardud, wenige Kilometer von Satu Mare entfernt, im Nordwesten Rumäniens wird diese Legende dem staunenden Gast erzählt. Die Geschichte handelt vom tragischen Los der Tochter des Fürsten von Siebenbürgen, Rákócsi. Unsterblich in einen österreichischen Offizier verliebt, hat sie diesem das Versteck ihres gegen die Habsburger revoltierenden Vaters verraten. Zur Strafe näht sie seither an einem Hemd und streift in den Nächten, so die geheimnisumwobene Schilderung der Bewohner dieser kleinen Ortschaft, todunglücklich zwischen den verfallenen Mauern der Burg Ardud umher.
Was der Fürstentochter ein Fluch, gereicht drei Jahrhunderte später den Roma-Kindern von Ardud zum Segen. Neben der Dorfkirche hat die Caritas Satu Mare einen Schülerhort untergebracht. Treffpunkt nach der Schule, ein Ort, um zu essen, die Hausaufgaben zu machen, zu lernen und für die Älteren, um zu kochen, zu waschen und zu nähen. Kirche und Hort stehen auf einer Anhöhe. Wer vor die Tür tritt, sieht hinunter ins flache Land und der Rauch, der aus den Kaminrohren in den kalten Winterhimmel steigt, verrät, dass die eng beieinander stehenden Kaluppen bewohnt sind.Von dort unten kommen die Roma-Kinder herauf. 120 jeden Tag. Mit dem Schülerhort haben sie den Weg aus dem Ghetto ins Dorf gefunden. Und dass es für sie aufwärts geht, beweist ihnen schon ihr täglicher Trampelpfad, der nach oben führt.
Am Anfang der Lauskamm
Doch der Schülerhort stand nicht am Anfang. Vor zehn Jahren gründete Tiberius Schupler, selbst aus Ardud und Caritas-Direktor von Satu Mare (siehe Gespräch auf Seite 16), einen Kindergarten gleich neben der Roma-Siedlung. Er und sein Team mussten ganz unten, ganz klein und ganz von vorn beginnen und niemand traute sich damals zu hoffen, dass ihre Integrationsarbeit nach wenigen Jahren solche Früchte tragen wird. Wer heute den Kindergarten besucht, die sauberen Mädchen und Buben sieht, glaubt nicht, dass zu Beginn des Projekts die Kinder jeden Tag zuerst einmal entlaust und gewaschen werden mussten. Andrea Lieb, die Leiterin des Kindergartens, erzählt von den Schwierigkeiten, den Kindern begreiflich zu machen, dass sie die Toilette im Haus benutzen und nicht hinterm Haus ihr Geschäft verrichten sollten. Fließendes Wasser war für die Roma-Kinder so neu wie Seife. Und von zu Hause nur mit Bohnen, Brot und Kartoffeln vertraut, verweigerten sie anfangs vehement das ungewohnte Essen.
Fünf, sechs Kinder sind genug
"Jetzt ist alles viel einfacher", erklärt Andrea Lieb, "die älteren Kinder geben daheim schon vieles weiter. Ihre kleineren Geschwister kommen mit ganz anderen Voraussetzungen." Aber auch die Roma-Eltern hat der Kindergarten verändert. Andrea Lieb: "Am Anfang haben die Eltern ihre Kinder beim Nachhausekommen gefragt: Was hast du gegessen? Hat dich die Kindergärtnerin geschlagen? Heute fragen sie danach, was das Kind gelernt hat."
Die resolute Kindergartenchefin erzählt von weiteren Entwicklungen: Ohne dass in diese Richtung Einfluss genommen werde, gehe die Kinderzahl bei den Roma-Familien in Ardud zurück. Die Familien seien zwar immer noch groß, aber heute bleibe es bei fünf, sechs Kindern. "Vor zehn Jahren waren es mindestens acht, zehn und mehr", erzählt Lieb und nennt als Grund dafür: "Die Eltern merken, dass ihre Kinder Zeit, Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen. Und sie wollen ihren Nachwuchs nicht mehr wild aufwachsen lassen." Der Kindergarten und mittlerweile auch der Schülerhort haben aber auch noch einen weiteren positiven Effekt: Das Verhältnis der Roma zu den anderen Dorfbewohnern und umgekehrt hat sich ebenfalls stark verbessert, bestätigt Lieb. Eine Tanzgruppe der Roma-Kinder durfte sogar beim Dorffest auftreten - absolutes Novum für das früher nicht immer konfliktfreie Zusammenleben in Ardud.
Gut, dass Ardud nicht der erste Besuch eines Roma-Projekts war, nicht die erste Erfahrung, die die Visite einer Roma-Siedlung hinterlassen hat. Zu optimistisch wäre ansonsten der Eindruck, zuwenig realistisch die Beurteilung der Lebensverhältnisse der Roma in Osteuropa. Doch der Weg von Satu Mare nach Ardud führte über Petea.
Ein winziges Dorf an der rumänisch-ungarischen Grenze. Thomas Hackl, gebürtiger Innsbrucker, nach dem Zivildienst in Satu Mare bei der dortigen Caritas hängengeblieben, ist der Furche ein wichtiger Begleiter und Dolmetsch. Und kann auch minus zwölf Grad und eisigem Wind etwas Gutes abgewinnen: "Ist wenigstens der Boden hart gefroren, bis zu den Knien im Schlamm herumstapfen, ist auch keine Gaudi." Die Roma-Siedlung in Petea ist für Hackl "das Extremste, was ich kenne". Das will was heißen, betreut der gelernte Theologe doch seit sieben Jahren Roma in Rumänien.
Wundern, fragen, schämen
Die Roma des Dorfes sind an diesem Vormittag im nahen Wald und sammeln Holz. Nur ein paar Frauen kommen, nachdem sie Hackl erblickt haben, aus ihren Keuschen und fragen, ob er nicht Kraut und Fleischdosen bei sich habe - für die Kinder, für Weihnachten. Eine Frau trägt ihr Baby am Arm, ein Mädchen geht mit einem Wasserkübel zum Dorfbrunnen, mustert die Besucher. Die zittern vor Kälte und wundern sich und fragen sich und schämen sich, dass sie sich so anstellen, während die Roma-Frauen, obwohl nur spärlich bekleidet, keine Miene verziehen. Der Brunnen wurde von der Caritas gebaut, tief in die Erde gestoßen. Denn das Grundwasser ist schwer nitratverseucht. "Das Wasser aus den alten Ziehbrunnen sieht aus wie Milchkaffee", sagt Hackl.
Inzucht verschlimmert Lage
Die Roma-Kinder sind in der Schule. Drei Klassen und eine Kindergartengruppe beherbergt das kleine Gebäude. Die einzigen zwei Wasserhähne des Dorfes finden sich auch dort. Mit Mützen und Anorak sitzen die Roma in den Klassen. "Die Kleinsten kommen in der Früh völlig durchfroren daher", schildert eine Lehrerin die Umstände. Ein Dreijähriger versucht gerade ein Bilderbuch zu öffnen - es will nicht gelingen. Die Kinder sind teilweise schwer zurückgeblieben. Das Roma-Dorf ist eine strikt in sich geschlossene Gemeinschaft. Inzucht trägt seinen Teil dazu bei, dass viele Kinder schon mit mehr oder weniger großen geistigen und körperlichen Mängeln zur Welt kommen.
Trotzdem, "kein Vergleich zur Situation vor vier Jahren", beteuert Thomas Hackl und die Kindergartentante neben ihm nickt. Und am Gasherd in der kleinen Küche brennt die Flamme - besser als gar keine Heizung. Als in Petea vor vier Jahren mit einem Kindergarten gestartet wurde, haben alle Verantwortlichen in Land und Gemeinde gesagt: "Macht's nur, es wird nicht funktionieren." Das Gegenteil ist der Fall. Langsam bessert sich selbst hier, im "Extremfall", die Situation.
Das Erfolgsrezept dieser Integrationsprojekte lässt wieder an die Geschichte über Fürst Rákócsi denken. Um seine Verfolger zu verwirren, hat der Fürst sein Pferd mit den Hufeisen verkehrt herum beschlagen. Erst als man begann, das Problem einmal anders herum zu bedenken und anzugehen, hatte man Erfolg. So war es auch bei der Hilfe für Roma. Der Zusammenbruch des Kommunismus und die folgende Arbeitslosigkeit brachte sie an den Rand ihrer Existenz. Die Hilfsgüterlieferungen verstärkten aber nur ihre Abhängigkeit. Dazu kam, dass die Hilfe Neid, Wut und Hass bei der Mehrheitsbevölkerung weckte, der es großteils auch an Vielem fehlte und die sich benachteiligt fühlte. Erst der Umdenkprozess, die Roma müssen und wollen für die gebotene Hilfe etwas leisten, brachte den Erfolg. Noch mehr, wenn man mit diesem Konzept bei den Kindern beginnt.
Auf diesen Aspekt legen auch Milka BujnÇakova und Monika HrusÇkova besonderen Wert. Die beiden haben die Furche von KosÇice in der Ostslowakei in das 70 Kilometer nördlich liegende Lipany und in die dortigen Roma-Siedlungen mitgenommen. Auf der Fahrt erklären die CaritasSozialarbeiterinnen die Aggressionen, die ein Großteil der Slowaken gegen die Roma hegt. Dieser Hass sei das "Resultat der schlechten Sozialpolitik der Regierungen seit der Wende". Allein mit Sozialhilfe und Kindergeld glaubten die Politiker, sie könnten sich das ungeliebte Problem vom Halse schaffen. Das Gegenteil war der Fall: Den Roma war nicht geholfen, aber der Groll der "Weißen" wurde immer größer.
Diskriminierte Weiße?
Auch wenn sein "Königshaus" großteils von Roma-Kindern besucht wird, die dort nach der Schule betreut werden, kochen, nähen oder auch tischlern lernen können - für den Caritas-Direktor im tschechischen Jihlava, Petr Svíka, sind er, seine Mitarbeiter und das ganze Projekt für alle sozial benachteiligten Gruppen in der Stadt da. Gerade im Ausspielen dieser Armen gegen jene sieht er die größte Gefahr. Und hier spiele auch die EU, laut Svíka, keine besonders gute Rolle: "Weiße Tschechen sehen sich von der EU allein und im Stich gelassen, hingegen die Roma werden sehr wohl massiv unterstützt."
Während der Direktor ins Politisieren kommt, sitzen Roma-Kinder einen Stock höher an den Nähmaschinen. Und auch in Lipany, in Ardud, in Turulung wird genäht. Genauso wie in Liavada, Carei, Baia Mare, StaÆna ... Ein Netz mit sehr vielen Fäden - irgendwann, hoffentlich sehr bald, wird es stark genug sein, um die Roma zu halten.