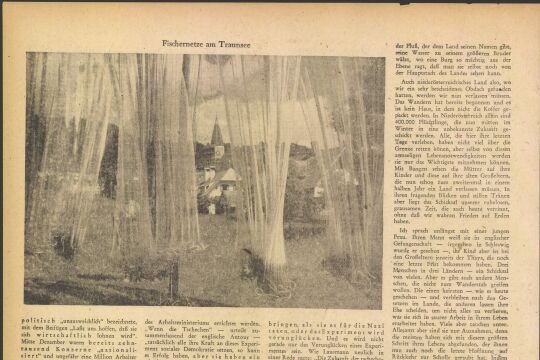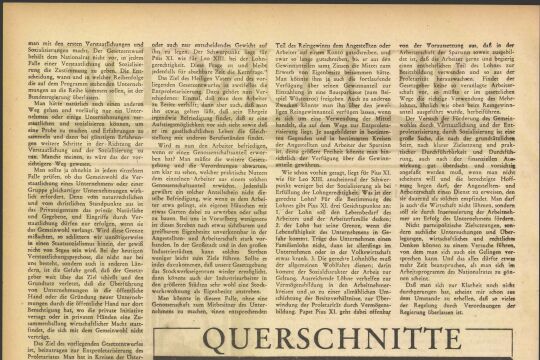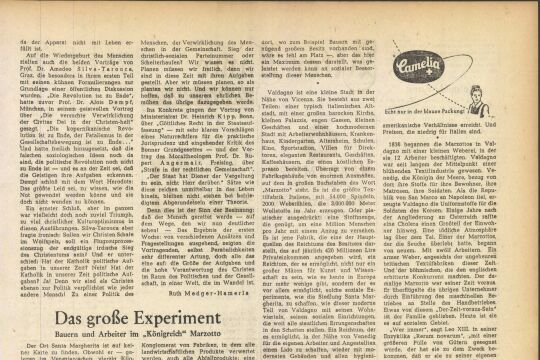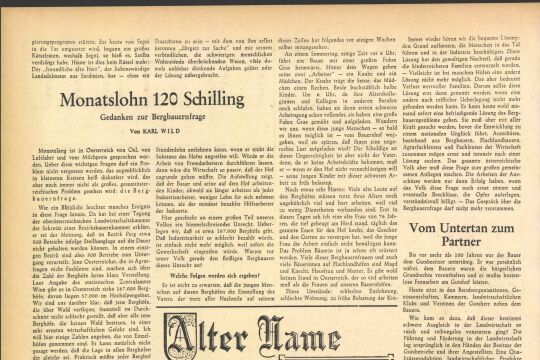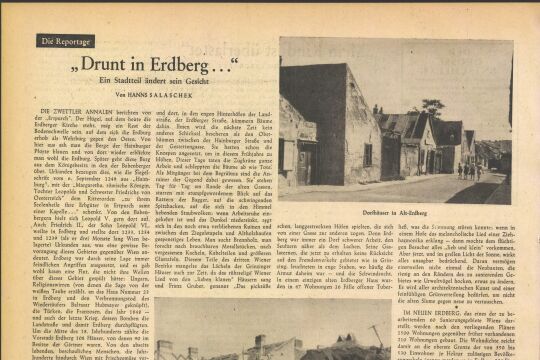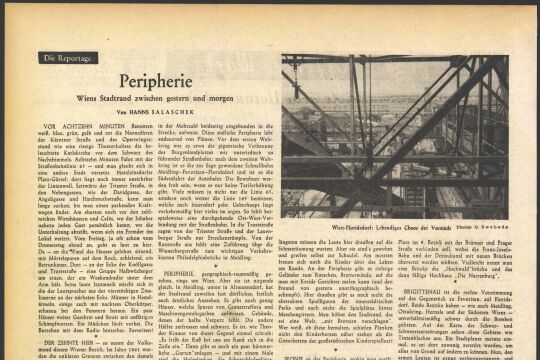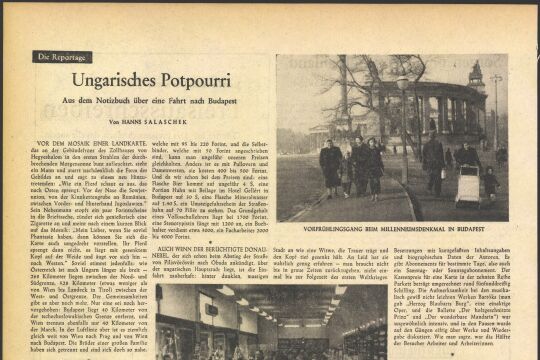Amnesty International hat gerade eine Kampagne für die Menschenrechte der Sinti und Roma in ganz Europa gestartet. Gerade in Ungarn steht es damit nicht zum Besten. Es gibt aber auch positive Entwicklungen, wie ein Experiment in Nordostungarn zeigt. Dort rettet die Ansiedlung von Romafamilien Siedlungen vor dem Verfall.
Jeden Morgen, wenn er aufwacht, freut sich István Samu. Manchmal kann er sein Glück gar nicht fassen. Er kann die Vögel zwitschern hören und im Sommer zieht der Duft frischer Kräuter aus dem Garten herein. Noch vor wenigen Jahren war an ruhige Nächte und sanfte Düfte nicht zu denken. Er teilte mit seiner Frau Borbala und fünf Kindern ein enges Zimmer in der Industriestadt Ózd, unweit der Nordostgrenze zur Slowakei. Sechs erwachsene Kinder haben sich schon selbstständig gemacht. Jetzt lebt die Familie in einem alten Bauernhaus, dessen geräumige, mit Teppichen ausgelegte Zimmer ein wenig an das Innere eines Nomadenzelts erinnern. Auch wenn unangekündigt Besuch kommt, herrscht fast übertriebene Ordnung. Die Stoffblumen, die auf Häkeldeckchen jeden Tisch dekorieren, machen den Eindruck, als würden sie jeden Tag abgestaubt. Kein Spielzeug liegt herum. Selbst die Fenster wirken frisch geputzt.
Im Nordosten erhebt sich hinter dem Dunst das Mátra-Gebirge, wo der mit knapp über 1000 Metern höchste Punkt Ungarns liegt. Nach Süden breitet sich die große ungarische Tiefebene aus, das landwirtschaftliche Kernland. Die Samus waren eine der ersten Romafamilien, die vor drei Jahren im Dorf Erk, rund 100 Kilometer nordöstlich von Budapest, angesiedelt wurden. „Wir hatten von dem Programm gehört und uns beworben“, sagt der schnauzbärtige István, dessen leicht angegrautes Haar fast militärisch kurz geschnitten ist. „Es wurde überprüft, wie wir lebten. Wir haben uns vorgestellt und der Bürgermeister fand uns wohl sympathisch.“
Der Bürgervertrag
Bürgermeister Béla Meleghegyi hat alle Familien, die aufgenommen wurden, selbst begutachtet: „Jeden nehmen wir nicht.“ Und alle müssen einen Vertrag mit der Gemeinde unterschreiben, in dem die Regeln für das Zusammenleben festgelegt sind: Haus und Garten sind in Ordnung zu halten, die Kinder müssen die Schule besuchen und angebotene Arbeiten dürfen nicht abgelehnt werden. Meleghegyi spricht es nicht aus. Aber die Roma haben den Ruf, arbeitsscheu und verwahrlost zu sein. Kinder wachsen oft ohne jede Ausbildung auf. Die rechte Jobbik, eine faschistische Partei, die nach den Wahlen im April erstmals ins Parlament einzog, schuldet ihren Aufstieg vor allem der Hetze gegen „Zigeunerkriminalität“. In Erk habe man aber die besten Erfahrungen, versichert Meleghegyi. Schon vor dem Zuzug von sechs Familien zählte fast die Hälfte der kaum 1000 Einwohner zur größten Minderheit Ungarns. Anpassungsschwierigkeiten gebe es natürlich, echte Probleme aber nicht. Die soziale Kontrolle in der kleinen Ortschaft funktioniert.
Bürgermeister Meleghegyi, der mit seinen 68 Jahren der alten Ordnung noch durchaus positive Aspekte abgewinnen kann, gehört nicht zu jener Kategorie, die meist abfällig als „Gutmenschen“ bezeichnet wird. Wenn es nach ihm ginge, würde Sozialhilfe für arbeitsfähige Menschen abgeschafft. Die Aufnahme von kinderreichen Familien hat keine karitativen, sondern handfeste ökonomische Gründe: „Wenn zu wenige Kinder in die Schule gehen, dann streicht der Staat seine Zuschüsse und die Schule muss zusperren. Ist die Schule einmal weg, dann dauert es nicht lang, bis auch das Postamt schließt. Wenn es keine Post mehr gibt, dann macht auch der letzte Lebensmittelladen dicht. Das Dorf ist tot.“ Vor ein paar Jahren war man schon fast so weit. Erk zählte vor der politischen Wende 1800 Einwohner. Den Tiefpunkt erlebte das Dorf vor acht Jahren. Da lebten gerade noch 800 Menschen hier. Meleghegyi: „Die jungen Leute zogen nach Budapest und kamen nicht mehr zurück“. Auch seine eigene Familie macht da keine Ausnahme: Die einzige Tochter lebt in der Hauptstadt und zeigt keine Absicht, zurückzukehren.
Zerbrochene Hoffnungen
Erk liegt in Heves, einem der ärmsten Komitate Ungarns. Dort musste man erleben, dass mit Freiheit und Demokratie auch der wirtschaftliche Niedergang einsetzte. Das alte System funktionierte nicht mehr und die Segnungen des neuen kamen nicht bis Heves. Die neue Industrie, die Autohäuser, die großen Supermärkte und Fertigungsindustrien konzentrieren sich im Westen. Die Genossenschaft, die Paradeiser, Paprika und Schweinefleisch für den sowjetischen Markt produzierte, ist längst weg. Kleinbauern gibt es praktisch nicht. Früher hatte aber fast jedes Haus eine Kuh oder ein paar Schweine.
Die Ortschaft wirkt arm, aber nicht heruntergekommen. Ein Denkmal des Heiligen Stephan, der Ungarn vor 1000 Jahren christianisierte, darf ebenso wenig fehlen wie Gedenksteine für die Weltkriegsopfer. Die ebenerdigen Häuschen sind alt, aber nicht verwahrlost, die meisten Gartenzäune frisch gestrichen.
Eigentlich stand nicht die Idee der dörflichen Entwicklung am Anfang. „Wir kümmerten uns viel um Obdachlose in den Städten“, erzählt Miklós Vecsei, stellvertretender Leiter des Malteserritterordens in Ungarn. In den Parks an der Peripherie Budapests kann man Familien antreffen, die dort seit Monaten kampieren. Vecsei hat sich um solche Leute gekümmert: „Man findet da zerbrochenen Hoffnungen“. Arbeit finden die wenigsten. Viele sind auch auf der Flucht vor staatlichen Sozialarbeitern, denn sie fürchten, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. Vor etwa fünf Jahren traf Vecsei einen Mann aus der Ortschaft Tarnabod. Der wollte gerne zurück in sein Dorf. Doch wartete dort weder eine Wohnung noch ein Job auf ihn. Die Malteser begleiteten den Mann in seine Heimatgemeinde. Vecsei: „Das Dorf war in erbärmlichem Zustand, aber es gab viele Häuser zu verkaufen.“
Ein Bus als Jobmotor
Tarnabod, nur zwölf Kilometer entfernt von Erk, liegt in einer Art Sackgasse, die vom öffentlichen Verkehr nicht angesteuert wird. Der Ort selbst hatte keinen eigenen Wirtschaftsbetrieb. Ein Ansiedlungsprogramm konnte also nur funktionieren, wenn gleichzeitig die Strukturprobleme des Dorfes gelöst würde. „Der Malteserorden hat nicht viel Geld“, sagt Vecsei, „deswegen müssen wir der größtmöglichen Effekt mit den geringsten Mitteln erzielen.“ Allein der Ankauf eines Busses, der den nächsten Bahnhof und die Hauptstraße anfährt, konnte binnen kürzester Zeit 33 Menschen zu Jobs in umliegenden Industriebetrieben verhelfen. Für den Ankauf von Häusern schoss der Staat ein paar Millionen Forint zu. So konnten zwölf obdachlose Familien angesiedelt werden.
Eine der neuen Romafamilien hat eine Ziegenzucht aufgezogen und produziert inzwischen Ziegenkäse, der im Ort reißenden Absatz findet. Andere interessieren sich für Tipps für Viehzucht und Ackerbau, die ein pensionierter Landwirt regelmäßig gibt, um die kleinräumige Landwirtschaft wiederzubeleben. Größter Arbeitgeber ist immer noch der Bürgermeister, der alle, die sonst keinen Job kriegen, zum staatlichen Mindestlohn für gemeinnützige Arbeiten einstellt. Wenn die Zuwanderer eines Tages auf eigenen Beinen stehen können, wird man wohl sagen können, dass das Experiment wirklich gelungen ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!