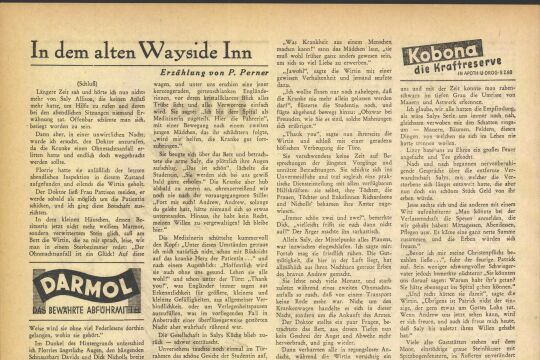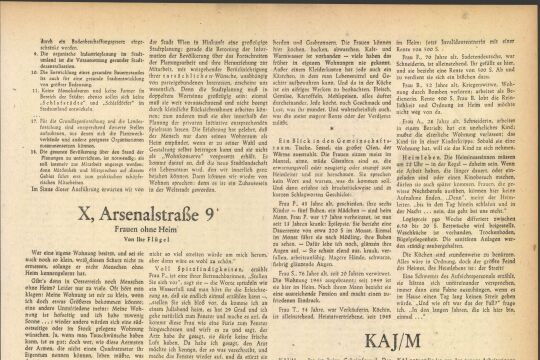Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sie brauchen Hilfe
Die Informationen über die Lage in Rumänien waren widersprüchlich. Wir wußten nur eines, daß Hilfe umso sinnvoller wäre, je schneller sie gegeben würde. Wir entschlossen uns daher sehr spontan, zu einem „Lokalau-genschein" nach Sinnicolau-Mare, nach Groß St. Nikolaus, zu fahren. Wir wollten vor Ort nach Gesprächen mit den Betroffenen herausfinden, was nun die effektivste Hilfe wäre.
Quer durch Ungarn kommen wir an die rumänische Grenze. Der Unterschied zu früheren Grenzkontrollen ist frappant. Freundliche und höfliche Grenzbeamte, keine Fragen. Innerhalb von 15 Minuten haben wir die Grenze hinter uns.
In Arad dann aber bedrückende Bilder. Tiefe Löcher auf den Straßen, auf- und abwallende „Täler", in denen Straßenbahnschienen verlaufen, löchriges Kopfsteinpflaster, unfertige, noch nicht verputzte Häuser, die aber schon bewohnt werden, ringsherum bis zur Straße keine befestigten Wege, sondern nur Erde, Mist, Papiere, Steine und streunende Hunde. Nach zweimaligem Fragen schaffen wir es dann, sogar, auf die richtige Straße nach Groß-St. Nikolaus zu kommen...
Wir sind eine halbe Stunde zu spät, aber unser Empfangskomitee begrüßt uns sehr herzlich. Im Volkshaus erwartet uns der Bürgermeister mit einigen Mitgliedern des neugegründeten Revolutionskomitees. Nach der Begrüßung im Sitzungssaal beginnt der Ortsvorsteher den Ort vorzustellen, mit Zahlen und Fakten. Er spricht von der neuen Situation, der Verbesserung der Energiesituation durch Eigeninitiative, der Kirchweihe, die die Gemeinde als Brauchtum zu erhalten sucht, von den landwirtschaftlichen Betrieben des Ortes, vom Reitklub und vom Schwimmbad mit olympischen Ausmaßen.
Wir sind im falschen Ort!!! Wo ist die Armut, die Hilfsbedürftigkeit, das offensichtliche Fehlen des Notwendigsten? Wir überlegen schon, in welchem Dorf wir am Rückweg anhalten und unsere Lebensmittel abladen können. Diese Leute hier sind nicht reich, aber sie haben eben das Notwendigste.Bis dann langsam ein neuer Ton aufkommt. Da und dort mangle es an Lebensmittel, die Landwirtschaft funktioniere bis jetzt nur auf dem Papier gut, das man nach Bukarest geschickt habe. In Wirklichkeit wäre die Versorgung katastrophal. Das gelte praktisch für jeden Bereich, für Kleidung ebenso wie für Energie. „Wir sind jahrzehntelang angehalten worden, Armut und Mängel nicht einzugestehen, darum fällt es uns jetzt so schwer, über die Dinge offen und objektiv zu reden".
Dr. Wolf, ein Arzt, beginnt zu sprechen. Es wäre alles zu ertragen, mit der Hoffnung und dem Wissen, daß jetzt alles besser wird. Aber mit aller Bereitschaft zu improvisieren, die fehlende medizinische Versorgung könne nicht ersetzt werden. Es gäbe Ärzte, ein Krankenhaus mit einem Einzugsgebiet von 60.000 Menschen, Krankenwagen und eine Poliklinik (Ambulatorium). Aber keine Medikamente, keine Spritzen, kein Verbandszeug. Die wenigen medizinischen Geräte seien veraltet oder nicht funktionsfähig. Ich überreiche nun den Brief des Bürgermeisters,'In dem der Zweck unseres Besuches kurz beschrieben wird. Wir wollen jetzt helfen und vielleicht später eine Partnerschaft von Gemeinde zu Gemeinde eingehen. Im anschließenden Gespräch arbeiten wir gemeinsam die Schwerpunkte heraus, wo mit Hilfsaktionen anzusetzen wäre: • Wir wollen mit Medikamenten und medizinischen Geräten helfen, • wir werden Gemüsesamen besorgen und verteilen lassen und
• wir werden beim nächsten Besuch Möglichkeiten untersuchen, Kinder für einige Zeit in Familien in Maria Enzersdorf aufzunehmen.
Wir beschließen, die restliche Zeit, die uns noch bei Tageslicht bleibt, dazu zu nutzen, uns Apotheke, Poliklinik und Spital anzusehen und sind fassungslos über den Schmutz in Untersuchungs-, Kranken- und Laborräumen. Im Zahnlabor stehen die Technikerinnen und Assistenten in Mänteln herum und frieren. Sie haben kein Material für ihre Arbeit, statt Glas ist in manchen Fenstern Plastikfolie eingeklebt.
In einem Labor stehen drei Mikroskope, zwei funktionieren nicht, eines ist über 50 Jahre alt und mit Leukoplast zusammengeklebt. Wer von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden will, muß zuerst Benzin für den Krankenwagen ins Spital schicken und eigene Medikamente mitnehmen, die er über Verwandte oder Bekannte aus Ungarn, Jugoslawien oder dem „Westen" beschafft hat. Es gibt keine Spritzen, kaum Infusionen.
Die Intensivstation ist ein kleiner Raum mit nur einem Bett und nur einer Sauerstoffflasche mit Gummischlauch. Der führt in die Nase des Patienten. Neben dem Bett sitzt seine Frau und wartet, ob er stirbt oder nicht. Mehr können die Ärzte auch nicht tun. Die beiden „Operationssäle" sind mit vorsinftflutli-chen Tischen ausgerüstet. Wir kommen zur Essenszeit. Krautfleisch. In einem schwarzen Plastikkübel.
Die Leiterin des Kinderspitals erzählt uns, daß manche Mütter so arm wären, daß sie einen falschen Namen und Adresse angeben und nach der Geburt so schnell wie möglich verschwinden. Ihr Kind blieb dann im Spital und wurde früher nach einiger Zeit in die Waisenhausorganisation eingeliefert.
Wir laden unsere Mitbringsel aus und übergeben sie dem Kinderspital. Freude und Dankbarkeit. Ein Mitglied des Revolutionsrates holt die Fahne von der Fassade des Krankenhauses, mit Loch und Trauerflor für die Opfer der Kämpfe. Sie wird uns feierlich übergeben. Wir sollen sie nach Hause mitnehmen und herzeigen. Als Zeichen für ihre Dankbarkeit. Die anderen Dinge fallen uns nicht mehr auf. Wir beachten kaum mehr die kleinen Unzulänglichkeiten, die fehlende Seife, das nichtvorhandene Klopapier, die leeren Geschäfte.
Zum Abschluß werden wir zu einem Essen eingeladen. Wir fahren an der Kirche vorbei. Der Pfarrer ist noch immer nicht da. Er segnet Häuser (Dreikönig). Wir Werden ihn nächstes Mal sehen.
Das Essen ist beschämend für uns: vier Gänge, Wein und Mineralwasser. Aber während des Essens gehen sie aus sich heraus, springen über ihren eigenen Schatten, erzählen über die Revolution, wie alles begann in Temesvar, wie 500 Leute Pfarrer Läszlö Tökes schützten, indem sie eine Menschenmauer um sein Haus bildeten und dann eventuellen Fragern erzählten, sie warteten auf die Straßenbahn.
Sie erzählen von den Greueltaten der „Securitate". Von dem Waisenhaus für den Conducator, wo er sich Kinder mit seiner Blutgruppe hielt, um sich mit deren Blutspenden monatlich sein Blut gegen junges Blut tauschen lassen zu können. Von Korruption und Bespitzelung. Aber dann auch von der Zukunft, von den Möglichkeiten in einer demokratischen Umgebung, von ihrem Arbeits- und Einsatzwillen für das Vaterland, das im Moment nur Rumänen kennt, und keine ungarischen oder deutschen Volksgruppen. Von der Hoffnung auf Hilfe von außen. Der Mann neben mir hat Tränen in den Augen. Ich auch.
Der Autor ist Mitglied des Gemeinderates von Maria Enzersdorf bei Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!