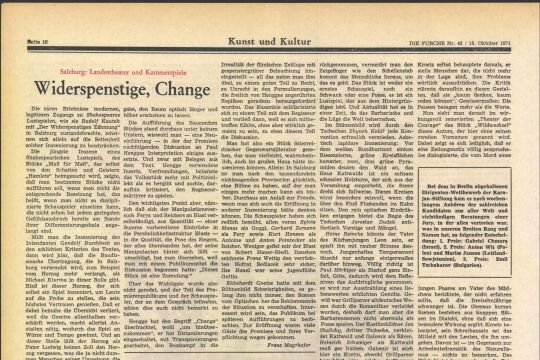Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tischen im Trüben...
Es hat ihn schon hart getroffen, den „Orleander“ (von dem immer intensiv agierenden Donald Grobe dargestellt), seines Zeichens Ehegatte der schönen „Melusine“: Da hat er also eine junge, bildschöne Frau, aber heißes Wasser zum Rasieren bekommt er nicht, um die Zubereitung des Frühstücks drückt sich die Gnädige, und Jungfrau ist sie nach sechs Monaten Ehe auch noch. Denn Melusine ist ihrem Grafen nicht zugetan. Das hat man davon, wenn man sich mit einem Wesen einläßt, das weder Fisch noch Fleisch, oder vielmehr beides zugleich ist.
Aribert Reimann war nicht gut beraten, als er sich dem Melusine-Stoff von Yuon Göll zuwandte. Claus H. Henneberg verfaßte ein Libretto, das recht frei mit der Prosa Gölls verfährt (der Arie des Grafen ist beispielsweise ein Lyriktext Gölls unterlegt). Dieses Libretto ist Beispiel für ein gedankenträchtiges Wollen, dem die sinnvolle Realisierung fehlt.
Reimann ist einer unserer hoffnungsreichsten, begabtesten, zeitgenössischen Komponisten, aber er ist kein Mozart, der den Text durch seine Musik so adeln könnte, daß man darüber die Platitüden vergessen würde, doch ist die Partitur der einzige Lichtblick, hier gibt es stimmungsvolle Passagen zu den Szenen im Park, ein fluktuierendes Flötensolo (von Max Hecker virtuos gespielt) zur Beschwörung des Weidenbaumes, in dem sich Pythia verbirgt und es gelingt Reimann, die Künstlichkeit des Wesens „Melusine“ durch die artifizielle Technik der Koloraturen zu versinnbildlichen. Im Kontrast dazu, wirken dann die stilleren Momente, in denen „Melusine“ menschlich lieben darf, sehr zart, sehr verinnerlicht. Nach diesen wohltuenden Zäsuren ist Aribert Reimann allerdings einer pseudomythologischen Anwandlung zum Opfer gefallen und die pathetisch aufgeblasene Götterdämmerungsstimmung beim Brand des Schlosses bringt ihn beinahe um den letzten Rest der Glaubwürdigkeit.
Völlig im Trüben fischte Helmut Käutner als Regisseur. Dabei ist ihm eine recht gute Ausstattung zu danken. Seine Bühnenbilder haben Atmosphäre, die kubistisch verfremdeten Bäume sind originell, die Drehbühne hat ihm sichtlich Freude bereitet, die Spiegel der Wasserfläche tun ihre Wirkung (in erster Linie für die Zuschauer in den Ranglogen) und im übrigen setzt er auf Jugendstil — warum sollte Käutner da eine Ausnahme machen? Wo aber bleibt eine Regiekonzeption? „Melusine“ ist nicht als märchenhaftes Wesen zu identifizieren, ihre Bewegungen haben etwas Hilfloses („einmal hin, einmal her, rundherum das ist nicht schwer...“), vom 2. zum 3. Bild muß durch die Türe springen, um sie beim nächsten Einsatz im Schaukelstuhl zu sitzen (was für ein Einfall!). Wäre Slavka Taskova nicht von der Natur so großzügig mit femininem Zauber bedacht worden, könnte man diese Bühnenfigur für irgend ein launisches Mädchen mit Blumentick halten, denn Blumen muß sie bei Käutner immer mit sich herumtragen, möglichst Wasserpflanzen natürlich.
Geradezu peinlich der Auftritt des Maurers (Karl Helm) — ein soziologischer Fauxpas ersten Ranges! Und Martha Mödl, diese immer großartige Frau, ein Jammer, sie als Miniatur-tragödin sehen zu müssen. Käutner kommt doch vom Kabarett, warum fand er nicht den Mut, eine Groteske aus diesem Stück zu machen, warum hat er es inszeniert wie das siebente Weltwunder?
Als ruhender Pol steht Ferdinand Leitner am Dirigentenpult, er ist der Garant für die Qualität der musikalischen Wiedergabe. Die Münchner Philharmoniker haben den komplexen Orchesterpart mit der viel Fleiß und Hingabe erarbeitet, aber man merkt ihnen die Mühe noch an. Leitner versteht es, auch noch in den extremsten Passagen präzisen Kontakt mit den Sängern zu halten und er führt sie durch ein beinahe unentwirrbares Tongestrüpp. Faszinierend wie Slavka Taskova ganze Kaskaden von Spitzentönen über die Rampe feuert, aber auch Clifford Billions (Architekt) gibt bestechende Koloraturen von sich, Barry MacDaniel (Graf) färbt Atonales nobel ein, Gudrin Wewezow (Madame Lape-rouse) hat im 1. Bild starke Momente und Kieth Engen sorgt als Oger doch wenigstens für etwas Feuer aus der Hexenküche. Der anwesende Komponist und Helmut Käutner mußten einige Buhrufe hinnehmen, für Leitner und die Taskova gab es Ovationen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!