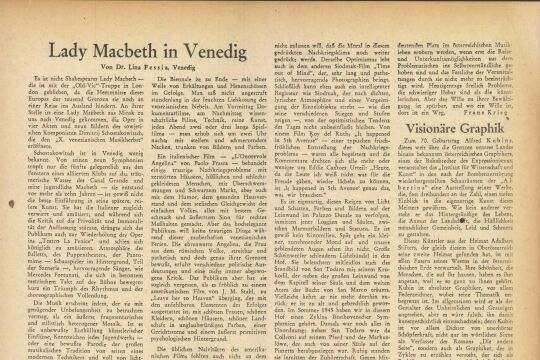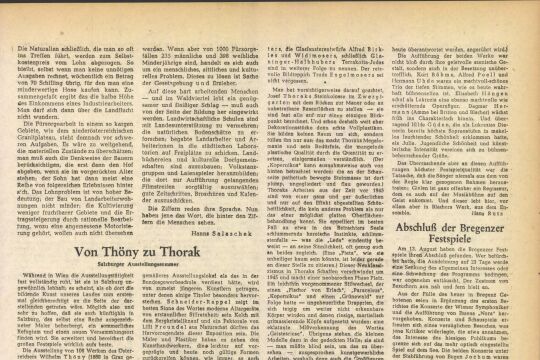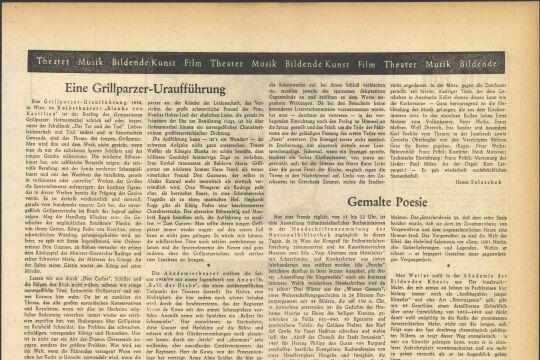Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Melusine verzaubert alle
Die Rehe fressen Vergißmeinnicht aus ihrer Hand. Goldschuppige Schlangen küssen Ihre Füße. Im Grund ihrer Augen, so wähnt Bi®, wachsen Dotterblumen. Und den Wind fängt sie in ihrem Haar. Melusine verzaubert alle. Der Geometer, der den Park vermessen soll, in dessen perlglitzemdem Gras sie badet, stürzt in den Tod. Den Maurer, der das Schloß des Grafen in ihrem Paradies bauen soll, treibt sie in den Wahnsinn. Der Architekt verläßt ihretwegen Frau und Kinder. Jungfräuliche Gattin, Nixe, Undine, Me- lisande halb und halb Lulu, vermag sie, deren Unschuld durch einen Fischschwanz beschützt wird, die Rechte der Natur zu verteidigen, solange sie keinem Mann verfällt. Die Tristannacht mit dem Schloßherrn bringt die Katastrophe. Pythia, die Beherrscherin der Naturgeister, besteigt den Scheiterhaufen. Der Brand vernichtet das Schloß und die Liebenden.
Die Banalität des Alltags und die Verzauberung durch die Natur, das Prosaische und die reine Poesie, Wirklichkeit und Geheimnis, Faßbares und Traum — preziöse Lyrik, surreal durchtränkt, Märchen mit Bildern wie Lianen: Yvan Golls Schauspiel „Melusine”, zwischen 1922 und 1930 geschrieben, wurde von Claus H. Henneberg mit großem Geschick zum Operntext gefiltert. Aribert Reimann, Berliner des Jahrgangs 1936, komponierte ihn im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks, die Deutsche Oper Berlin bracht die Uraufführung zur Eröffnung der Schwetzinger Festspiele.
„Melusine” negiert die Bestrebungen der Avantgarde ganz, „Melusine” ist Oper und nichts als das, und sie kommt auch mit einer ganz normalen Orchesterbesetzung aus. Reimann setzt auf die musikalische Poesie, auf die Verzauberung durch Theater. Dazu gehört schon fast Mut. Reimann kann ihn sich leisten. Ist der erste Teil des vieraktigen und mit Pause nur stark zweistündigen Werks noch eher enttäuschend, so fesselt der zweite ungleich stärker. Reimann hebt die Opemwelt nicht aus den Angeln, aber er erhebt sich durch seine persönliche Sprache weit über den Durchschnitt. Er resümiert die musikalischen Erfahrungen dieses Jahrhunderts von Debussy über Berg bis hin zu Zimmermann, aber die Vorbilder werden immer über die Zitatenhaftigkeit zu Eigenem verschmolzen.
Als ob Reimann vor der schieren irisierenden Schönheit ä la Henze zurückgeschreckt sei, klingt die Naturpoesie des Beginns noch recht grobkörnig. Vielleicht ist auch die allzu direkte Umsetzung durch den Dirigenten Reinhard Peters und das Sinfonie-Orchester des Süddeutschen Rundfunks mit schuld daran. Klar wird bald: die Rezitativik der bürgerlichen Welt (der Tenor Donald Grobe als Melusines Mann und die Mezzosopranistin Gitta Mikes als ihre Mutter deklamieren präzis) hebt sich von Melusines ätherisch- ariosen Koloraturgirlanden wirkungsvoll ab. (Catherine Gayer, von gläsern-nixenhafter Kühle, windet sich an ihnen bis in die Regionen ums hohe F betörend entlang — eine hinreißende Leistung.) Die Bereiche des musikalischen Zierats verläßt sie erst im zweiten Teil, wenn sie mit dem Grafen ihre erste wahre, Geistergesetzen zufolge todbringende Liebe erlebt.
Hier zeigt sich die Sensibilität des ausgeprägtesten Liedkomponisten der jungen Generation, der eminent sangliches, aus dem Dialog wachsendes Melos zu schreiben vermag. (Alle künftigen Sänger des Grafen werden sich an dem wunderbaren lyrisch-baritonalen Wohllaut Barry McDaniels zu messen haben.) Das Orchester spricht hier, auf Harfe und wenige Holzbläser reduziert, eine Sprache der reinen Poesie, die sich von der blechunterlegten Dramatik abhebt, die Pythia umgibt — eine, Prachtpartie, Straußens Amme aus der „Frau ohne Schatten” verwandt, in den komödiantischen theatralischen Momenten Martha Modi wie angegossen. So wie ihr Geistergenosse Oger, ein Vetter des Wassermanns aus Dvoraks „Rusalka” und des Schigolch aus Bergs „Lulu”, Josef Greindl genau angepaßt ist.
Es ist keine Sensation aus Schwetzingen zu melden, aber die Zustimmung des Premierenpublikums galt einem Werk, das nachgespielt zu werden verdient. Vielleicht sollte ein kommender Bühnenbildner eine mehr der „Pelleas”-Welt angenäherte Lösung versuchen, als Gottfried Pilz sie intendierte. Er ersetzte, der artifiziellen Faktur von Text und Musik folgend, den verwunschenen Park durch eine kunstvoll-künstliche Holzgitter-Komposition. Die Verzauberung wollte sich so der Inszenierung Gustav Rudolf Sellners nur bedingt bemächtigen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!