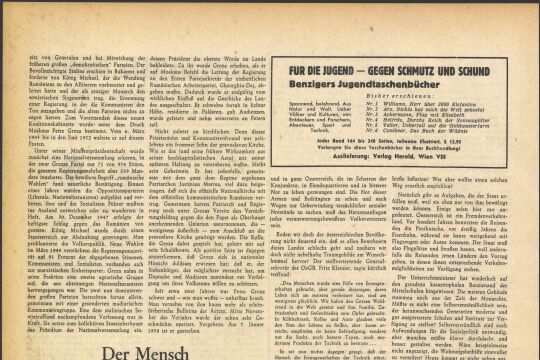Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wirtschaft — Dienerin des Menschen
Die Aufgabe einer kulturpolitischen Wochenschrift ist es nicht allein, am Jahresende eine Bilanz der Produktion und des Konsums zu ziehen und eine Prognose für den Konjunkturablauf des nächsten Jahres aufzustellen, sondern sich zu fragen, ob denn die Wirtschaft ihren Zweck, Dienerin des Menschen zu sein, erfüllt hat.
Die Wirtschaft ist ja nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Sie hat zwar ihre Eigengesetzlichkeiten, ist aber kein selbständiger Bereich, sondern ein Teil der gesamten Lebensordnung und als solcher den allgemeinen Grundsätzen der Moral und der Menschlichkeit unterworfen.
Die Wirtschaftsordnung soll Freiheit, Wohlstand und Sicherheit verbürgen. Angesichts der immer stärker werdenden Interdependenz aber führt jedes Übermaß der einen Forderung zur zumindest teilweisen Unerfüllbarkeit der anderen. Ein Übermaß an Freizügigkeit, aber auch ein übertriebenes Sicherheitsstreben kann uns den schwererworbenen, bescheidenen Wohlstand kosten.
Das ist nicht zuletzt auch die Lehre des zu Ende gegangenen Jahres. Der Staatshaushalt für 1961, den wir im Herbst 1960 nach Beilegung einer Regierungskrise beschlossen haben, war keine ausgeglichene Bilanz zwischen dem, was wir vom Staat verlangten, und dem, was wir dem Staat zu geben bereit waren. Man versuchte, dies durch Steuer- und Tariferhöhungen auszugleichen. Aber diese Kostenverteuerung setzte die Lohn-Preis-Schraube in Bewegung. Es ist müßig, jetzt zwischen Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften nach dem Schuldigen zu suchen. Wenn einmal die beiden für das Preisniveau entscheidenden Größen, die kaufkräftige Nachfrage und das Güter- und Leistungsangebot, nicht mehr übereinstimmen, sondern auseinanderklaffen, kann man das Übel nicht bei den Wirkungen, sondern muß man es bei den Ursachen bekämpfen. Das haben wir in den letzten
Wochen mit aller Energie versucht, und damit werden wir mit Hilfe der zu Jahresbeginn wirksam werdenden Zollsenkungs- und Liberalisierungsmaßnahmen auch Erfolg haben, wenn uns die Sozialpartner bei unseren Bemühungen unterstützen.
Wir sollten aber aus dieser Erfahrung auch eine Lehre ziehen: Seit der Unterzeichnung des Staatsvertrages hat sich das Verhältnis der österreichischen Staatsbürger zum Staat gewandelt. Vor 1955 gab es noch keinen souveränen österreichischen Staat, und in den Teilbereichen, in denen er funktionsfähig war, glich er einem „Pufferstaat" zwischen der Bevölkerung und den Besatzungsmächten. Er wurde in dieser Funktion von der Bevölkerung durchaus positiv gesehen und nur selten überfordert. Nach 195 5 aber verlor der österreichische Staat diese „Pufferfunktion“ und wurde scheinbar zum Gegenspieler der Bevölkerung. Ja manchmal hat man den Eindruck, als werde der Staat nur noch als anonymer Geldschrank gesehen, den zwar der Finanzminister bewacht, in den zu greifen sich aber fast jede Interessentengruppe berechtigt fühlt. Vergißt man denn, daß es sich bei den Ausgaben des Staates immer noch um jenes Geld handelt, das der Staat vorher bei uns eingenommen hat? Und vergißt man, daß nur bei einem stabilen Geldwert das Geld wirklich den Gegenwert unserer Güter und Leistungen repräsentieren kann?
Ich möchte deshalb zur Jahreswende den Wunsch aussprechen, daß wir alle erkennen mögen, daß wir und der Staat nicht nur außenpolitisch gesehen eine Einheit bilden, sondern auch wirtschaftspolitisch in letzter Instanz keine Gegenspieler sind. Wohl kann und muß es in der Demokratie Meinungsverschiedenheiten über die Verteilung des Sozialprodukts geben, nie aber dürfen wir uns darüber hinwegtäuschen, daß auch die geschickteste oder härteste Interessenpolitik nur die Aufteilung, nie aber die Größe des Sozialprodukts ändern kann. Um das letztere zu erreichen, nützt es nichts, wenn wir das Messer unserer Begehrlichkeit schleifen. Da hilft letzten Endes nur eines: Wir müssen dem Ruf unseres Gewissens folgen. Der Lerneifer der jungen Generation, das Arbeitsethos der Berufstätigen, das Haushaltenkönnen der Konsumenten, die Sparsamkeit und der Wille zum Eigentum sind nicht nur die Grundlage für die Vergrößerung des Sozialprodukts, sondern auch die Voraussetzung für eine bessere Gesellschaftsordnung, wie sie uns die päpstliche Enzyklika „Mater et magistrą"so deutlich vor Augen stellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!