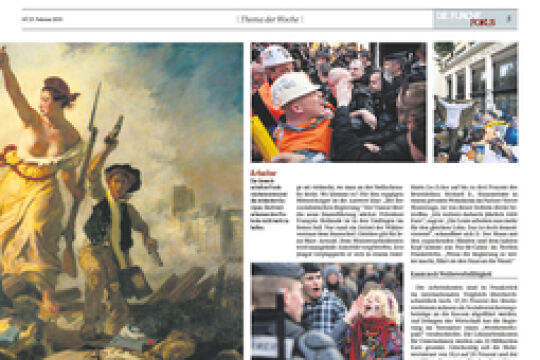Bevor sich die EU-Regierungschefs Deutschland und Frankreich beugen, sollten sie bedenken, dass die Wünsche Merkels und Sarkozys die Ungleichheit unter den Staaten befördern könnten, anstatt sie zu bekämpfen.
Als junge, begeisterte Europäer im Mai des Jahres 2000 andächtig den Vorträgen des damaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer lauschten, da wurde ihnen warm ums Herz. Die Europäische Union, so sprach Fischer, solle endlich vom Staatenbund zur echten Föderation werden, ein gemeinsamer Raum nicht nur der Wirtschaft und des Rechts, sondern auch der Politik solle entstehen und so die "Finalität“ der europäischen Idee setzen.
Seit Herbst 2010 tragen Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und ihr Amtskollege Nicolas Sarkozy aus Frankreich ebenfalls große Worte wie Einheit und Stabilität im Mund, wenn sie von der europäischen Wirtschaftsregierung sprechen. Doch sind sie von jenem Geist geleitet, dem Joschka Fischer damals anhing?
Vereinigte Staaten von Europa
Dem ersten Anschein nach ja. Selbst der sonst eher zurückhaltende Chef der europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet hält aufgrund von Merkels Initiative die "Vereinigten Staaten von Europa“ für denkbar. Merkels Plan sieht nämlich vor, die Wirtschafts- und Steuerpolitik der EURO-Staaten viel stärker als bisher zu koordinieren.
Etwa solle in allen Ländern ein gleiches Pensionsantrittsalter gelten. Ferner sollten Lohnerhöhungen nicht mehr (wie in einigen Staaten, Spanien, Belgien üblich) an die Inflationsentwicklung gekoppelt sein. Die Schuldenbremse solle in den Verfassungen verankert werden. Bei Unternehmenssteuern solle es auch keinen Wettbewerb geben, bei dem das eine Land ein anderes durch niedrigere Steuersätze aussteche.
Das also sind die Maßnahmen, mit welchen Deutschland und Frankreich, den beiden "Lokomotiven“ Europas, ein harmonischeres Gemeinwesen der Staaten in Europa und eine stabile Eurozone vorstellbar sei. Das klingt berückend. Doch bei genauerer Betrachtung ergeben sich Zweifel an Machbarkeit und Sinn der Maßnahmen.
Das beginnt schon bei der grundsätzlichsten Frage: Ist es möglich per Gesetz ein Europa zu schaffen, in dem es weniger Unterschiede in Konkurrenzfähigkeit, Lohnniveau und Sozialsystem gibt? Und ist das überhaupt wünschenswert? Dazu ein Blick in das angeblich so einheitliche Vorbild Europas - die Vereinigten Staaten von Amerika: In den USA gibt es je nach Bundesstaat unterschiedliche Steuersätze, Pensionsregelungen, Verschuldungsraten und Lohnanpassungen. Selbst bei Steuern und Abgaben herrscht intensive Konkurrenz.
Keine Steuerharmonie
Allein die Umsatzsteuer schwankt von Bundesstaat zu Bundesstaat zwischen 2,9 und 8,5 Prozent. Sogar innerhalb der Staaten werden Unternehmer unterschiedlich belastet. Einzig die Einkommensbesteuerung ist Bundesangelegenheit.
Ähnlich vielfältig gestalteten sich auch die diversen Gesetzgebungen in der Europäischen Union. So versuchen Irland, Griechenland und die Slowakei, mit niedrigen Steuern Unternehmen anzulocken. Damit und mit niedrigeren Löhnen verschafften sie sich gegenüber den größeren Staaten einen Wettbewerbsvorteil. Würde nicht eine Harmonsierung der Gesetzgebung den gegenteiligen Effekt haben, als der von den Erfindern intendierte? Die ärmeren Staaten würden an Attraktivität verlieren, damit an Auslandsinvestitionen und an Wirtschaftskraft. Sie wären noch weniger als heute in der Lage, gegenüber den reichen Staaten aufzuholen.
Zwiespältig fällt auch die Analyse zur Entkoppelung von Inflation und Löhnen aus. Wenn die Inflationsrate nicht mehr automatisch ausgeglichen wird, geht das im Ernstfall zu Lasten der Arbeitnehmer. Bei den schon geltenden aktuellen Lohnkürzungen etwa in Griechenland (20 Prozent) würde die Entkoppelung nur zusätzlichen sozialen Sprengstoff bringen.
Die Bedenken werden auch nicht kleiner, wenn es an den Kernpunkt des Planes von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy geht: der Schuldenbremse. Demnach sollen alle Staaten der Eurozone sich in ihrer Verfassung zur Haushaltsdisziplin verpflichten. Intendiert war dabei, dass die reichen Staaten der EU nicht permanent für die Budgetsünder zur Kasse gebeten werden. Doch aus der Betrachtung der Vergangenheit lässt sich erkennen, dass die Realität nur zu oft über bestehende Gesetze hinwegrollt. Hatten nicht alle Länder, Spanien, Griechenland, Irland, auch durch die Ratifizierung des Maastrichtvertrages Haushaltsdisziplin gelobt? Alle diese Verpflichtungen befinden sich schon im Verfassungsrang. Warum sollte angesichts der Nichteinhaltung des alten Stabilitätspaktes ein neues Instrumentarium wirkungsvoller sein, zumal es 2002/2003 gerade Deutschland und Frankreich waren, die den Stabilitätspakt nach ihren Wünschen außer Kraft setzten.
Warum nicht Eurobonds?
Während man in Berlin und Paris über eine Wirtschaftsregierung nachdenkt, die höchst zweifelhafte Maßnahmen ins Werk setzen soll, wird eine möglicherweise sehr sinnvolle Maßnahme vollkommen außer Acht gestellt: Die Schaffung europäischer Staatsanleihen. Zu sehr fürchtet man da, doppelt zur Kasse gebeten zu werden, erst über den Rettungsschirm und dann über steigende Risikoaufschläge der Eurobonds, sollte Griechenland zahlungsunfähig werden. Während Letzteres eher wahrscheinlich ist, dürfte sich an der Bonität gesamteuropäischer Anleihen kaum etwas ändern. Schließlich: Auch Kalifornien steht am Rand der Pleite, und das seit 2004. Auf die Bonität und Risikobewertung von US-Bundesanleihen hat sich das überhaupt nicht ausgewirkt. Doch damit scheint sich in Berlin und Paris noch niemand auseinandergesetzt zu haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!








































































.jpg)