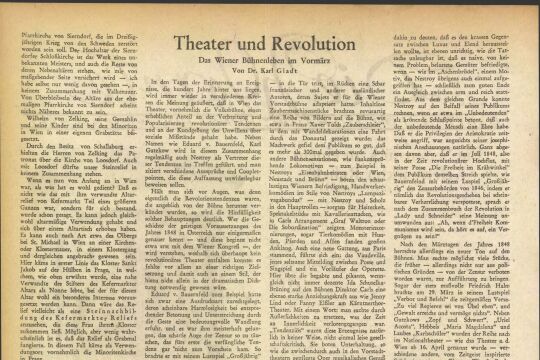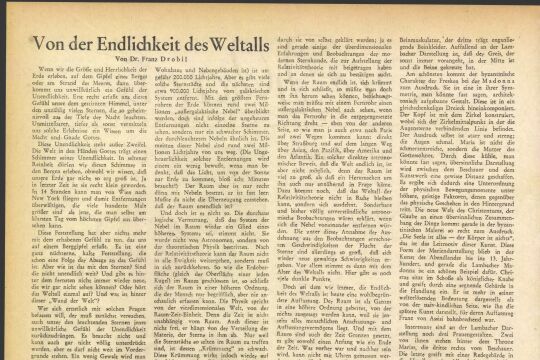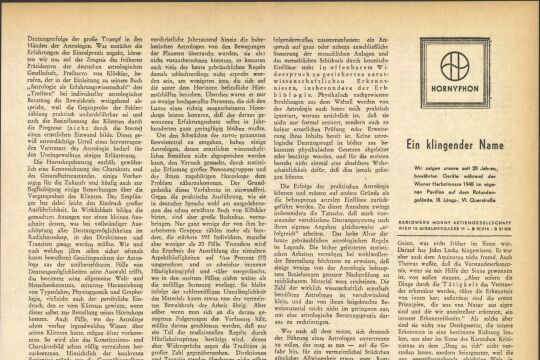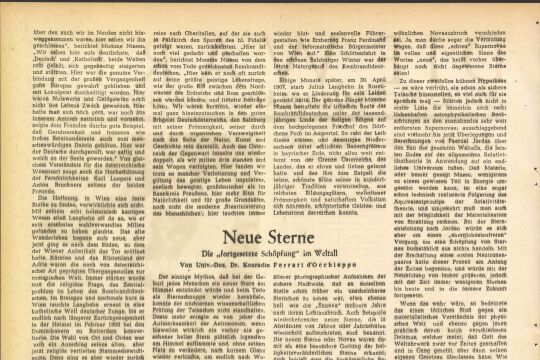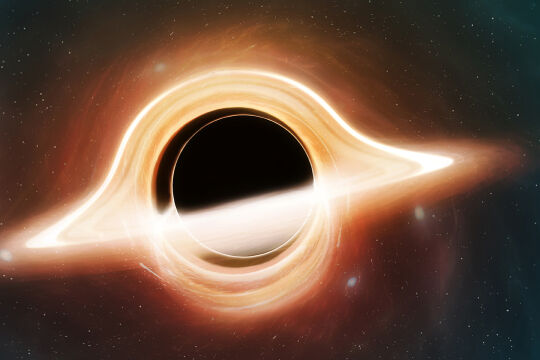Die Zukunft des Universums
Entstehen und Zerfall prägen den gesamten Kosmos. Angesichts dieser Dynamik versuchen Naturwissenschaften und Religion, die "Zeichen der Zeit" zu deuten, daraus Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen und Hoffnung zu schöpfen. Eine astrophysisch-metaphysische Betrachtung.
Entstehen und Zerfall prägen den gesamten Kosmos. Angesichts dieser Dynamik versuchen Naturwissenschaften und Religion, die "Zeichen der Zeit" zu deuten, daraus Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen und Hoffnung zu schöpfen. Eine astrophysisch-metaphysische Betrachtung.
Das naturwissenschaftliche Weltbild hat sich im 20. Jahrhundert tiefgreifend verändert. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts herrschte in der Astronomie die Meinung vor, der Kosmos bestehe seit unendlicher Zeit, ohne Anfang und Ende. Dann zeigten Beobachtungen, dass das Universum vor wenigen Milliarden Jahren entstanden ist. Gegen Ende des Jahrhunderts schließlich wurde immer deutlicher, dass im Grunde beides nicht stimmt. Kein Objekt im heutigen Universum ist im Urknall entstanden. Selbst die Materie bildete sich erst eine Millionstel Sekunde nach dem zeitlichen Nullpunkt. Die Sonne zum Beispiel hat nur ein Drittel vom Alter des Universums, und das menschliche Bewusstsein keimte erst vor wenigen hunderttausend Jahren auf. Die Voraussetzungen, dank derer sich die kosmischen Objekte wie Atome, Galaxien, Sterne bis hin zu Lebewesen bilden konnten, entstanden erst im Laufe der Zeit.
Allein in unserer Milchstraße sind gegenwärtig einige hundert Millionen Sterne am Entstehen. Die Geburt von Sternen und ihre Vorgeschichte dauern rund zehn Millionen Jahre. Rund zehn neue Sterne entstehen folglich pro Jahr in unserer astronomischen Nachbarschaft. Der Kosmos quillt von Fruchtbarkeit über.
Sterne entstehen in interstellaren Molekülwolken. An Orten, wo das Gas dichter ist als nebenan, zieht die Schwerkraft der Dichtefluktuation das umgebende Gas an. Dadurch wird die Verdichtung stärker und verleibt sich noch weiteres Gas ein. Die Materie konzentriert sich allmählich in dichten Wolkenkernen, bis diese unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. Dann fällt das Gas im freien Fall gegen das Zentrum der Kerns. Nach weiteren drei Millionen Jahren werden Temperatur und Dichte im Zentrum so groß, dass die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium einsetzt und Kernenergie in einem gewaltigen Ausmaß entfesselt wird. Der zusätzliche Gasdruck, der durch die neue Energiequelle entsteht, stoppt die Kontraktion. Im innersten Teil des Wirbels bildet sich ein Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und Gasdruck: der Stern ist geboren.
Kosmische Geburten Die Sternentstehung ist ein Beispiel, wie noch heute Neues entsteht. Das Werden hat jedoch eine Kehrseite: Zerfall und Tod. Wenn die Energie erschöpft ist, schrumpfen Sterne zu allmählich erkaltenden Weißen Zwergsternen oder explodieren als Supernova und schleudern einen Teil ihrer Materie und ihrer Schlacke ins interstellare Gas zurück. Dort bilden sich wieder neue Sterne. Aber die Generationenfolge ist kein ewiger Kreislauf, sie ermöglicht Entwicklungsschritte. Aus der Asche der früheren Sterngenerationen entstehen Planeten: etwas völlig Neues.
Wenn wir in einer klaren Nacht den Sternenhimmel betrachten und glauben, wenigstens die Sterne seien noch gleich wie früher, dann liegt dieser Einschätzung unsere zu kleine Zeitskala zugrunde. In Wirklichkeit entwickelt sich das Universum mit einer ungeheuren Dynamik. Das Entstehen von Sternen und die Bildung von Planeten stellen nur Teilprozesse dar, die auf früheren kosmischen Vorgängen wie der Materiebildung aus Quarks im frühen Universum und der Galaxien-Entstehung aufbauen.
Steht hinter dieser dynamischen Kreativität ein Schöpfergott? Seit mehr als zweihundert Jahren weisen Naturforscher immer wieder darauf hin, dass es diese Hypothese zur Erklärung der naturwissenschaftlichen Fakten nicht zwingend braucht (so etwa Pierre Simon Laplace im 18. Jahrhundert). Gewiss ist noch vieles unklar, doch gibt es Modelle dafür, wie das Universum sich möglicherweise gemäß heute bekannten Naturgesetzen aus einem Vakuum gebildet habe. In diesem Sinne gibt es keine grundsätzlichen Lücken in der Entwicklung des Universums vom Urknall bis zur Entstehung des Menschen, die nur durch das Wirken einer übernatürlichen Macht erklärt werden könnten. Noch bestehende Lücken sind die Arbeitsgebiete der heutigen Wissenschafterinnen und Wissenschafter, deren großes Ziel es ist, diese Lücken zu schließen.
Mindestens eine große Frage jedoch bleibt: Warum ist etwas geworden und nicht nichts? In dieser Frage geht es um das fundamentale Thema der Grundlage von Naturgesetzen. Dass wir und alle Dinge geworden sind, ist unbestreitbar. Über das Wesen dieses "Prinzips des Werdens" könnten nun ähnliche Überlegungen angestellt werden, wie griechische Philosophen im 5. Jahrhundert v. Chr. über den "Seinsgrund". Wer sie mit dem schöpferischen Willen Gottes beantwortet, begibt sich allerdings in Gefahr, eine unbeweisbare metaphysische Größe einzuführen, die weder eine direkte Beziehung zur Naturwissenschaft noch zum Fragenden hat.
Der biblische Gottesbegriff stammt letztlich weder aus philosophischen noch aus naturwissenschaftlichen Überlegungen. Er beruft sich auf Erfahrungen und Wahrnehmungen, die sich wesentlich von jenen in der Naturwissenschaft unterscheiden: die mystische Vision eines brennenden Dornbuschs, die Bewahrung auf der Flucht aus Ägypten, Erscheinungen auf einem Berggipfel und nach dem Tod von Jesus, sowie die späteren Alltagserfahrungen der Jünger.
Naturwissenschaftliche Messungen und Beobachtungen müssen reproduzierbar und objektiv, der Forschende austauschbar und das Resultat von ihm unabhängig sein. Im Gegensatz dazu ist der Mensch an religiösen Wahrnehmungen immer mitbeteiligt. Die Wirkung der religiösen Erfahrung bezeugt dann ihre Wirklichkeit. Der Mensch selbst ist jedoch nicht ersetzbar im religiösen Wahrnehmungsvorgang, er ist das eigentliche Messorgan. Daher ist der oder die Wahrnehmende nicht austauschbar.
Falsche Erwartungen Es folgt, dass die Ausgangspunkte von Naturwissenschaft und Religion grundverschieden sind. Die beiden Erfahrungsarten spannen in der Folge auch zwei verschiedene Ebenen von Sprache und Methode auf. In der gegenwärtigen Diskussion zwischen Naturwissenschaft und Theologie führt es immer wieder zu Missverständnissen und falschen Erwartungen, wenn diese beiden Ebenen der Wahrnehmung nicht auseinander gehalten werden. Es ist nicht nur das verschiedene Sprachspiel, das sie unterscheidet. Der verschiedene Ursprung ist der Grund, dass die Naturwissenschaft weder Gott finden, noch ihn widerlegen kann. Es ist ebenso aussichtslos, mit der naturwissenschaftlichen Methode einen Hinweis auf Gott zu finden wie in kanadischen Wäldern eine Palme. Kein direkter Weg führt von naturwissenschaftlichen Messungen zu religiösen Erfahrungen.
Der Weg kann nur indirekt sein und geht immer über das menschliche Bewusstsein. Zum Beispiel regt die Zweckmäßigkeit des Universums zum Staunen an. Glaubt ein Mensch an Gott auf Grund anderer Erfahrungen, kann er in den naturwissenschaftlichen Fakten das Wirken Gottes sehen. Das Staunen wird zum Lob, und aus dem Prinzip des Werdens wird das, was mit dem biblischen Schöpferbegriff gemeint ist.
Existentielle Fragen Das ständige Entfalten des Universums kann in religiöser Sprache als kontinuierliche Schöpfung verstanden werden. Das mag zunächst harmlos tönen, weil sich damit aus naturwissenschaftlicher Sicht nichts ändert. Die existentielle Perspektive bezüglich Gegenwart und Zukunft aber verändert sich tiefgründig. Der Dialog zwischen Naturwissenschaft und Glaube sollte daher nicht auf die Vergangenheit fixiert bleiben, sondern das Nachdenken über die Zukunft einschließen, die - herbeigesehnt oder befürchtet - unweigerlich in die menschliche Existenz hinein wirkt.
Auf der naturwissenschaftlichen Seite sind zum Beispiel Voraussagen über den Abbau eines Energievorrats sehr zuverlässig. Die verbleibende Lebenszeit der Sonne, noch etwa sechs Milliarden Jahre, ist daher gut bekannt. Ihr Zerfall ist sicher. Bei Systemen mit mehreren wechselwirkenden Elementen, wie zum Beispiel das Planetensystem, das Wetter oder die Evolution der Arten, ist dies anders. Ihre Entwicklung kann nicht langfristig vorausgesagt werden, weil sie nicht-linear ist. Ihre Zukunft ist offen. Seit einigen Jahren nennt man solche Prozesse auch chaotisch.
Es besteht eine merkwürdige Asymmetrie zwischen dem Zerfall aller Dinge im Universum, den wir zum Teil genau vorausberechnen können, und chaotischen Systemen, die sogar Neues bilden können. Das Neue ist nicht prognostizierbar, kann aber nie ausgeschlossen werden. So ist Hoffnung naturwissenschaftlich nicht beweisbar, aber denkbar. Auf der Seite der Religion ist Hoffnung ein zentrales Element. Es ist Hoffnung trotz allem Zerfall und selbst wider die Vernunft, letztlich Hoffnung im Tod. Der Grund der Hoffnung ist nicht ein Teil dieser Welt. Naturwissenschaft und Religion haben also verschiedene Perspektiven; eine gewisse Spannung wird sichtbar.
Angesichts der beiden gegenläufigen Strömungen von Zerfall und unsicherem Entstehen versucht das menschliche Bewusstsein, Muster zu erkennen. Wir suchen nach den "Zeichen der Zeit". Mustererkennung unterscheidet sich vom reinen Messen, ist aber Naturwissenschaft und Religion gemeinsam. Mustererkennung setzt voraus, dass wir die vorliegenden Fakten deuten und daraus einen Sinn konstruieren. Für dieses Deuten sind zwei Schritte nötig: Die menschliche Vernunft wählt zunächst aus zahllosen Wahrnehmungen Fakten aus, die sie als typisch erachtet. Dieser Auswahlprozess kann unbewusst oder durch einen Computer geschehen. Der zweite Schritt beim Deuten ist das Erkennen eines Musters. Es wird durch frühere Wahrnehmungen oder Erlebnisse konstituiert, durch "Musterbeispiele" im Erfahrungsschatz. Das Muster wird dann durch seine Ähnlichkeit mit der neuen Situation wieder erkannt, nämlich dann, wenn die Probe und das Musterbeispiel übereinstimmen. Bei der Mustererkennung können freilich Fehler entstehen, indem ein Muster nicht erkannt oder eine falsche Übereinstimmung gemeldet wird. Das zweistufige Deuten (mit Auswahl und Mustererkennung) ist eine unumgängliche Methode für gewisse Fragestellungen und hat wichtige Anwendungen in der Technik, zum Beispiel in der Robotik.
Im Erwarten der Zukunft deuten wir die Gegenwart. Beim Deuten der Zeichen der Zeit stehen mehrere Muster zur Verfügung: es wird immer besser; es bleibt alles gleich; alles zerfällt; Neues wird entstehen. Das vierte Muster ist zentral für die christliche Hoffnung, wo die Geschichte von Karfreitag und Ostern das Musterbeispiel konstituiert. Die vier Muster sind diametral verschieden. Demnach können sich die Deutungen der selben Gegenwart widersprechen. Erst spätere Erfahrungen bestätigen oder widerlegen eine Deutung.
Das Deuten der Gegenwart ist nicht belanglos, denn die auf uns zukommende Zukunft verlangt nach Vorbereitung, Initiative oder Abwehr. Menschen sind Meister im Deuten, vielleicht weil gutes Mustererkennen ein Vorteil in der Selektion und Evolution der Hominiden war. Wer gut deutet, hatte mehr Chancen zu überleben und Nachkommen zu haben. Wer falsch deutet, den bestraft die Zukunft.
Wissen und Hoffen Die Spannung zwischen Naturwissenschaft und Religion bezüglich der Zukunftserwartung entspringt der Diskrepanz zwischen praktischem Wissen und visionärer Hoffnung. Sie kann nicht wegharmonisiert werden und muss bleiben. Diese Spannung ist in uns selbst, nicht zwischen Fachgebieten. Die beiden Ebenen kommen dann in Berührung, wenn die eine der anderen zum Bild wird. Praktisch geschieht dies, indem eine religiöse Erfahrung durch eine Metapher (griech. Übertragung) aus der naturwissenschaftlichen Ebene erläutert wird. Den Begriff "Hoffnung" könnte man durch folgende Metapher vermitteln: Aus dieser Existenz wird trotz Zerfall und Tod etwas Neues entstehen, so wie unser Planet aus kosmischem Staub entstanden ist, der Asche zerfallener Sterne.
Die Hoffnung, welche hier ausgedrückt wird, ist nicht aus der Entstehungsgeschichte von Planeten herzuleiten, sondern muss der religiösen Wahrnehmungsebene entstammen, in der dieses grenzenlose Vertrauen erfahren wird. Hoffnung auf ein ganz anderes Neues ist eines von mehreren Deutungsmustern im Blick auf die gegenwärtigen Zeichen der Zeit. Leben wir mit diesem Muster, so wird die bisherige Entwicklung des Universums zum Bild für die Zukunft auf der Ebene der existentiellen Erfahrungen. Im Deuten wissenschaftlicher Resultate bewerten wir das naturwissenschaftlich Vorfindliche und interpretieren es. Die naturwissenschaftlichen Fakten erscheinen in einem neuen Licht: Das Universum wird zum Ort einer fortwährenden Schöpfung, und folglich gibt es Hoffnung auf neue Schöpfung auch in der Zukunft.
Der Autor arbeitet auf den Gebieten der Sonnen- und Sternphysik und ist Professor für Astrophysik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.
Würfelt Gott? Ein außerirdisches Gespräch zwischen Physik und Theologie.
Von Arnold Benz und Samuel Vollenweider. Patmos Verlag, Düsseldorf 2000. 279 Seiten, geb., öS 280/e 20,35 Die Zukunft des Universums: Zufall, Chaos, Gott?
Von Arnold Benz. dtv, München 2001. 216 Seiten, TB,öS 137/e 9,97