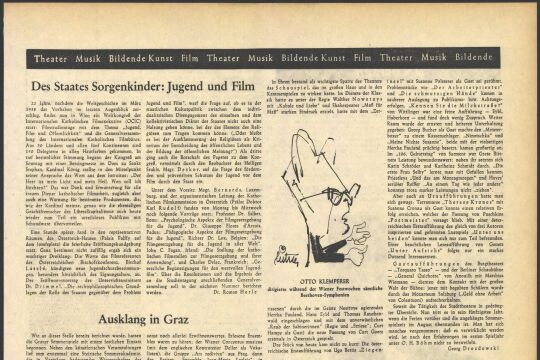Ohne Reclam-Heft in der Hand
Othmar Schoecks Opernversion der "Penthesilea" begeistert im Linzer Landestheater -Regisseur Peter Konwitschny im Gespräch.
Othmar Schoecks Opernversion der "Penthesilea" begeistert im Linzer Landestheater -Regisseur Peter Konwitschny im Gespräch.
"Penthesilea" nach dem Drama von Heinrich von Kleist ist ein genialer Operneinakter des Schweizer Komponisten Othmar Schoeck aus dem Jahr 1924. Im Landestheater Linz wird er als Koproduktion mit dem Opernhaus Bonn zum ersten Mal szenisch in Österreich aufgeführt. Die extreme Story mit der aufpeitschenden Musik wurde von einem der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten Opernregisseure unserer Zeit inszeniert -Peter Konwitschny.
Penthesilea, die Königin der Amazonen, die sich nur einem besiegten Mann hingeben darf, ist dem griechischen Helden Achilles im Kampf unterlegen. Obwohl beide einander in Liebe verfallen sind, schlachtet sie den ihr wehrlos Entgegentretenden in einem hemmungslosen Blutrausch ab. Konwitschny verweigert eine naturalistische Deutung. Seine überaus spannende Inszenierung beginnt und endet im Stil einer konzertanten Aufführung. Orchester und Dirigent sind auf der Bühne platziert, ebenso die vom Komponisten vorgesehenen zwei Konzertflügel, die auch als Dekorationselemente eingesetzt werden. Der Chor ist wie die Zuschauer gekleidet und greift fallweise in das Geschehen ein.
DIE FURCHE: Warum verzichten Sie weitgehend auf die schon alltäglichen Blut-und Gewaltorgien in Theater, TV und Film?
Peter Konwitschny: Wir haben uns für kein realistisches Theater auf der Bühne entschieden, weil man das fortwährend um die Augen und Ohren geschlagen bekommt. Dadurch wirkt es auf das Publikum noch schlimmer und drastischer.
DIE FURCHE: Sind Liebe und Hass auch heute noch in dem Ausmaß, wie es hier ausgetragen wird, miteinander verzahnt?
Konwitschny: Das wird wohl immer so sein. Je mehr wir zu Konsumenten erzogen werden, desto unzurechnungsfähiger sind wir in unseren Emotionen, in unseren Wünschen und auch in unserer Verletzbarkeit; insofern verschwindet ja Leben und Lebendigkeit insgesamt.
DIE FURCHE: Ihre Penthesilea, die deutsche Künstlerin Dshamilja Kaiser, ist eine intensive und ausdrucksstarke Sängerin. Persönlichkeiten wie sie werden heute, nicht nur in der Oper, seltener. Sehen sie darin ein Problem?
Konwitschny: Die braucht es natürlich! Allerdings nicht falsches Pathos und nicht die Größe eines Tenors, die darin besteht, dass er sich den Schal um den Hals wirft.
Die Furche: Sie haben einmal gesagt, dass sie Edita Gruberova in einer konzertanten Aufführung mehr beeindruckt hätte als in einer szenischen. Woher kommt das?
Konwitschny: Eine konzertante Opernaufführung ist für mich die größtmögliche Verletzung von Werktreue. Kein Opernkomponist dachte an einen Konzertsaal anstelle einer Bühne. Frau Gruberova aber hat mich über die Maßen erstaunt, wie sie mit ihrer Mimik, wenigen Gesten und ihrer Stimme schon etwas ausdrücken konnte. Das machen ja viele gar nicht. Das geht verloren. Wenn Oper nur noch zum Event verkommt, dann geht sie unter, dann wird sie irgendwann verschwinden. Sie hat nur eine Chance, wenn die Wahrhaftigkeit und die Aktualität der Werke von uns Künstlern ernst genommen und kenntlich gemacht werden.
DIE FURCHE: Wird es nicht immer schwieriger, das Publikum zu erreichen?
Konwitschny: Wir lernen alle, uns möglichst zu mäßigen. "Verflucht das Herz, das sich nicht zu mäßigen weiß." Das sagt die Oberpriesterin der Amazonen. Das ist eine Ideologie, die dazu angetan ist, das Leben zu minimieren. Oper hat jedoch ein enormes Potential, Menschen und Werte zu bilden. Das Wichtigste ist die Liebe, die Empathie nicht nur zu Menschen, zur Natur, zur Existenz überhaupt. Das kann die Oper intensiver vermitteln als das Schauspiel oder der Film, weil die Verbindung von Musik und Sprache direkt in das Gefühl und den Kopf des Publikums geht.
DIE FURCHE: Lassen sich die Sänger noch begeistern?
Konwitschny: Wenn ein Starsänger kommt, wird es schwierig. Der nimmt an den Proben nur zwei Wochen teil. Mit den anderen probiere ich sechs Wochen und das ist nicht tolles Regietheater, sondern wir arbeiten gemeinsam, um eine Botschaft zu überbringen. In zwei Wochen kann ich nichts entwickeln. Das verstehen die Intendanten nicht.
DIE FURCHE: Sie haben immer wieder betont, dass sich unsere Kultur ihrem Ende nähert. Warum finden Sie das gar nicht so schrecklich?
Konwitschny: Ich bin tatsächlich ein Optimist! Man stelle sich vor, dieses Unrecht, das jetzt herrscht, diese Kälte zwischen den Menschen bliebe für immer so. Das wäre doch das Schlimmste. Alles muss weg! So lange es existiert, kann gar nichts entstehen. Dazu sind die bösen Kräfte viel zu stark geworden. Kleine Reparaturen bewirken nichts mehr. Es könnte sich natürlich etwas in einem anderen Sonnensystem entwickeln (er muss nach dieser Aussage lachen).
DIE FURCHE: Ihr Vater war der berühmte Dirigent Franz Konwitschny. Sie sind in Leipzig aufgewachsen und studierten in Berlin. Wollten Sie immer schon Regisseur werden?
Konwitschny: Ich wollte Dirigent werden, spielte aber am Klavier nicht gut genug vom Blatt. So wurde ich Regisseur und meinte lange Zeit, dass ich es nie so gut kann wie Joachim Herz oder Götz Friedrich.
DIE FURCHE: Stimmt es, dass damals in der DDR die Ausbildung der Regisseure besser war als heute?
Konwitschny: Das ist ja das Zeichen unseres Unterganges, wenn Leute Dinge verwalten, von denen sie keine Ahnung haben. Mit dem Reclam-Heft in der Hand habe ich nie Opern inszeniert.
Penthesilea Landestheater Linz 12., 14., 23. März, 8., 21. April
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!