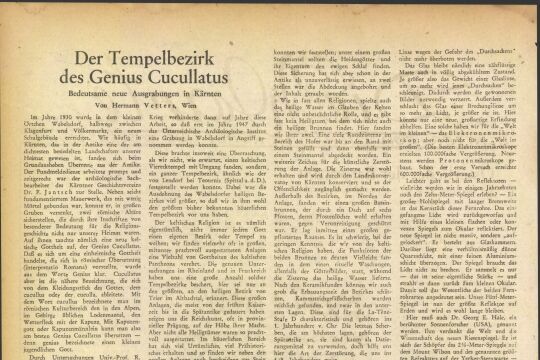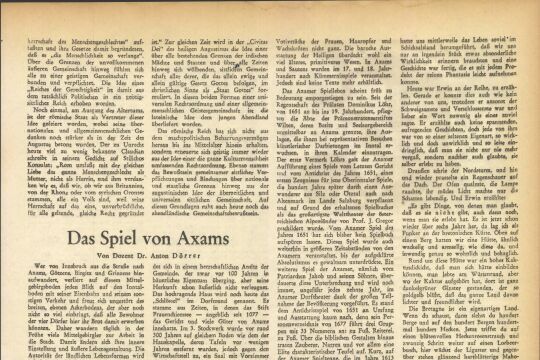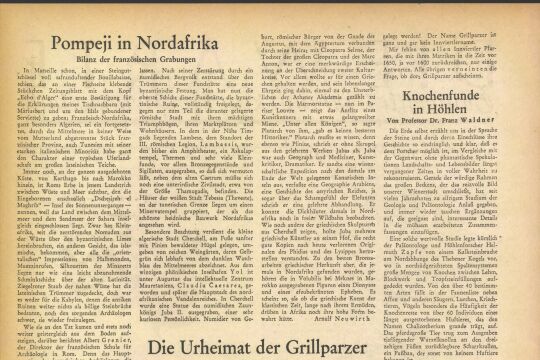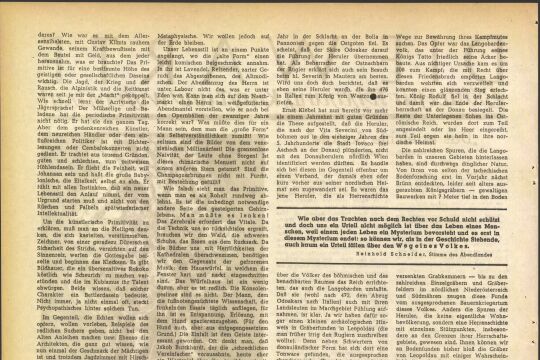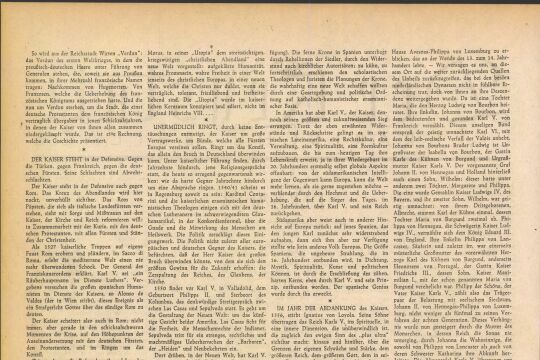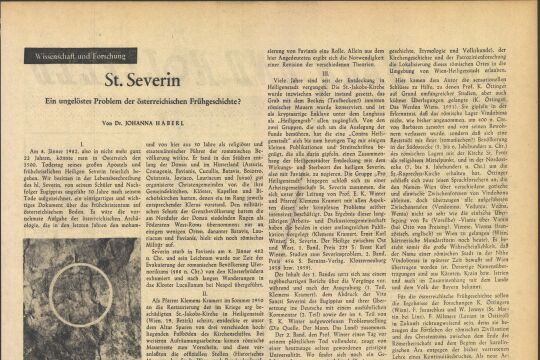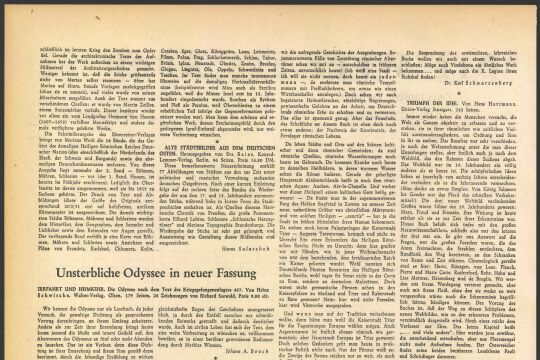Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Alte Funde neu gedeutet
Kunst aus dem „Meer" der ungarischen Märchen
Die Enns hat Mitteleuropa in eineinhalb Jahrtausenden mehr als einmal in zwei Teile gespalten. Bis zu ihr reichte Attilas Hunnenreich. Hier verlief auch die Grenze zwischen Bayern und Awaren. Um 900 nahmen die Ungarn das Gebiet östlich des Flusses in Besitz, verloren und eroberten es wieder und wieder.
Wer damals über die Enns nach Osten ging, kam zu den „Hunnen", in eine fremde, unheimliche, von Schamanenzauber gefangene Welt.
Für die Ungarn ist — im Märchen — die Enns der Glasberg, hinter dem sich „das Meer ob der Enns, das Chaos, die Verlassenheit" befinden, aus denen keiner zurückfindet.
Herwig Wolfram, Professor für Geschichte des Mittelalters und Historische Hilfswissenschaften in Wien, enträtselte das Mixtum aus Dichtung und Wahrheit, entschlüsselte Fundgegenstände aus dem Donau- und Ostalpenraum und gab dem von Gerhard Lang-thaler herausgegebenen Buch, in dem 23 solcher Objekte interpretiert werden, den Namen „Botschaften aus dem Meer ob der Enns" (Verlag Böhlau, Wien).
Aus dem Oberösterreich unserer Tage, in dem das magyarische „Utgard", der Ozean, begonnen haben soll, wurden vier ausgewählt. Wir Heutigen bedürfen eines „Dechiffrierers" für den Grabstein der Christin Ursa in Wels (dem antiken Ovilava), für das Goldblattkreuz aus dem bayerischen Gräberfeld Zizlau bei Linz und für den Tassilokelch (weniger für den sogenannten Codex millenarius maior aus dem Kloster Kremsmünster).
Wolfram liest etwa aus dem Grabstein des römischen Soldaten Flavius für seine christliche Frau mehr heraus als Schmerz eines Mannes um eine Frau, die Christin war. Seine „Botschaft" lautet: Flavius Ianuarius trauert— ob selbst Christ oder nicht — auf heidnische Art, weiß noch nichts um die „Auferstehung von den Toten", wähnt seine Frau im Hades. Er war römischer Soldat, einer von jenen, die an der Grenze des Imperiums heimisch geworden waren und bereits heiraten durften, ohne versetzt zu werden. Sein Chef könnte der heidnische Germane Generidus gewesen sein, der 409 ein Generalkommando erhalten hatte.
Das langobardische Goldblattkreuz wurde 1941 in einem Män-nergrab aus dem siebenten Jahrhundert dort gefunden, wo jetzt die VÖEST stehen. Wolfram weiß über den augenfälligen ästhetischen Wert hinaus zu ergänzen: Das aus zwei Blattgoldstreifen zusammengesetzte Kreuz — das einzige, das bislang in Österreich gefunden wurde — war auf einem Gesichts- oder Leichentuch aufgenäht und wurde dem Bestatteten ebenso ins Grab mitgegeben wie ein merowingisches Hiebschwert.
Beides charakterisiert den Mann: als Krieger und als Christen, und zwar einen der Oberschicht. Sie zeugen auch von der Vielfalt der Glaubensrichtungen im Bayern des sechsten und siebenten Jahrhunderts, der Spaltung in ein fränkisch-römisches und ein aquileisch-langobardi-sches Christentum.
Tatsächlich hatte ja noch der heilige Bonifatius im achten Jahrhundert den Eindruck, als würde bei den Bayern jeder denkbare Mißwuchs am Stamm der römischen Kirche gedeihen.
Zu dem wohl bekanntesten Kunstgegenstand des österreichischen Frühmittelalters, dem Tassilo- oder Stifter-Kelch, bringt der Autor neue Deutungen zu den bekannten. So meint er, daß dieser teils gehämmerte, teils gegossene, mit Silber und Niello belegte Kupferkelch für Theodo, Sohn des bayerischen Herzogs Tassilo III. (748 bis 788/94). und dessen Gemahlin Liutpirc, eine Tochter des letzten Langobardenkönigs Desiderius, angefertigt worden sein könnte. Theodo hätte den Kelch, als ihn Tassilo 777 als Mitherrscher auftreten ließ, dem eben gegründeten Stift übergeben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!