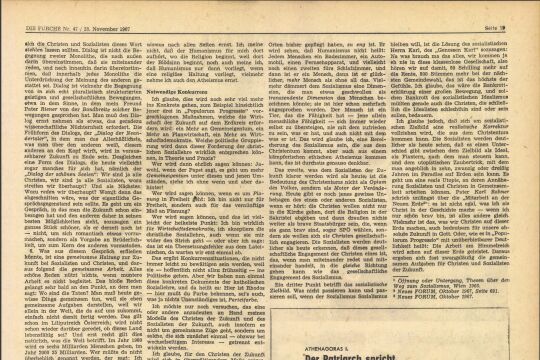Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Global ins 19. Jahrhundert?
Vor einem Jahr war das Thema ein blitzblankes, neues Ding. I leute wirkt es abgegriffen. 1997 werden die Medien den Begriff Globalisierung (siehe auch FURCHE 47/96) weiter abschleifen, bis sich keiner mehr etwas dabei denkt. Hat er das verdient? Und verdient die Sache, für die er steht, die negative Besetzung?
Global nennen wir schon lange alles, was die ganze Erde betrifft. Globalisierung kann schwerlich etwas anderes bedeuten als einen die ganze Menschheit umfassenden Integrationsprozeß. Also genau das, was sich viele nach den Zweiten Weltkrieg elträumten: offene Grenzen, gegenseitiges Verständnis, friedlichen Handel aller mit allen. Wir können reisen, wohin wir wollen. Wir verdanken nicht nur dem technischen Fortschritt, sondern auch dem weltweiten Handel faszinierende, für uns neue Produkte.
Am Ende des Einander-Zerfleischens im Aufeinanderprall immer größerer Einheiten kann nur die Globalisierung stehen. Man darf Globalisierung daher als Weg zum Weltfrieden sehen. Wir können daher uns und unseren Nachkommen nichts Besseres wünschen und die Globalisierung nur von ganzem Herzen begrüßen. Und wir müssen sie immer weiter entwickeln. Etwa in der Bichtung, daß auch die Menschen der Länder, die wir besuchen und kennenlernen können, in die Lage kommen, uns zu besuchen und kennenzulernen. Und daß sie sich unsere faszinierenden, für sie neuen Produkte leisten können. Ebenso, wie wir die Demokratie immer weiter entwickeln müssen.
Denn dies hat die Globalisierung mit der Demokratie gemeinsam: Sie ist nicht die Lösung aller Probleme. Demokratie ist eine Methode zur Entscheidungsfindung, sie bietet keine Garantie für die Bich-tigkeit der Entscheidungen. Immerhin darf man hoffen, daß die breite Basis der Ent-scheidungsprozesse die Trefferquote erhöht.
Die Globalisierung läßt immer mehr Entscheidungen, die irgendwie, irgendwo, immer öfter weiß man nicht genau, wie und wo, auf mehr oder weniger demokratische Weise getroffen wurden, weltweit wirksam werden. Leider erweisen siie sich aus dem Blickwinkel von immer mehr Menschen, in deren Leben sie eingreifen, als Fehlentscheidungen. Selbst die größten Euphoriker müssen sich dies eingestehen. Die Frage ist also nicht: Globalisierung ja oder nein? Sie muß lauten: Wächst die Welt auf einem Wege zusammen, der für immer mehr Menschen das Leben verbessert, von ihnen bejaht werden kann?
Die Antworten werden immer kritischer. Und immer öfter argumentieren gerade jene, die sie bejahen, mit der Globalisierung wie mit einer Naturgewalt, die keinem gestaltenden menschlichen Willen mehr unterliegt. Der Staat mit seinem wirtschaftspolitischen Spielraum wird für tot erklärt, ganz so, als wäre er einem inoperablen Leiden erlegen. Als hätten nicht die Verhand-ler demokratisch bestellter Be-gierungen die staatlichen Entscheidungsspielräume an übernationale Körperschaften abgetreten, als hätten sie nicht in jahrzehntelangen Verhandlungsrunden die Wettbewerbsbedingungen geschaffen, mit denen die Begierun-gen nun den Wählern erklären, was sie alles opfern müssen.
Der Sozialstaat begegnet uns immer öfter als „überholter Wohlfahrtsstaat", als eine der „letztlich unhaltbaren Illusionen, die das Säkulum schuf" - ganz so, als wäre auch die soziale Sicherheit drauf und dran, einem tückischen Leiden zu erliegen und nicht etwa, in einer Kette übernationaler Verhandlungen und Entscheidungen demokratisch legitimierter Vertreter einzelner Staaten ausgetrocknet zu werden. Idealtypisch nachzulesen bei Erich W. Streissler in der „Presse" vom 14. Dezember.
Die Sprache, in der uns die Antiquiertheit des Sozialstaates verkündet und die Globalisierung dafür verantwortlich gemacht wird,-hat immer öfter einen apologetischen Klang. Sie vermittelt uns Hiobsbotschaften, nicht aber den Eindruck, die Autoren würden besonders bedauern, was sie verkünden. Selbst düsterste Prognosen, wie etwa, der Gang ins 21. Jahrhundert heiße „zurück im Sturmschritt ins 19. Jahrhundert" (Streissler), vermitteln uns zugleich die Erkenntnis,'der Wohlfahrtsstaat (nicht etwa der überzogene, sondern der Wohlfahrtsstaat an sich) sei eine Fata Morgana gewesen, die große, aber offenbar trügerische „Verheißung der sozialdemokratischen Bewegungen gemeinsam mit den parallelen Gedankenführungen patriarchalischer Konservativer".
Dabei stehen unauflösbare Widersprüche oft hart nebeneinander: Der Sozialstaat ist unfinanzierbar, weil einerseits immer mehr Menschen ins soziale Netz fallen und andererseits die Alten ihre Benten und Pensionen immer länger genießen. Kein Wort davon, welche Katastrophe auf dem Arbeitsmarkt für die Jungen ausbräche, würden die wirklich Alten und die angeblich zu alten Jungen länger arbeiten (wozu viele gern bereit wären). Kein Wort davon, wie der Einzelne mehr Eigenverantwortung tragen soll, wenn seine ökonomische Situation immer kritischer wird.
In einem (selbstmörderischen Konkurrenzkampf, der den armen und ärmsten Ländern kaum mehr Einstiegsmöglichkeiten läßt und immer mehr lokale Nischen austrocknet, graben die Industriestaaten einander die Arbeitsplätze ab. Die Triebkraft dabei ist nicht die Globalisierung, sondern der Zuwachs an Produktivität. Er vernichtet in allen Industriestaaten mehr Arbeitsplätze, als durch Innovationen geschaffen werden können. Dank Globalisierung schlägt dieser Prozeß aber weltweit durch. Die Globalisierung mag für einige Länder die Probleme vorübergehend entschärfen - indem sie sie in andere Länder verlagert. Daher sollten wir für all die uns bedrängenden Probleme nicht die Globalisierung verantwortlich machen, sondern die Struktur unseres Wirtschaftens. Nicht die Globalisierung ist in Frage zu stellen, sondern das Vorzeichen, unter dem sie derzeit so resolut vorangetrieben wird.
Die eigentliche Frage lautet, ob die laufende Vernichtung von Arbeitsplätzen in den Industriegesellschaften vermeidbar oder unvermeidbar sei.. Diese Frage ist zwar vorrangig eine der ökonomischen Theorie, die aber vermochte sich noch nie völlig von den ökonomischen Interessen zu emanzipieren. Hingegen werden heute die Möglichkeiten der Politik, die Probleme des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherheit zu lösen, stärker als je zuvor in diesem Jahrhundert eingeschränkt, die Marktkräfte sich selbst überlassen. Dabei trat der selbst von den eifrigsten Vertretern des Turbokapitalismus (auch so ein Modewort, aber man kann sich darunter etwas vorstellen) so gern zitierte Adam Smith bereits im 18. Jahrhundert der Behauptung entgegen, man müsse die Marktkräfte bloß sich selbst überlassen, um einen für alle optimalen Zustand herbeizuführen.
Wir sollten uns seiner besinnen und doch wieder Wege zum größtmöglichen Glück für die größtmögliche Zahl suchen, um es unmodern auszudrücken. Finden wir sie, erweitert die Globalisierung die Zahl derer, denen dieses größtmögliche Glück zuteil werden kann. Finden wir sie nicht, weil wir sie gar nicht suchen, könnte es nur zu bald auch mit dem größtmöglichen Glück der kleinen Zahl Privilegierter vorbei sein. Der Weg zurück ins 19. Jahrhundert wäre nämlich der Weg zurück in jenes Elend, das der Nährboden für die mörderischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts war. Verhindern kann dies nicht der Markt, sondern nur die Politik.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!