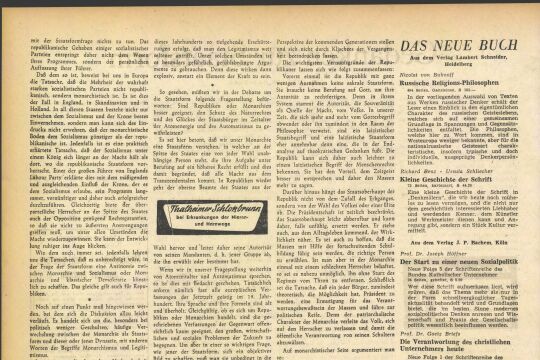In diesen Wochen wird Inventur gemacht. Die Geschäfte schließen mitunter für einige Tage und hinter herabgelassenen Rolläden vollzieht sich die Bestandsaufnahme. Soll und Haben werden ermittelt.
Auch in den großen Lagern der österreichischen Politik trägt man sich am Beginn des neuen Jahres, das aller Voraussicht nach ein Wahljahr sein wird, mit ähnlichen Gedanken. Schon hört man davon, daß die erste Regierungspartei in wenigen Wochen ihre führenden Funktionäre und Mandatare auf einige Tage an einem stillen Ort „konfinieren“ will und auch im österreichischen Sozialismus mag man sich neben taktischen Ueberlegungen Rechenschaft über das Woher und Wohin geben. Ein Beitrag für eine solche Inventur unter der roten Fahne liegt bereits vor und verdient über die innenpolitischen Schranken und Zäune hinweg Aufmerksamkeit*.
„Das große Unbehagen...“ Erst vor einer Woche mußten unsere Leser in der „Furche“ zur Kenntnis nehmen, wie gefährlich dieses durch Frankreich schleicht — und nun soll es bereits auch Oesterreich erreicht haben? Wieso? Bei uns ist doch alles ganz anders. Wir haben keine Wahlen gehabt. Wir haben doch eine stabile Regierung zweier großer demokratischer Parteien, die Extreme spielen gegenwärtig in der österreichischen Politik überhaupt keine Rolle, die Wirtschaft floriert und die Arbeitslosigkeit ist auf ein Minimum zurückgedrängt — und trotzdem ,,das große Unbehagen“ ... ? So wenig es angebracht ist, etwa aus intellektueller Langeweile, ständig von einer „Krise der Demokratie“ zu reden, bis diese sich eines Tages wirklich einstellt, genau so verderblich könnte es sein, sich in ein Gefühl falscher Sicherheit einzulullen. Auch dieser Fehler soll mitunter in Oesterreich gemacht werden. Klenner bricht mit dieser „Tradition“. Schon die ersten Worte, mit denen er seine Broschüre — merkwürdig eigentlich, daß wichtige Aussagen heute nicht selten wieder durch an die Frühgeschichte der öffentlichen Meinung erinnernde „Streitschriften“ vorgetragen werden — wird der Ton angeschlagen: „Es wäre Selbstbetrug, wenn man annehmen wollte, daß nach der Weltkatastrophe, in die die Diktatoren die Völker führten, die Demokratie in Mitteleuropa eine breite Vertrauensr basis habe. Das nicht genau definierbare, aber zweifellos vorhandene Unbehagen gegenüber Organisationen und Parteien, geht quer durch alle Bevölkernngsschichten. Staat und Organisationen sind in den Augen des einfachen Staatsbürgers übermächtig geworden. Uebermacht erzeugt kein Gefühl der Sympathie.“ - Der dies schreibt ist kein geistiger Schüler Röpkes, sondern ein bewußter Sozialist. Und um das geänderte Verhältnis der Massen zu seiner Partei — das Wort „Arbeiterbewegung“ war für österreichische Sozialisten stets nur ein Synonym für ihie Partei und für die von deren Vertrauensleuten geführte Gewerkschaftsbewegung —, geht es ihm auch vor allem. Er will einfach nicht länger Vogel Strauß spielen und sich selbst genau so wie seinen Parteifreunden die fromme Lüge wiederholen: die Partei, die seit zehn Jahren die Hälfte aller österreichischen Minister stellt, die einen nicht geringen Teil unserer Wirtschaft durch ihre Vertrauensleute kontrolliert, ist noch immer dieselbe Partei, die einst für das allgemeine Wahlrecht kämpfte, dem Arbeiter die Schnapsflasche entwand und später Jahr für Jahr am 1. Mai und am 12. November als Stoßtrupp des internationalen Proletariats auf die Straße ging. Die Wirklichkeit schaut anders aus: In ihr sind „Die Arbeiter von Wien“ eben kein Kampflied, sondern ein Feiertagshymnus. (Wie auf der anderen Seite vom einst umjubelten „Luegermarsch“ weder die Melodie, geschweige denn der Text den Mitgliedern und Anhäneern der Volkspartei überhaupt geläufig ist.) Oder wie es Klenner sagt:
„Die österreichische Arbeiterbewegung war vor 1934 eine starke, von großem Vertrauen getragene Bewegung. Sie ist heute in mancher Hinsicht noch stärker, noch einflußreicher und initiativer, aber . die unerschütterliche Vertrauensbasis, wie sie früher bestand, gibt es nicht mehr. Viele Arbeiter und Angestellte sowie Angehörige der Randschichten sind heute aus Zweckmäßigkeitsgründen bei Partei und Gewerkschaft, oder sie sehen in ihnen das kleinere Uebel... Den Gefühlsüberschwang vergangener Jahrzehnte werden wir nicht mehr zu^ rückrufen können — und es ist besser so“ (S. 61). Nachdem sich Klenner mit diesem Bekenntnis auf den Boden des Realismus gestellt hat, geht er noch einige Schritte konsequent weiter. Er spricht von der Kluft, die „zwischen den leiten-
* Fritz Klenner: Das Unbehagen in der Demokratie. Ein Beitrag zu Gegenwartsproblemen der Arbeiterbewegung. Verlag Wiener Volksbuchhandlung.den Funktionären, die den Blick auf das Ganze richten, und den Mitgliedern, die nur ihr enges Interessengebiet überblicken“, entstehen kann. Und er gibt deutlich zu verstehen, daß auch in Oesterreich die Arbeiterbewegung — das heißt die sozialistische Partei und der Gewerkschaftsbund — mit diesen Problemen ringen, besser: ringen' sollten. Heiße Eisen werden mutig angefaßt: das Dienstauto („der Autofahrer verliert den Kontakt mit der Umwelt“), der „Genosse Direktor“ („Die anderen Einkommensverhältnisse und die veränderte Lebenshaltung werden unweigerlich den aus der Arbeiter- und Angestelltenschaft kommenden .Manager' seiner Klasse entfremden“, und schließlich „der Apparat“, an dessen Zahnrädern sich der Staatsbürger tagtäglich wundreibt („Meist ist der Mensch nur eine Nummer und — das verträgt er nicht“).
Und Klenner kennt auch nur zu gut die Waffe, mit der sich der einfache Genosse genau so wehrt wie der unorganisierte Staatsbürger: „Seine Abwehr gegen das Diktat der Massenorganisationen ist die Flucht in die Interesselosigkeit, die Organisationsmüdigkeit.“
Gibt es aber nicht doch eine Brücke, um an die Herzen und Hirne gerade der heute in den Staat hineinwachsenden und diesen sehr bald tragenden Menschen heranzukommen? Der Realist im geistigen Generalstab der SPOe stellt auch diese Frage — und beantwortet sie gleich selbst in einer ebenso anschaulichen wie richtigen Formulierung:
„Was wünscht die heutige Generation, und was kann sie daher als Ideal ansehen? (Was im folgenden gesagt wird, trifft auf die Menschen zwischen 20 und 3 5 Jahren zu, ohne für ältere ganz an Richtigkeit zu verlieren.) Sie will einen gesicherten Arbeitsplatz bei entsprechender Entlohnung, die Möglichkeit, bei guter beruflicher Leistung weiterzukommen und in klingender Münze entlohnt zu werden. Das Einkommen soll so ausreichend sein, daß man sich neben Ernährung und Unterkunft ordentlich kleiden kann, für Sport, Vergnügen und Urlaub soll genügend übrigbleiben, und daneben soll man sich etwas für die Gründung der Familie oder ihre Erhaltung, für die Beschaffung einer Wohnung oder ihre Vervollständigung auf die Seite legen können. Zur Gründung des Hausstandes sollen beide, Mann wie Frau, beitragen, also müssen beide einen Beruf ausüben können, zumindest so lange, bis Wohnung und Einrichtung geschaffen sind. Eine solche Wohnung soll den modernen Anforderungen entsprechen und nicht erst nach jahrelanger Wartezeit erreichbar sein. Die Stellung in Gesellschaft und Betrieb soll gleichberechtigt sein, wobei nicht so wie früher die Betonung auf der Gleichheit liegt. Entscheidend ist die Anerkennung, daß jeder Mensch ein Wesen für sich ist, das man zu nichts zwingen kann und in dessen Privatverhältnisse man sich nicht einzumischen hat. Die heutige Generation ist individualistisch und nicht kollektivistisch eingestellt, und Gemeinschaft, welcher Art immer, bedeutet für sie noch kein Ideal. Die heutige Generation will in ihrer großen Mehrheit etwas leisten, die Länge der Arbeitszeit und die Kürze der Freizeit ist gar nicht ausschlaggebend, sie will nur materiell viel dafür haben. Sie will einen Zustand der freien, unbehinderten Entfaltung der Persönlichkeit, ohne viele kollektive, gesellschaftliche Eingriffe, deren Bedeutung in (antisozialistischen) Schlagworten oft überschätzt wird. Die tatsächlich geübten Eingriffe werden demgegenüber oft unterschätzt oder gar nicht erkannt. Diese Ablehnung jedweder Einmischung in die private Sphäre ist auch vor allem der Grund, warum die Jugend vom Kommunismus nichts wissen will... Mancher der älteren Generation wird sagen, daß das mit unseren Idealen verdammt wenig zu tun hat, denn solch bessere Lebensverhältnisse könnten auch innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft erreicht werden. Das ist richtig und der entscheidende Punkt“ (S. 66 f.).
Hier halten wir also bei unserem Blick über die Schulter eines um die Zukunft seiner Partei wie der gesamten demokratischen Gemeinschaft besorgten Sozialisten, der unter der roten Fahne offen und öffentlich Inventur macht. Es ist verständlich, daß wir nur einige Posten aus der langen Kolonne der Zahlen angeben konnten. Was bleibt zu tun? Es kann nicht unsere Sache sein, das aufgeschlagene Kassabuch des österreichischen Sozialismus mit Randglossen zu versehen. Allein die Forderung Kienners nach einer „Unterteilung“ der großen Kollektive erregt unser Interesse. Hier würde man gerne einmal genaue Vorschläge hören. Zustimmen möchte man dem Fanfarenruf „Der Mensch will heute nicht eingeordnet sein. Hüten wir uns deshalb in unserer Propaganda davor, ihn ganz erfassen zu wollen“ — wenn nicht, ja wenn nicht gleich darauf der Satz folgt: „Versuchen wir statt dessen, überall in Erscheinung zu treten, wo es den Menschen heute hinzieht, wo er einen Teil seiner Freizeit verbringt: im Kino oder zu Hause, beim Radio oder beim Lesen. Wir müssen trachten, viel mehr Einfluß auf die Filmproduktion, die Buchproduktion, das Radio, das Fernsehen und andere Mittel der Massenbeeinflussung zu gewinnen.“ Hier klafft ein offener Widerspruch. Der richtigen Forderun nach „Freiheitsräumen“ folgt in einem Atemzug der Appell zur totalen Verpolitisierung des Kulturlebens und der privaten Sphäre. Als ob es gerade aus den angeführten Sachgebieten nicht schon genug Beispiele gäbe, die „das große Unbehagen“ nähren ...
Wenn Klenner die Lampe des Diogenes anzündet und auf die Suche nach Idealen geht, die die Welt und die Menschen weiterbringen sollen, so mag er bald müde werden. „Neue Ideale“ sind nicht selten Irrlichter, die den nächtlichen Wanderer foppen und mitunter in Verderben führen. Wie wäre es dagegen, an der Pforte der alten Wahrheit Halt zu machen und anzuklopfen. Hier ist Klenner schon kurz verweilt als er schrieb:
„Wir müssen auch unsere Einstellung zur Religion revidieren — in der Erwartung, daß auch die offizielle Kirche ihre Haltung zum Sozialismus revidiert. Der Glaube ist eine große Macht. Der Materialismus als Weltanschauung ist zu einer furchtbaren Bedrohung des freien Menschentums entartet. Die sozialistische Arbeiterschaft hat heute keine Ursache, das Christentum als Gegner zu haben.“
Hier gilt es, einen mutigen Schritt zu tun. Nach unserer Meinung den entscheidenden.