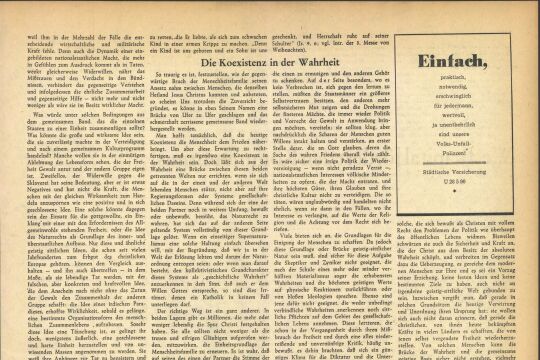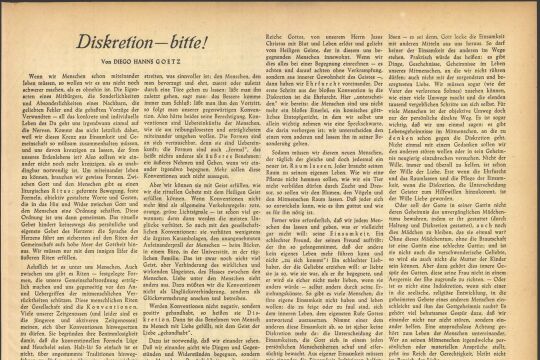„Die Botschaft des Konzils ist nichts anderes als die 2000 Jahre alte Botschaft der Kirche, die sie von Christus übernommen hat. Sie ist eine Botschaft des Friedens, die ihre Wurzeln hat in der Gottes- und Nächstenliebe.
Vor kurzer Zeit, am Heiligen Abend, haben wir die Frohe Botschaft des Weihnachtsevangeliums gehört, die in den Worten gipfelt: ,Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden1. Wie ist die Botschaft von der Ehre Gottes und dem Frieden der Menschen zu verstehen? Das heißt doch ohne Zweifel auf der einen Seite, daß uns der Friede gegeben wird, wenn wir zuerst Gott die Ehre geben. Aber heißt die Botschaft nicht auch etwas anderes, kann man sie nicht auch umgekehrt lesen? ,Ehre Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden?” Wie können wir Gott die Ehre geben, wie können wir Seinen Namen preisen, anders als dadurch, daß wir in Frieden leben, daß wir für den Frieden tätig sind. In Gott lebt, wer in Frieden lebt, aber nur wer den gottgeschenkten Frieden hat, lebt in Gott. Gott will nicht unser leeres Lippenbekenntnis, sondern durch unser Leben, Tun und Wirken sollen wir Ihn verherrlichen.
Christ ist man nie für sich allein
Wer sich Christ nennt, muß Frieden schaffen, für den Frieden wirken und handeln. Christen müssen sich bemühen, Haß und Zwietracht um sich und in sich zu bekämpfen. Christ ist man nie für sich allein, Christ ist man immer auch in seinem sozialen Verhalten. Man kann Gott nur lieben, wenn man seinen Mitmenschen wirklich liebt. Man kann Gott nur dann die Ehre geben, wenn man für Seinen Frieden, den Frieden der Menschen sich einsetzt. Wie nahe können wir Gott sein, wie ferne sind wir Gott. Nicht nur durch unsere bösen Gedanken, Worte und Werke sind wir es, sondern auch durch unser Nichttun, dadurch daß wir nicht Liebende, daß wir nicht Friedfertige, das heißt, daß wir nicht Täter, nicht Wirkende für den Frieden sind.
Wie ferne sind wir Gott, wenn wir meinen, wir hier in Mitteleuropa lebten in Frieden, wir seien friedfertige” Leute, weil wir die Augen schließen und den Kampf und den Krieg nicht sehen, nicht sehen wollen. 24 Stunden haben zu Weihnachten in Vietnam die Waffen geschwiegen. In eindringlichen Worten hat der Papst die Kriegführenden beschworen, diese Waffenruhe zur Vorbereitung eines Waffenstillstandes zu verwenden. Sollten diese Worte vergebens gewesen sein? Sollen nun wieder die Bomben fallen, die Granatwerfer ihre tödlichen Geschosse feuern, unschuldige Menschen bei Sprengstoffanschlägen ihr Leben verlieren?
Der .konventionelle” Tod
Wir starren wie gebannt auf die Atombombe und meinen, so lange sie nicht fällt, wäre es nicht so schlimm. Ja, wir haben sogar ein eigenes Wort erfunden, um uns und unser Gewissen einzuschläfem. Wir reden vom .konvetionellen Krieg” so, als ob das eine harmlose Angelegenheit wäre, eine Art Geländespiel. Täglich sterben hunderte Menschen durch einen .konventionellen” Krieg. Es stirbt sich konventionell nicht leichter als unkonventionell. Der Tod, der Schmerz, die Qual, das Leid sind gleich. Es ist gewiß ein schreckliches Wort, dieses Wort vom konventionellen Krieg. Es ist, als ob man Konventionen, Abmachungen treffen könnte, über den Tod von Greisen, Frauen und Kindern, über Flammenwerfer, Brandbomben, Gefangenenmorde und Geiselerschießungen. Die einzige Konvention, die den Sinn dieses Wortes wiederher- stellen könnte, wäre eine Konvention, das heißt eine Abmachung über die Beendigung dieses Krieges.
Der Papst wird nicht müde, zum Friede zu mahnen und seine Dienste für diesen Frieden anzubieten. Er hat alle Katholiken aufgerufen, für den Frieden zu beten und den Opfern dieses Krieges zu helfen. Die Caritas in der ganzen Welt sammelt für die Kriegsopfer im Norden und Süden dieses unglücklichen Landes. Aber nicht nur die Katholiken sind aufgerufen, alle Christen und auch alle Nichtchristen. Es gibt keinen Frieden nur für Katholiken. Der Krieg unterscheidet nicht zwischen Christen und Nichtchristen, wie das Leid, das Elend, der Hunger und der Tod keine Unterschiede kennen. Genauso kann auch die Hilfe, kann auch das Friedenswirken nicht zwischen Christen und Nichtchristen unterscheiden.
Der Friede ist unteilbar. Audi das ist zu einem Schlagwort geworden und zu einer Ausrede für die eigene Bequemlichkeit, eine pharisäische Ausrede für unser eigenes Nichtstun. Das Wirken für den Frieden ist sehr wohl teilbar, ich meine in dem Sinne, daß wir alle unseren Teil zu diesem Frieden bedzutragen haben. Unteilbar ist der Friede nur im einzelnen Menschen. Man kann nicht in der Welt allgemein für den Frieden reden, im eigenen Haus aber, für den eigenen Hausgebrauch sozusagen, die kleinen Bestien des Hasses, der Gewalt, der Verleumdung und der Lüge züchten.
Die Insel der Gleichgültigen
Wie ist es nun mit dem Frieden im eigenen Haus bestellt? Ist es nicht so, daß wir auch hier zu gerne nur davon reden? Reden wir uns nicht gerne ein, daß wir ein friedliches, gemütliches Volk sind? Unsere Verträglichkeit, unser Charme, unsere gewinnende Lebensart lassen wir uns gerne von der Welt bescheinigen. Aber unter dieser spiegelnden Oberfläche von Gemüt, Musik und Leichtlebigkeit gären im Bodensatz der Unfriede, die Tücke, der Neid, der Haß. Und was vielleicht noch schlimmer ist als all das — noch tiefer liegen die Lieblosigkeit, die Gleichgültigkeit, das Nicht-ange- rührt-Werden und das Sich-nicht- anrühren-Lassen von den Sorgen, vom Leid, aber auch von der Sehnsucht und der Hoffnung unserer Mitmenschen.
Wie klein, wie geringfügig, wie nebensächlich sind eigentlich unsere innerösterreichischen Probleme, die jetzt wieder im Vordergrund stehen — der Kampf um Positionen, um Einfluß, um Prozente — gegenüber jenen Fragen, die die Welt bedrohen, dem Krieg, der immer wieder aufflammt, dem Hunger und dem Elend — aber auch im Verhältnis zu den geistigen Kräften, die durch das Konzil ausgelöst wurden und die heute die Welt bewegen. — Geht uns das alles nichts an? Tun wir so, als ob wir auf einer Insel leben könnten, die aber wahrlich keine Insel der Seligen wäre, sondern eine Insel der Gleichgültigen, der Selbstgerechten, der Satten, derer, die blind sind im Herzen und im Geiste.
Wir, die wir in den Zeiten der Not Hilfe aus aller Welt empfangen haben, wir konnten uns nicht einmal einigen über die Hilfe, die wir den Ärmsten unserer Mitbürger geben solLten, die durch die große Wasserflut dieses Jahres ihr Hab und nicht selten auch ihre Existenz verloren haben.
Auch im eigenen Land gilt: Man kann Gott nur dann wirklich lieben, wenn man auch seinen Nächsten liebt. Und auch im eigenen Lande gilt: Man kann Gott nur dann in Wahrheit die Ehre geben, wenn man für den Frieden, für seinen Frieden wirkt. Nur der kann sich als Christ ausweisen, nur der kann sich auf seinen Glauben, auf seine Kirche berufen, der in den Auseinandersetzungen des täglichen Lebens auch in den politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen nicht den Haß steigert, sondern den Haß abbaut, der nicht Unfrieden sät, sondern für Frieden und Verständigung eintritt.
Die dramatische politische Phrase
Wir sollten daher unsere inneren Gegensätze auch im Hinblick auf kommende politische Entscheidungen nicht überspitzen, nicht dramatisieren, sondern entschärfen. Auch der politische Gegner ist letztlich kein Feind, sondern ein Mitbruder, dessen Meinung wir ernst nehmen sollen, mit dem wir nicht nur das gleiche Land, die gleiche Liebe zum gleichen Lande, sondern auch das gleiche Schicksal teilen, mit dem wir nicht nur zusammen leben und zusammen wirken müssen, sondern auch wollen. Entscheidungen soll es in der Demokratie geben, dazu sind die Wahlen da. Aber hüten wir uns vor der allzu dramatischen politischen Phrase. Das Wesen der Demokratie liegt im Ausgleich. Der Kompromiß ist nicht notwendig, eine ,Faule Sache”, muß nicht eine ,üble Packelei” sein, sondern kann ebenso Ausdruck politischer Weisheit, menschlicher Verträglichkeit, christlicher Haltung sein.
Ob nun unser Land in Form einer Koalition regiert wird, der wir — das wollen wir nicht vergessen — in der Vergangenheit so viel zu verdanken hatten, oder in einer anderen Form, immer muß im politischen wie wirtschaftlichen Leben die Mehrheit auch Rücksicht auf die Minderheit nehmen. Der Stärkere darf nicht den Schwächeren unterdrücken, den Schwächeren nicht ausschließen oder ausspielen, sondern muß auch seine Ansichten und seine Meinungen gelten lassen, muß vielleicht manches von ihm übernehmen. Auch hier kann die Kirche auf das Konzil hin- weisen, das sich bemüht hat, die Meinung auch kleiner Minderheiten in die Entscheidung der Mehrheit einzübauen.
Das Bemühen um den Ausgleich, das Bekenntnis zum Kompromiß ist aber kein Bekenntnis zu einem allgemeinen Indifferentismus, der Auffassungen und Meinungen verwischt, der die Grenzen zwischen Richtig und Falsch auslöschen will. Gerade der Ausgleich setzt den eigenen Standpunkt voraus, denn nur wer eine eigene Meinung hat, kann die Meinung des anderen achten. Auch der Dialog darf nicht zu einer Verwischung der Ansichten führen. Gerade vom Dialog, diesem so oft zitierten Schlüsselwort der Gegenwart, müssen wir erst lernen, richtig Gebrauch zu machen. Es nützt nichts, wenn wir uns auf den Dialog der Kirche und auf das Konzil berufen. Es nützt nichts, wenn wir den Dialog bloß im Prinzip bejahen, das Gespräch der Kirche mit den Nichtkatholiken, den Nichtchristen, ja auch mit den Nichtgläubigen begrüßen, selbst absr mit unserem Nachbar nicht reden wollen, weil er ein politischer Gegner ist, weil er in die Kirche geht oder nicht in die Kirche geht.
Wir müssen uns alle ändern
Wenn wir das Konzil ernst nehmen, dann müssen wir uns alle ändern. Der Katholik des Jahres 1966 kann nicht mehr in den Positionen vergangener Jahre und Jahrzehnte verharren. Er kann sich auch im Politischen nicht mehr so geben, wie er sich vor 30 oder 50 Jahren gegeben hat. Das Christentum ist heute nicht mehr bloß eine Front gegen das Antichristentum, sondern es hat sich selber gefunden. Der Katholik lebt nicht bloß in einer Antihaltung gegenüber jenen, die er für Feinde des Glaubens hält. Er ist aus den Gräbern und Gräben seines Stellungskrieges ausgebrochen, er glaubt nicht mehr, daß die Feinde stärker seien, als jener, der den Tod überwunden hat.
Der Österreicher schwankt nur zu oft zwischen Selbstgerechtigkeit und Kleingläubigkeit. Das eine steht uns nicht an, und das andere haben wir nicht notwendig. Gott hat uns ein schönes Land gegeben, ein reiches Erbe, er hat unserem Volke viele Gaben geschenkt. Wir müssen sie nur gebrauchen, wir müssen nur selber etwas tun. Das eigene Tun, die eigene Verantwortung, den eigenen Einsatz, den nimmt uns Gott nicht ab. Wir haben viele Jahre bitterster Not und schwerster Belastung gut überstanden. Nicht weil wir Glück gehabt haben, sondern weil wir gearbeitet haben, weil wir Mühe und Sorgen auf uns nahmen, weil wir an unser Land und an uns selbst geglaubt haben. Wir werden auch die kommenden Jahre in Eintracht und Frieden leben, wenn wir zusammenstehen, wenn wir das, was uns trennt, geringer achten gegenüber dem, was uns eint, wenn wir unserem Mitbürger, unserem Nachbar bei allen gegensätzlichen Ansichten immer auch einen ehrlichen Willen und einen ehrlichen Glauben zubilligen. Christ kann nur sein, wer sich bemüht, in seinem Mitmenschen den Bruder zu sehen, auch dann, wenn er seine Überzeugung nicht teilt. Christ kann nur sein, wer sich um den Frieden müht in der kleinen wie in der großen Welt”