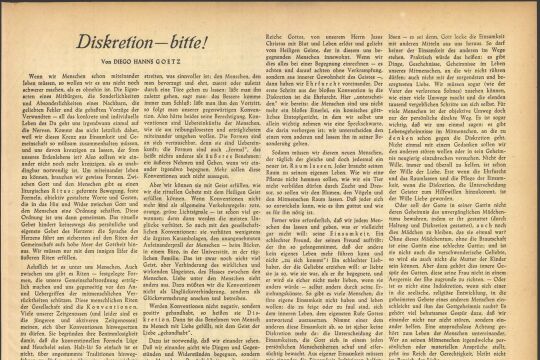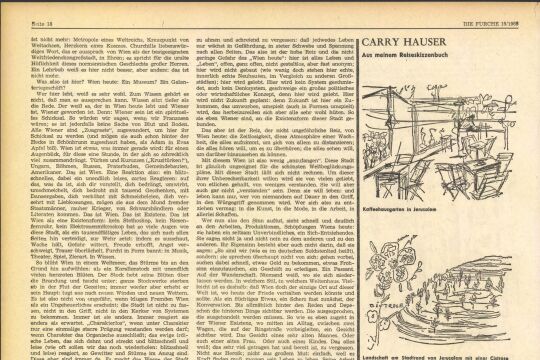Wir fühlen, wie sehr das Problem von Krieg und Frieden uns ans Leben dringt. Und nicht nur als eines offenen Ausbruchs von Gewalt; sondern die Wurzeln des Krieges gehen ja viel tiefer hinab. Der äußere Krieg kann nur entstehen, weil der innere da ist. Worin besteht aber dieser?
Darin, daß in einem begrenzten Bereich auf der kleinen Erde, die immer kleiner wird, verschiedene Initiativen wirksam sind; und nicht nur verschiedene, sondern einander widersprechende. Wie kann aber dergleichen sein? Bleiben wir beim Erkennen — wie ist es möglich, daß Menschen über die Dinge des gemeinsamen Daseins wider einander denken? Es ist doch die glekhe Wirklichkeit, über die sie denken; ihr Geist ist letztlich von der gleichen Logik regiert, und in ihnen — das ist allerdings behutsamer gesagt — lebt doch der gleiche Wille zur Wahrheit!
Vielleicht klingt die Frage töricht. Gegenwart wie Vergangenheit sind so tief vom Widerspruch bestimmt, daß unser Gefühl sich in ihm eingerichtet hat und ihn als normal empfindet. Es ist aber gut, hin und wieder den Schein des Normalen abzustreifen; dann sieht man mit frischen Augen, und die Dinge zeigen sich in ihrer Erstaunlichkeit.
Wie kann also das Denken des einen dem des anderen zuwiderlaufen?
Der Grund ist der gleiche, aus dem auch die Größe des Verhältnisses hervorgeht: die Freiheit.
Der Vulgär-Naturalismus findet den Zustand selbstverständlich. Es sei der nämliche, der überall in der Natur herrsche: der Kampf aller gegen alle. Das ist aber falsch. Unter den Tieren herrscht durchaus nicht der Kampf aller gegen alle, sondern da bestehen genaue Zu-Ordnungen von Raub- und Beutetier. Sobald diese nicht wirksam werden, laufen sie in ihren Funktionsgefügcn und stören einander nicht. Die Möglichkeit eines freiwaltenden, fast möchte man sagen, absoluten Kampfes öffnet sich erst beim Menschen; und es ist ein Zeichen von Phänomenblindheit, ihn mit dem zu verwechseln, was im Tierreich vor sich geht.
Der Mensch steht unter Beeinflussungen verschiedenster Art und Mächtigkeit; es gehört aber zu seinem Wesen, daß er aus den naturhaften Zusammenhängen heraustreten, Distanz nehmen und von da aus den Gegenstand — das Ding wie auch sich selbst — betrachten, verstehen, beurteilen kann.
Diese Tatsache ist ebenso offensichtlich wie staunenswert. Sie gibt dem Kampf des Menschen einen durchaus anderen Charakter, als der des Tieres ihn hat: sie öffnet den Raum, in dem es Entscheidung und damit Verantwortung gibt.
Vielleicht erwidert man aber: Was soll das in den Dingen der Erkenntnis bedeuten? Was kann Entscheidung heißen, wenn es um Wahrheit geht? Ihr gegenüber gibt es doch weder ein Rechts noch ein Links, sondern nur das Ja zu ihrem Sinn!
Das ist richtig — und doch wieder nicht, denn sie ist selbst auf die Freiheit bezogen. Wahrheit gibt es überhaupt nur in dem Raum, den die Freiheit schafft. Was die Erkenntnis sucht, ist die Sinngestalt eines Dings oder eines Geschehens. Diese hat eine große, eigentlich muß man sagen, eine absolute Macht; es ist aber die Macht des Sinnes, nicht die der Gewalt. Sie leuchtet auf; sie trifft in jener bedingungslosen Weise, die jeder kennt, der sein geistiges Leben nicht zerstört hat; aber sie zwingt nicht. Der Geist muß sich ihr öffnen. Er muß ihr erlauben, daß sie in ihm zur Geltung komme. Das kann er tun — er kann es aber auch verweigern. Um ein Wort Nietzsches abzuwandeln: Es kann durchaus geschehen, daß der Verstand sagt: „so ist es“; der Wille aber antwortet: „so darf es nicht sein“, und — der Verstand nachgibt. Dann hat sich c-;was vollzogen, das wie Erkenntnis aussieht;
in Wahrheit hat nur ein Wille sich selbst bestätigt.
Hinter dem scheinbar rein objektiven Verfahren des Verstandes wirken Motive, die alles andere als objektiv sind: Wünsche und Befürchtungen, Zu- und Abneigungen, Absichten in allen Graden der Offenheit und Entschiedenheit. So ist das Feld der Denkvorgänge, die sich den Anschein geben, nichts als Feststellung und Durchdringung von Tatsachen zu sein, zugleich ein Schlachtfeld, auf welchem Initiativen einander gegenübertreten.
Wenn das so ist, dann wäre auch im Geistigen der Kampf unvermeidlich — sagen wir genauer: der Kampf der Gewalt. Allerdings, wenn es nicht das gäbe, was eben diese ganze Situation möglich macht, nämlich die Freiheit.
Sobald Raub- und Beutetier aufeinandertreffen, entsteht der Gewaltkampf mit Notwendigkeit; der Mensch aber hat die Fähigkeit, den Zusammenstoß der Intentionen auf eine höhere Ebene zu heben und schöpferisch
werden zu lassen: er vermag 5nr Gespräch zu treten.
Gespräch zu führen ist etwas, das wir immerfort tun — oder doch zu tun glauben. Aber die Dinge des Alltags sind durch eben ihre Alltäglichkeit verhüllt; so lohnt es sich, über sie nachzudenken. Das Gespräch ruht auf dem Wort, dem erstaunlichen Akt, durch den der Mensch das innerlich Erkannte in das äußere Gebilde aus Lauten hineingibt; es dem anderen zusendet, und für einen kurzen Augenblick steht sein Inneres im Raum zwischen beiden offen. Dann verklingt das Wort, lebt aber nun laut-los im Innern dessen, der es gehört hat. Der bildet an ihm das Gegen-Wort, sendet es zurück, und so baut sich, über die Grenze zwischen Innen und Außen hinweg, die Brücke des Gesprächs, reiner Ausdruck des Menschseins.
Damit es aber zustande komme, müssen die beiden Sprechenden in einem Einvernehmen stehen. Jeder muß überzeugt sein, daß es eine Wahrheit gibt und daß diese Wahrheit größer ist als das, was er für sich allein zu erkennen vermag, und daß diese Wahrheit gilt, daß es der Wahrheit gegenüber keine Herrschaft gibt, sondern einen Dienst, einen Gehorsam. Jeder
muß den anderen achten, weil auch er auf diese Wahrheit bezogen ist. Und jeder muß die Hoffnung haben, mit dem andern zusammen mehr von ihr zu sehen, als er allein zu sehen imstande wäre.
Von hier aus vermag auch jeder die Gedanken des anderen zu verstehen und die eigenen an ihnen zu berichtigen, auszuweiten und zu vertiefen.
Ist das aber möglich, wenn zwischen beiden solche Unterschiede bestehen wie jene, von denen wir gesprochen haben? Wieder müssen wir antworten: Es ist möglich aus der Freiheit heraus.
Frei sein heißt, über die eigene wie immer bedingte Meinungsform hinaus auf die Fülle der Wahrheit zugehen können. Und über die eigene so vielfältig gebundene Individualität hinauszugehen können auf die des anderen; verstehen, wie er in seiner Meinung existiert.
Und nun merken wir, daß in den bisher genannten Vorbedingungen des Gesprächs noch eine fehlt: die Sympathie. Schon Augustinus hat gesehen, daß sie die Voraussetzung für jede lebendige Erkenntnis ist. Wirklich erkennen können wir nur, was wir in irgendeinem Sinne lieben; sparsamer gesagt: dem wir
wohlwollen. Da heraus können wir die Persönlichkeit der anderen mitvollziehen: worin ihr Wesen besteht; was sie erkennend sucht; wie sie zu den Gedanken kommt, die sie ausspricht; was diese Gedanken, über vielleicht unzulängliche öder sogar falsche Aeußerungs-formen hinaus, eigentlich meinen.
In solchem Gespräch gelangt jeder der beiden über die eigene Ansicht hinaus zur umfassenderen Wahrheit; über die eigene Selbstdurchsetzung hinaus in die Großmut gegenüber der Persönlichkeit des anderen.
Was aber das Wort selbst angeht, so ist es nicht nur Signal von Gemeintem, sondern Verleiblichung von Geist. In ihm wird die Wahrheit menschlich. So hat das herkommende Wort des anderen über die bloße Mitteilung eines Gemeinten hinaus“ eine lebendige Macht. Es rührt an jene innere Mitte, die leicht zu fühlen, aber schwer durch Begriffe zu bestimmen Ist: wo Geist und Stoff, Seele und Blut einander durchdringen; wo das Menschsein beginnt. Diese Mitte bringt es in Bewegung und macht, daß aus bloßem Feststellen und Bezeichnen lebendiges Wissen und Bilden wird.
So ist der Ertrag solchen Gesprächs Friede.
Denn es entsteht aus dem Einvernehmen in Wahrheitssorge und wechselseitiger Ehrfurcht; und mit jedem neuen, gemeinsam in die Wahrheit getanen Schritt wird das Einvernehmen tiefer.
Wie aber, wenn die beiden einander nicht verstehen?
Das wird oft der Fall sein, denn echtes Verstehen ist schwer. Ja, man kann zweifeln, ob es überhaupt je vollkommen gelinge; ob der eine je ganz über jene Schranke, welche das Selbst-Sein bildet, hinaus und zum anderen hingelange; ob nicht alles Sprechen letztlich ein Sich-Verhalten auf ein Verborgenes hin sei? Doch das sind Schranken, die sich jedem Verstehen, auch dem wirklich gelingenden, entgegenstellen — wie ist es aber, wenn überhaupt keins zustande kommt? Wenn die Meinungen unversöhnt gegeneinander stehen?
Dann bleibt das Vertrauen auf die Wahrheit und die Bereitschaft, das Gespräch fortzusetzen — eine Form jener großen Tugend, ohne die nichts Menschliches reift, der Geduld. Und auch das ist Friede.
Wir müssen aber noch einmal fragen: Wie, wenn ich zur klaren Einsicht komme, daß die Gedanken des anderen falsch sind?
Dann stehe ich vor einer Grenze, die um so schärfer zu Gefühl kommt, als sie nicht sein muß, aber ist. Ich kann sie aufzulockern suchen, indem ich mich bemühe, dem anderen seinen Irrtum zu zeigen — was nur möglich wird, wenn ich gleichzeitig meine eigene Meinung überprüfe und zur Korrektur bereit bin. Gelingt das aber nicht, dann ist die Grenze endgültig. Denn die gleiche Wahrheit, der wir beide verpflichtet sind, verbietet mir, zu sagen: „was du meinst, ist auch wahr.“ Ich mag die individuellen Bedingungen, unter denen jeder von uns denkt, noch so stark in Rechnung stellen; ich mag noch so aufrichtig die Möglichkeit bedenken, daß ich selbst irre — habe ich aber klar erkannt: „so und so ist es“, dann darf ich nie sagen: „was dem widerspricht, ist auch wahr.“
Es gibt keine Auch-Wahrheit. Was es gibt, ist die Verschiedenheit der Gesichtspunkte; die Dialektik von Aussagen, die von vornherein aufeinander bezogen sind und daher nicht in ausschließendem Widerspruch, sondern in fruchtbarem Gegensatz stehen. Da kann ich sagen: „auch du siehst Richtiges“, und Synthese ist möglich. Sobald sich aber nicht Gegensatz, sondern Widerspruch zeigt, sobald der eine ja sagt, wo der andere verneinen muß, oder der eine gut nennt, was der andere als böse erkennt, dann gibt es keine Synthese mehr, sondern nur das Entweder-Oder, und das heißt der Kampf.
Doch auch noch hierherein wirkt die Ge-sinnnung des echten Dialogs, nämlich in der Achtung vor der Meinung des anderen. Nicht vor dem Inhalt, den sie vertritt; dem, was ich als falsch erkenne, darf ich nie die Ehre der Wahrheit erweisen. Aber vor der Person, die sie trägt, und vor der Tatsache, daß es Menschenmeinung ist. Wenn dann Kampf geschieht, hat er einen anderen Charakter.
Dieser beständige Dialog ist eins der Grundphänomene, die unser Handwerk tragen.
Wir — Autor und Leser, dazwischen Verleger und Buchhändler — dienen dem vielfältigen Ding, das wir Literatur nennen und das seine äußere Form im gedruckten Wort findet. Es entspringt immer neu daraus, daß, im Einvernehmen der Sorge um die Wahrheit — Gerechtigkeit und Schönheit nicht zu vergessen —, das Menschengespräch weitergeht. Welchen Rang die Literatur einer Zeit hat, hängt davon ab, ob und in welcher Weise das geschieht.
Das scheint selbstverständlich; wir haben aber erfahren, daß es das nicht ist. Es gibt eine Art Literatur, die keinen Dialog ausspricht, sondern vor stummen Hörern ein Denk- und Werkprogramm entwickeln muß. In Wirklichkeit ist sie keine Literatur mehr, sondern Propaganda; und was sie will, ist nicht Wahrheit, sondern Macht.
Doch gibt es eine Gefahr, die viel tiefer greift als die bloße Gewalt und aus der allgemeinen kulturellen Entwicklung kommt. In dem komplizierten Vorgang, aus dem
die Literatur entsteht, sind verschiedene Grundbezüge wirksam: das Sprechen und Hören, das Schreiben und Lesen, und endlich, durch die beiden genannten hindurch, das Zeigen und Sehen.
Man möchte annehmen, diese Bezüge hätten im Lauf der Geschichte an Freiheit und Intensität gewonnen. Die Möglichkeit, zu mehr Menschen zu sprechen, gibt dem Wort ja wirklich einen besonderen Ernst; Druck und Verbreitung erweitern seinen Einflußbereich; die Hilfsmittel besseren Zeigens und Sehens bringen Erscheinungen vor Augen, die sonst unbemerkt blieben. Dem Gewinn stehen aber sehr bedenkliche Schädigungen gegenüber, und es ist der Mühe wert, sie sich ein wenig klarzumachen.
„Sprechen“ bedeutet — es wurde bereits gesagt —, daß ich die Erkenntnis, die mir über irgend etwas aufgegangen ist, in das Lautgebilde des Wortes gebe und in ihm zum anderen hinübersende; „Hören“, daß dieser das Wort empfange, der Sinn in seinem Geiste aufleuchte und ihm jene eigentümlicht Freiheit und Festigkeit gebe, die eben „Wahrheit“ heißt.
Wie ist das aber: Sind die Wörter und ihr Gebrauch im Lauf der letzten — sagen wir, hundert Jahre besser geworden? Genauer, tiefer, zeugungskräftiger? Man wird kaum mit einem einfachen Ja antworten können.
Schon die Tatsache, daß so viel und immer mehr gesprochen wird, hat eine verhängnisvolle Wirkung: die Wörter nützen sich ab. Man achte einmal darauf, was geschieht, wenn ein bisher nicht besonders beachtetes Wort aktuell wird — wie lange bleibt es lebendig? Es gehört zu den schlimmsten Erfahrungen jedes Sprechenden, daß er für etwas echt Erkanntes einen guten Ausdruck findet und er nach kurzer Zeit verschlissen ist, einfach dadurch, daß so viele ihn nachsagen, und immer schlechter nachsagen. Man denke etwa daran, was dem Wort „das Nichts“ widerfahren ist, seitdem es vor zwanzig Jahren in der Philosophie aktuell wurde. Scheut man sich nicht, es zu gebrauchen? Aber was soll mäh tun, wenn es kein anderes gibt? Was fängt man mit den zu Tode geredeten Wörtern an? Es bleibt wohl nur eines: immer einfacher zu sprechen, denn die Einfachheit widersteht der Zerstörung. Wer es aber damit versucht hat, weiß, wie schwer es ist. Es ist Meisterschaft.
Etwas anderes ist noch schlimmer: daß die Wörter ihre Tiefe verlieren. Alle echten, aus langer Geschichte heraufgewachsenen Wörter wurzeln in den Gründen des Seins, im Religiösen. Diese Wurzeln sterben aber im Fortgang der neueren Zeit ab. Die Wörter verlieren die Dimension nach innen, die Frömmigkeit. Schlägt man in einem Wörterbuch nach, dann kann einem ganz schwer zumute werden, wenn man sieht, wie flach ein Wort geworden ist, in dem früher die Tiefe redete.
Dann aber gibt es das wirkliche Verbrechen am Wort: die bewußte Verwirrung durch die politische Propaganda. Ueberau stoßen wir heute auf Wörter, bei denen wir von ihnen selbst her nichts wissen, was der Sprechende meint. Sie drücken nicht mehr aus, zeigen nicht mehr, packen nicht mehr. Denn das echte Wort entsteht immerfort aus der Redlichkeit des Wahrheitswillens und der Achtung vor dem Vertrauen des Hörenden; hier aber wird es von der bewußten Lüge regiert, falls nicht der Sinn für Wahrheit überhaupt erstorben ist und es nur noch um Wirkungen geht. Oder kann man behaupten, Wörter wie „der Friede“ oder „das Recht“ oder „die Demokratie“ hätten noch einen deutlichen oder gemeingültigen Sinn? Muß man nicht geradezu eine neue Art des Hörens lernen, nämlich das Vernommene zunächst dahinzustellen und es aus der politischen Position des Sprechens heraus zu interpretieren? Eine Kunst, die früher nur den Diplomaten auferlegt war? Von dem grauenhaften Zustand nicht zu reden, in welchem der Beherrschte antwortet, was die Gewalt geantwortet haben will; mit dem Wort aber nicht mehr den Charakter einer Aussage verbindet, sondern es nur als Attrappe vor sich hinstellt.
Oder man nehme das Schreiben und Lesen; die Verfestigung des gesprochenen Wortes im anerkannten Zeichen, das dann technisch vervielfältigt und zugänglich gemacht wird.
Ist nicht die steigende Häufigkeit und Schnelligkeit des Schreibens eine immer dringlichere Gefahr? Daß nicht mehr der Autor aus dem Inneren heraus gesprochene Wörter, sondern das Schreiben sich selber schreibe? Wenn wir etwa — um ein tägliches Beispiel zu nennen — eine Zeitung lesen: ist das noch ein wirkliches Lesen? Dessen Vorgang besteht doch darin, daß das äußere Druckgebilde das innere Wort weckt und in diesem sich die Sinngestalt offenbart. Dafür besteht aber in
der Regel gar keine Zeit; sondern was wirklich vor sich geht, ist ein flüchtiges Aufblitzen kurzer, oft zerbrochener Sinn-Signale. So haben wir denn auch meistens gleich nach der Lesung so gut wie alles vergessen. Dabei geht aber etwas sehr Schlimmes vor sich: der Akt des Lesens selbst wird verdorben; denn der ist etwas Lebendiges und hält auf die Dauer das bloße Angefunktwerden ohne Schaden nicht aus.
Was hier in besonders deutlicher Weise geschieht, zeigt sich überall in unserem von bedrucktem Papier überschwemmten Dasein. Wenn man noch Gelegenheit hatte, zu beobachten, welche Kraft die Vorstellung, das Gedächtnis, das Denken und Sprechen von Analphaten hat, dann kann einen das scheinbar reaktionäre Wort, alles Unheil habe mit dem Zwang zum Schreiben- und Lesenlernen angefangen, sehr nachdenklich stimmen.
Und was geschieht mit dem dritten, dem Zeigen und Sehen? Zeigen kann, wem sich etwas gezeigt hat. Aus dem unmittelbar Dastehenden hat das Wesen eines Dinges seine Augen berührt, und nun lenkt er — durch die Gebärde der Hand, durch ein deutendes Wort oder ein aufschließendes- Bild — dem anderen den Blick: Sieh, was da herausleuchtet! Man könnte nun denken, unsere Zeit, die überall und mit so glänzender Technik „illustriert“, verstehe das Zeigen aus dem Grunde, und das Sehen werde immer besser. Ist das aber so? Wieder ein alltägliches Beispiel: Im Schaufenster der Photographie-geschäfte stehen wunderbar feine und scharfe Geräte, fähig, die fernsten und flüchtigsten Erscheinungen festzuhalten. So sollte man meinen, sie müßten bewirken, daß die Welt immer formenvoller, tiefer, schöner in die Augen scheine. Ist das der Fall?
Sieht, wer viel photographiert, mehr von der Welt als jener, der es nicht tut, dafür aber seine Augen aufmacht? Im Einzelfall sicher — den Erinnerungswert mancher Aufnahmen nicht gerechnet. Wie steht es aber mit Regel und Durchschnitt? Schauen ist doch ein Sich-Auftun für,die Gestaltenfülle des Daseins — wird durch die Bildabsicht des Photo-graphierens nicht gerade das aufgehoben? Schauen ist ein Hereinnehmen in den inneren Besitz, ins Gedächtnis — wirkt der Apparat nicht so, daß er einem die Anstrengung dieses Vorganges abnimmt? Das Gefühl gibt, man habe das Schöne nun drinnen, während es in Wahrheit durchaus „draußen“, nämlich auf dem Film, bleibt?
Und gewinnt derjenige, der die Bilder betrachtet, reicheren Weltbcsitz? Wir möchten die herrlichen Bände nicht missen, die uns Kunst und Landschaft zeigen — aber auch da hat die. Sache eine andere Seite. Wenn wir zum Beispiel eine illustrierte Zeitung durchgesehen haben — haben wir da wirklich „gesehen“? Hat nicht in Wahrheit ein Bild das andere ausgelöscht? Hat nicht schon die Art, wie die Bilder auf das Interessante hin zugerichtet waren, die echte Fähigkeit des Sehens beirrt? Oder Sind wir nach der Wochenschau im Kino bildmäßig reicher? Wenn da im raschesten Zeitmaß Geschehnis auf Geschehnis
gefolgt ist, und möglichst in Gegensätzen, und von jedem der Gipfelpunkt, das Erregendste? Das Gegenteil ist der Fall.
Es ist einfach nicht wahr, daß die Illustrationstechnik unserer Zeit dem Menschen mehr „Welt“ zu sehen gibt. Man darf ruhig sagen: je mehr Photographierapparate, desto weniger wirklich gesehene Welt.
Ich bitte Sie, hinter dem Gesagten nichts von jener merkwürdigen Romantik vermuten zu wollen, die über den Niedergang der Zeit klagt. Aber in einer Stunde wie dieser besinnt man sich auf das, was dein eigenen Tun zugrunde liegt, und auf die Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellen.
Denn es bedarf keines besonderen Beweises, wie sehr die Erscheinungen, von denen die Rede war, den Dialog erschweren. Wir wollen ihn weder feierlich noch metaphysisch nehmen — so viel ist aber doch wohl klar, daß er um so fruchtbarer wird, je echter das Sprechen ist und je offener das Hören. Je klarer die Dinge des Lebens gesehen sind und je eindringlicher der eine sie dem anderen zu zeigen versteht. Was aber das Lesen angeht — wie oft wird unser Sprechen über die Wirklichkeit richtiger und voller, wenn wir imstande sind, zu sagen: Augustinus hat so gesagt, oder Dante, oder Goethe! Doch dazu muß ihr Wort sich unserem Geist wirklich geöffnet haben.
Was aber für das Gespräch über die Sinnprobleme des Daseins gilt, hat seine Richtigkeit auch für dessen praktische Fragen — und damit kommen wir vom geistigen Frieden zum sozialen und politischen. Es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn man denkt, sehr erhebliche Schwierigkeiten des Miteinander-auskommens entstünden daraus, daß die wie immer Verantwortlichen nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Die Erde wird immer enger, die Entfernungen verringern sich, die Gelegenheiten zur Begegnung häufen sich von Tag zu Tag. Die Menschen aber — und das ist eine der gefährlichsten Paradoxien unseres so ganz und gar nicht fortschrittsicheren Kulturganges — scheinen sich immer ferner zu rücken.
Es ist also — und so kehren wir zu unserer Sache zurück — mit dem Reden, Schreiben und Zeigen allein nicht getan, sondern wir stehen hier vor neuen Problemen und Aufgaben. Sie beschränken sich nicht auf die Sorge, Gutes zu schaffen, sondern fordern eine Erziehung zum rechten Aufnehmen des Guten, damit der Mensch nicht am Guten selbst zu Schaden komme.
Es geht darum, daß er lerne, richtig zu lesen; mit Urteil zu unterscheiden; Selbstzucht zu üben — eine Bemühung, die bereits in der Schule beginnen muß und nie enden darf.
Damit gelangen wir aber in die weite Frage, wie der Mensch, nachdem er die Unabsehlich-keit der neuzeitlichen Kultur hervorgebracht hat, nun auch lernen könne, sie richtig zu gebrauchen — eine Kunst, die er noch sehr wenig zu verstehen scheint. Es ist die Frage, in die heute so gut wie alle Ueberlegungen einmünden.