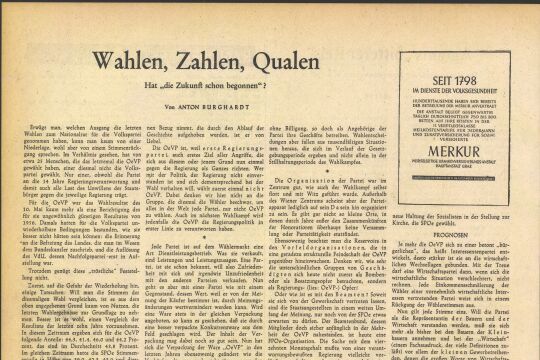Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Politische Folklore
Die am 5. Dezember des letzten Jahres neu gewählten drei Bundesräte, also „Bundesminister“, haben ihr Amt angetreten: Die Schweizer Regierung ist wieder vollzählig, und für den Außenstehenden hat sich außer den Namen nichts geändert. Tatsächlich ist die parteipolitische Zusammensetzung die gleiche wie vorher. Die sogenannte „Zauberformel“, wonach der siebenköpfige Bundesrat aus zwei Christlichdemokraten, zwei Sozialdemokraten, zwei Freidemokraten und einem Bauern zusammengesetzt sein soll, ist unangetastet geblieben. Seit dem Jahre 1959 ist sie eine bleibende Konstante schweizerischer Innenpolitik, und an Konstanten rührt der Schweizer nur im äußersten'Notfall.
Trotzdem haben die letzten Bundesratsersatzwahlen (Wahlen, die verfassungsmäßig von den beiden Kammern, also dem National- und dem Ständerat, vorgenommen werden) die politische Landschaft verändert. Weniger durch das, was sie gesetzt, als vielmehr durch das, was sie übergangen haben.
Es hatte gegolten, Nachfolger für den freidemokratischen Finanzminister Nello Celio, den christlichdemokratischen Verkehrs- und Energie-minister Roger Bonvin und für den sozialdemokratischen Innenminister Hans Peter Tschudi zu bestellen, wobei zu betonen ist, daß ein schweizerischer Innenminister international eher einem Bildungs- oder Schul- oder Erziehungs- oder auch Forschungsminister vergleichbar ist.Durch die Vakanzen waren also alle drei großen Parteien berührt, aber — und dies fiel wesentlich ins Gewicht — auch alle drei Sprachregionen.
Die drei direkt betroffenen Parteien nominierten offizielle Kandidaten: die Christlichdemokraten den Tessiner Enrico Franzoni, die Freidemokraten den Genfer Henri Schmidt und die Sozialdemokraten den Aargauer Arthur Schmid. Als diese drei Namen feststanden, begann die Unruhe. Der Christlich-demokratischen Volkspartei (CVP) wurde vorgeworfen, ihre besten Leute übergangen zu haben, nur um einen Tessiner zu nominieren, doch war das Ausweichen auf Franzoni für gewisse Kreise auch eine Flucht aus der Angst vor einem starken Mann. Die Sozialdemokraten hätten neben Schmid vor allem zwei gute Leute zur Verfügung gehabt: einen aus dem linken, den andern aus dem rechten Flügel. Um dieser politischen Entscheidung zu entgehen, einigte man sich auf den schwächeren Mann der Mitte, auf den Parteipräsidenten Schmid. Für die Freidemokraten schließlich war die Lage etwas anders. Niemand bestritt Henri Schmidts Fähigkeiten, aber für viele Leute in der Partei, und noch mehr außerhalb der Partei, stand er doch ein wenig zu weit rechts. Das Kesseltreiben setzte ein, und die politischen Alchimisten aller Schattierungen waren sich am' Vorabend der Wahl nur in einem Punkte einig: es sei überhaupt alles offen. Man richtete sich auf einen langwierigen Wahlakt
Die erste Wahl betraf den Nachfolger des ausscheidenden Sozialdemokraten, und in einem einzigen Durchgang wurde nicht der offizielle Kandidat, sondern der in der Partei rechtsstehende Solothurner Willi Ritschard erkoren. Die gleiche Überraschung brachte der zweite Akt, da wiederum im ersten Wahlgang nicht der offizielle Tessiner CVP-Kandidat, sondern der Zuger Hans Hürlimann gewählt wurde. So war dann niemand mehr überrascht, daß auch die Freidemokraten nicht ihren Kandidaten, sondern den Waadtländer Georges-Andre Chevallaz vorgesetzt bekamen. Die Parteisekretariate waren verdutzt, aber die Öffentlichkeit War einig in der Auffassung, daß die JSTeü gewählten besser seien als die drei unterlegenen offiziellen Kandidaten.
Natürlich ist es eine schweizerische Besonderheit, daß die Minister aus der Gesamtheit des Parlaments ausgewählt werden, und es ist zweifellos für die Parteileitungen nicht unbedingt erfreulich, nun in der Regierung durch Leute vertreten zu sein, die nicht von ihnen auserkoren wurden und die in erster Linie dank des Vertrauens der Gegenpartei auf den Sessel erhoben wurden. Die Frage aber, ob diese Ausgangslage verändert werden sollte, kann nicht so ohne weiteres mit einem Ja oder einem Nein beantwortet werden.
Der CVP-Generalsekretär Urs C. Reinhardt ist mit sehr scharfen Worten dreingefahren, und mit einer gefährlichen Drohung versuchte er, für den nächsten „Ernstfall“ die Weichen zu stellen, indem er schrieb: „Die .Koalitions-Disziplin' wurde auf die Wahrung der Regierungssitze eingeschränkt. Damit hat man das Vorschlagsrecht der Fraktionen zur politischen Folklore degradiert... Die .Koalition' hat es 1973 noch einmal zustande gebracht, die Zusammensetzung des Bundesrates gemäß der 1959er Formel zu .retten'. Ob dies bei der nächsten Vakanz wiederum gelingt beziehungsweise gewollt wird, ist eine durchaus offene Frage. Wenn die Regierungsfraktionen derart weiterwursteln, könnten sich sehr bald andere Konstellationen ergeben.“ Und er fügte den selbstbemitleidenden Ausruf an: „Jeder offizielle Kandidat läuft Gefahr — man verzeihe den herben Ausdruck —, von den vereinigten Hyänen und Mistkäfern aus Politik und Publizistik zur Strecke gebracht zu werden. Wir haben es in der Tat herrlich weit gebracht.“
Solch harte Töne ist man in der Schweiz nicht gewohnt. Wenn sie nur aufschrecken wollten, wären sie zu begrüßen, wenn sie aber drohen wollten, waren sie fehl am Platz. Vor allem ist es politisch falsch, in einer direkten Demokratie, wo der Bürger auch zu Sachfragen immer wieder über alle Parteiabsprachen hinweg zu entscheiden hat, von einer „Regierungskoalition“ zu sprechen.
Der freisinnige Pressedienst hat denn auch sofort gekontert und unterstrichen, daß die vier in der Regierung vertretenen Parteien zu Beginn der jetzigen Legislaturperiode, also 1971, eine Vereinbarung über die gemeinsamen Ziele unterzeichnet hätten, die ausdrücklich die verfassungsrechtliche Freiheit des Parlamentariers hervorgehoben haben. Mit Recht wird betont: „Bundesratskandidaturen dürfen doch wohl noch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, und der Bürger hat ein Recht darauf, über diesen oder jenen Kandidaten Informationen zu erhalten, damit er sich überhaupt eine Vorstellung machen kann, wer in die Landesregierung einziehen soll. Wenn sich da .Mistkäfer' und .Hyänen' einschleichen, dann sind sie als solche zu identifizieren und nicht pauschal abzutun.“
Die letzten Bundesratswahlen haben also Bodensatz aufgewirbelt. Jene Parteien aber, die offenbar weiterhin mit Absprachen ihrer Sekretariate regieren möchten, könnten bei den nächsten Gesamterneue-rungswahlen zum Parlament, also im Oktober 1975, ungut aus ihren Träumen erwachen. Für einmal ist die Öffentlichkeit nämlich mit dem Entscheid ihrer Parlamentarier zufrieden und beglückwünscht sie sogar zum Mut, sich über die Parteiparolen hinweggesetzt zu haben.
Die Neubildung des Bundesrates hat aber noch etwas anderes gezeigt. Vor diesen Dezemberwahlen hörte man im bürgerlichen Lager immer wieder das Begehren, die Sozialdemokraten sollten nun endlich das unbeliebte Finanzministerium übernehmen. Vor allem hätte man gerne einem Sozialisten die undankbare Aufgabe zugeschanzt, die Mehrwertsteuer einzuführen. Nun ist der Sozialdemokrat Willi Ritschard in die Regierung eingezogen und hätte, nachdem er bisher Finanzminister in seinem Heimatkanton Solothurn war, eigentlich alle Voraussetzungen mitgebracht, um den Wechsel nun zu realisieren. Die Zuteilung der „Departemente“, also der Ministerien, wird von den sieben Regierungsmitgliedern selbst vorgenommen, und siehe da: der Finanzfachmann Ritschard wurde Verkehrs- und Energieminister, und das Finanzministerium bleibt weiterhin in freisinnigen Händen. Warum? In erster Linie darum, weil die bürgerlichen Bundesräte ihren neuen sozialistischen Kollegen nicht über Gebühr belasten wollten. Er, der ja weitgehend „gegen“ seine eigene Partei regieren muß, wäre wohl zu schnell verbraucht, wenn er zu allem Überfluß auch.noch die. Last des im. Umbruch befindlichen Finanzministeriums zu tragen hätte. So kollegial überlegten offensichtlich seine Kollegen und haben damit bewiesen, daß das Kollegialsystem, wie es in der Schweiz gilt, keine leere Farce ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!