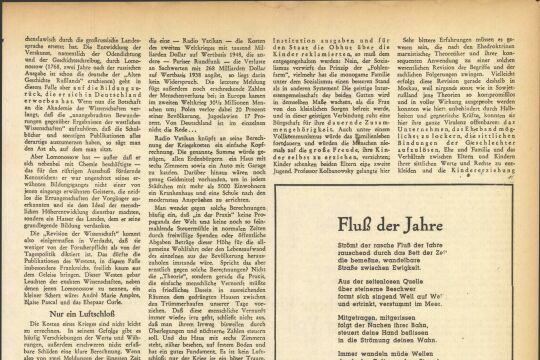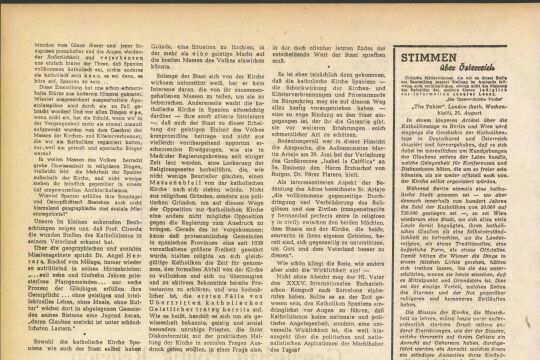Trautes Heim, aber lieber allein
Vieles, was sich Männer und Frauen um die Ohren schla- gen, hat seine Wurzeln in einerfamilienfeindlichen Be- rufswelt. Die Arbeitsbedin- gungen von heute fördern Scheidungen von morgen.
Vieles, was sich Männer und Frauen um die Ohren schla- gen, hat seine Wurzeln in einerfamilienfeindlichen Be- rufswelt. Die Arbeitsbedin- gungen von heute fördern Scheidungen von morgen.
Trägt das Modell der Ehe, der Elternschaft, der Weiblichkeit, der Männlichkeit, in der das Leben weitgehend unbefragt verlief, auch noch für den eigenen Lebensent- wurf und für den Lebensentwurf der kommenden Generation? Sind wir Augenzeugen eines säkularen Wandels, in dessen Verlauf die Men- schen aus den Lebensformen der Industriegesellschaft „entlassen" werden, ähnlich wie sie im Zeital- ter der Reformation aus den Si- cherheiten der Kirche in die irdi-
sehe Suche nach Gleichheit und Glück „entlassen" wurden?
Auf diese unbescheidene Frage gibt auch die empirische Sozialfor- schung keine eindeutige Antwort. Gewiß, auf der einen Seite haben sich die Frauen epochale Gleich- stellungen erkämpft. Doch nach wie vor sind in aller Regel sie es, die wischen, waschen und windeln - trotz Erwerbsbeteiligung. Und wie sich nun herausstellt, haben sie in der Berufswelt in den letzten Jah- ren wohl einige „sinkende Schiffe" erobert. Typische Frauenberufe sind oft solche, deren Zukunft durch Rationalisierungen bedroht ist. Zu- sammengenommen hat dies den pa- radoxen Effekt: das Mehr an Gleich- heit (in Recht und Bildung) macht die Ungleichheiten (in Beruf, Fa- milie, Politik) bewußter, ungerech- ter, konfliktvoller. Wir Männer rea- gieren darauf pfiffig und dumm zu- gleich. Wir betreiben eine Politik der verbalen Zugeständnisse. Es herrscht die Illusion vor, mit einer gut eingeübten Rhetorik der Gleich- heit und einem Schuß Biologie - Mutterschaft! - sei die alte Ord- nung zu halten.
Mit fortschreitender Modernisie- rung vermehren sich auch in der Familie die Wahlmöglichkeiten und Entscheidungszwänge. Alles muß erörtert, gerechtfertigt, in seinen Folgen durchdacht werden - mit dem Effekt: bislang Selbstverständ- liches verwandelt sich in Konflikt- quellen; die Institution Familie zerfällt in die gegensätzlichen Lagen von Frauen und Männern.
Mit leichter Übertreibung kann man sagen: „anything goes". Wer wann den Abwasch macht, die Schreihälse wickelt, den Einkauf besorgt, den Staubsauger herum- schiebt, wird ebenso unklar, wie wer die Brötchen verdient, die Mobilität bestimmt, und warum eigentlich die schönen Nachtseiten des Bettes immer mit dem qua Stan- desamt hierfür vorgesehenen, an- getrauten Alltagsgegenüber genos- sen werden sollen dürfen. Ehe läßt sich von Sexualität trennen und die noch einmal von Elternschaft, die Elternschaft läßt sich durch Schei- dung multiplizieren und das Ganze durch das Zusammen- oder Ge- trenntleben dividieren und mit mehreren Wohnsitzmöglichkeiten und der immer vorhandenen Revi- dierbarkeit potenzieren.
Was hier über die Familie an Enttabuisierungen hereinbricht, dividiert die ehemals in ihr zusam- mengefaßten Lagen Stück für Stück auseinander: Frau gegen Mann, Mutter gegen Kind, Kind gegen Vater. Das fängt im Grunde ge- nommen schon bei der konventio- nellen beruflichen Mobilitätsent- scheidung an. Der Arbeitsmarkt fordert Mobilität unter Absehung von persönlichen Umständen. Ehe und Familie fordern das Gegenteil. Die Gretchenfrage lautet dann: Wer
verzichtet auf ökonomische Selb- ständigkeit und Sicherheit, also auf das, was in unserer Gesellschaft die selbstverständliche Voraussetzung der Lebensführung ist? (Soweit dies überhaupt schon eine Frage ist.)
Manche meinen nun, daß genau hier der Hebel für die Restabilisie- rung von Familie und Arbeitsmarkt liegt: Die „Frauenfrage" sei in die Frage der „Neuen Mütterlichkeit" umzuwandeln und abzuschieben. Auf den ersten Blick scheinen die ökonomischen Bedingungen diese Politik zu begünstigen.Von einer selbständigen, beruflich gesicher- ten Lebensführung ist die Mehrheit der Frauen weit entfernt. Auch heute sind (bei steigendem berufli- chem Engagement) erst über die Hälfte (51,7 Prozent) aller Frauen zwischen 15 und 65 Jahren erwerbs- tätig (einschließlich Erwerbslosen). Anders gewendet bedeutet dies: Ein großer Teil der Frauen bleibt auf die Versorgung über Ehe und Ehe- männer angewiesen.
Doch Hausfrauen sind nicht mehr Hausfrauen. Sie haben - im Durch- schnitt - die gleiche Ausbildung
wie ihr Ehemann und von ihren Müttern trennt sie oft die Welten- differenz der Unfreiwilligkeit. Eher fraglich ist auch, ob die nachwach- sende Männergeneration das Joch der lebenslangen Alleinernährer- rolle noch einmal auf sich nimmt. Am Ende dürften die Barrieren des Arbeitsmarktes nur scheinbar die Kleinfamilie stabilisieren, tatsäch- lich aber genau im Gegenteil die Gänge vor den Scheidungsrichtern füllen oder die Wartezimmer der Eheberater.
Gleichzeitig wird auf diese Weise die neue Armut der Frauen vorpro- grammiert. Wer unter den Bedin- gungen wachsender Scheidungs- zahlen die Frauen aus dem Arbeits- markt heraus, und an den Herd zu- rückdrängt, muß wissen, daß er für einen Teil der Gesellschaft die Löcher im sozialen Netz reserviert.
Dies verweist auf prinzipielle Mängel im Denken und Handeln aller Versuche, die alten Verhält- nisse zwischen Männern und Frau- en in Familie und Beruf wiederher- zustellen. Erstens stehen sie im of- fenen Widerspruch zu den inzwi-
schen rechtlich fixierten Grundsät- zen moderner, demokratisch ver- faßter Gesellschaften, nach denen ungleiche Positionen nicht qua Geburt zugewiesen, sondern über Leistimg und Erwerbsbeteiligung, die allen offensteht, erworben wer- den. Zweitens werden die Verände- rungen innerhalb der Familie und zwischen den Geschlechtern auf ein privates Phänomen und Problem hin verkürzt.
Modernisierung ist aber kein Fia- ker, aus dem man, wenn es einem nicht paßt, an der nächsten Ecke wieder aussteigen kann. Wer wirk- lich die Kleinfamilie in den Formen der fünfziger Jahre wiederherstel- len will, muß die Uhren der Moder- nisierung zurückdrehen, das heißt: nicht nur versteckt - zum Beispiel durch Mutterschaftsgeld oder durch Imagepflege der Hausarbeit - die Frauen aus dem Arbeitsmarkt ver- drängen, sondern offen, und zwar nicht nur aus dem Arbeitsmarkt, sondern gleich auch aus der Bil- dung; das Lohn- gefälle wäre zu verstärken; letzt- lich müßte auch die gesetzliche Gleichstellung rückgängig ge- macht werden: Es wäre zu prüfen, ob das Unheil nicht schon beim Wahlrecht ange- fangen hat.
Als Gegenfor- derung wird die Forderung nach Gleichstellung der Frauen in al- len gesellschaftli- chen Bereichen erhoben. In den Diskussionen der Frauenbewegung wird diese Gleichheitsforderung meist mit dem Anspruch auf Ver- änderung der „Männerwelt Beruf" verbunden. Gekämpft wird für öko- nomische Sicherheit, Einfluß, Mit- bestimmung der Frau, aber auch, um dadurch andere „weibliche" Orientierungen, Werte und Um- gangsformen in das gesellschaftli- che Leben hineinzutragen. Was dabei „Gleichheit" im einzelnen heißt, bleibt interpretationsbedürf- tig. Hier soll eine - meist ungesehe- ne - Konsequenz einer bestimmten Interpretation zur Diskussion ge- stellt werden. Wenn „Gleichheit" im Sinne der Durchsetzung der Ar- beitsmarktgesellschaft für alle gedeutet und betrieben wird, dann wird mit der Gleichstellung letzt- lich die vollmobile Single-Gesell- schaft geschaffen.Die Grundfigur der durchgesetzten Moderne ist - zu Ende gedacht - der oder die Al- leinstehende. Wer die Mobilität am Arbeitsmarkt ohne Rücksicht auf private Belange einklagt, betreibt - gerade als Apostel des Marktes - die Auflösung der Familie. Dieser Widerspruch zwischen Arbeits- markt und Familie (oder Partner- schaft ganz allgemein) konnte so lange verdeckt bleiben, wie Ehe für Frauen gleichbedeutend war mit Familienzuständigkeit, Berufs- und Mobilitätsverzicht. Er bricht heute in dem Maße auf, in dem die Tei- lung von Berufs- und Familienar- beit in die Entscheidung der (Ehe-) Partner gelegt wird.
Doch in dem Maße, in dem diese individualisierte Existenzführung gelingt, wächst die Gefahr, daß sie zu einem unüberschreitbaren Hin- dernis für die ja meist doch ange- strebte Partnerschaft (Ehe, Fami- lie) wird. In dem Single-Dasein wächst die Sehnsucht nach dem (der) anderen ebenso wie die Un- möglichkeit, diesen Menschen in den Bauplan des nun wirklich „eigenen Lebens" überhaupt noch aufnehmen zu können.
Beide Extremszenarien verken- nen den Grundsachverhalt, der hier im Zentrum steht. Die aufbrechen- den Widersprüche zwischen Fami- lie und Arbeitsmarkt werden dort durch eine Konservierung der Fa- milie, hier durch eine Generalisie- rung des Arbeitsmarktes nicht ge- löst. Diese epochalen Ungleichhei-
ten sind vielmehr in die Grund- schematik der Industriegesell- schaft, ihr Verhältnis von Fami- lien- und Erwerbsarbeit eingebaut. Entsprechend können sie auch nicht durch eine Begünstigung von „Wahlfreiheit" zwischen Familie und Beruf aus der Welt geschafft werden. Erst in dem Maße, in dem das gesamte institutionelle Gefüge der Industriegesellschaft auf die Lebensvoraussetzungen von Fami- lie und Partnerschaf t hin verändert wird, kann eine neue Art der Gleich- stellung erreicht werden.
Beginnen wir mit der arbeits- marktbedingten Mobilität. Zum einen wäre es denkbar, die Indivi- dualisierungseffekte der Mobilität selbst abzupuffern. Bislang wird mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgegangen, daß Mobilität individuelle Mobilität ist. Die Familie, und mit ihr die Frau, zieht mit. Die damit aufbrechende Alter- native: Berufsverzicht der Frau (mit _ allen Langzeit- konsequenzen) oder „Spagatfa- milie" (als erster Schritt zur Schei- dung), wird den Eheleuten als per- sönliches Problem zugeschoben. Demgegenüber wären partner- schaftliche For- men der Arbeits- marktmobilität zu erproben und zu institutionali- sieren. Nach dem Motto: wer den (die) eine(n), will, muß auch dem (der) anderen eine Beschäftigung verschaffen. Das Arbeitsamt müßte eine Berufsbe- ratung und -Vermittlung für Fami- lien organisieren. Auch die Unter- nehmen (der Staat) müßten die „Werte der Familie" nicht nur be- schwören, sondern durch partner- schaf tliche Beschäftigungsmodelle (möglicherweise über mehrere Be- triebe hinweg) sichern helfen. Pa- rallel wäre zu prüfen, ob in be- stimmten Bereichen nicht bestehen- de Mobilitätszwänge abgebaut werden könnten (etwa im akade- mischen Teilarbeitsmarkt). Auf der- selben Linie liegt die soziale und rechtliche Anerkennung von Im- mobilität aus familial-partner- schaftlichen Gründen. Für die Be- messung der „Zumutbarkeit" von Arbeitsplatzwechseln müßten auch die Gefährdungen der Familie mit aufgenommen werden.
Ähnliche Effekte können dann vielleicht auch vpn ganz anderen Ansatzpunkten her, zum Beispiel dadurch erzielt werden, daß der Zusammenhang zwischen Exi- stenzsicherung und Arbeitsmarkt- beteiligung insgesamt gelockert wird. Sei es, daß die Sozialhilfe in Richtung Mindesteinkommen für alle Bürger aufgestockt wird; sei es, daß Gesundheits- und Alterssiche- rung von Erwerbsarbeit abgekop- pelt geregelt werden.
Doch selbst eine „familienfreund- lich" gedrosselte Arbeitsmarktdy- namik wäre nur die eine Seite. Das soziale Zusammenleben der Men- schen müßte neu ermöglicht wer- den. Die in ihren Sozialbeziehun- gen ausgedünnte Kleinfamilie stellt eine ungeheure Arbeitsintensivie- rung dar. Vieles, was gemeinsam über mehrere Familien hinweg leicht(er) gelöst werden kann, wird, wenn man ihm allein gegenüber- steht, zu einer Dauerüberforderung. Das beste Beispiel hierfür sind wohl die Aufgaben und Sorgen der El- ternschaft. Doch mehrere Familien übergreifende Lebens- und Unter- stützungszusammenhänge werden meist schon durch die Wohnver- hältnisse ausgeschlossen.
Vieles, was sich Männer und Frau- en heute um die Ohren schlagen, haben sie nicht persönlich zu ver- antworten. Wenn sich diese Ein- sicht Bahn bricht, wäre viel, viel- leicht sogar die zu den Veränderun - gen erforderliche politische Ener- gie gewonnen.