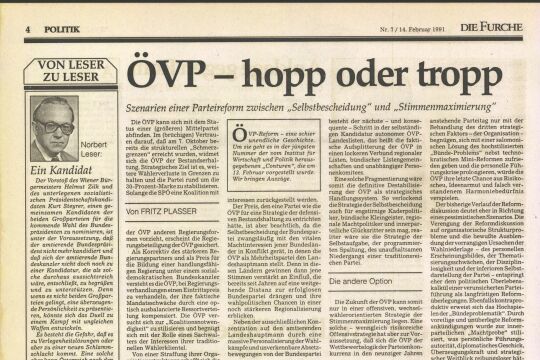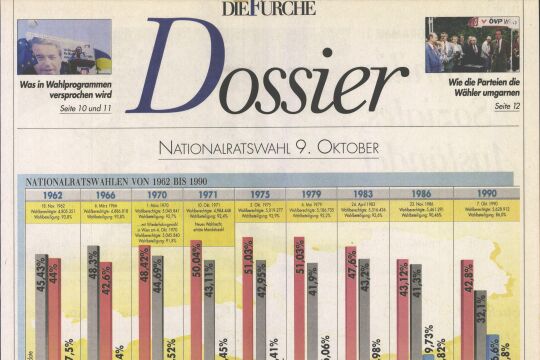Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwang der Umstände als rettender Ausweg
Die starke Konzentration auf eine Persönlichkeit, die auf dem Umweg über eine erfolgreiche Banklaufbahn relativ spät in die Politik gekommen ist, bedeutet für die SPÖ nach wie vor eine große Chance, sich in der dominierenden Position, die sie auch nach diesen Wahlen im Parteiensystem einnimmt, zu behaupten. Sie gibt aber auch Franz Vranitzky selbst eine in der Parteigeschichte überaus seltene Möglichkeit, nicht bloß Verwalter der Tradition zu sein und zu bleiben, sondern gestaltend einzugreifen.
Diese Möglichkeit wäre besonders groß, wenn es am nächsten Parteitag zu der von vielen erwarteten Übernahme des Parteivorsitzes durch Vranitzky und damit zu einer Wiedervereinigung der traditionell miteinander verbundenen Funktionen des Regierungschefs und des Partei vor sitzenden käme.
Im Wahlkampf hat sich die SPÖ mehr oder weniger hinter Vranitzky versteckt, obwohl die geballte Macht der Organisation zur Unterstützung Vranitzkys eingesetzt wurde.
In Zukunft aber kann sich die Partei, ob als führende Kraft in der Regierung oder als Oppositionspartei gegenüber einer zwar unwahrscheinlichen, aber keineswegs unmöglichen schwarz-blauen Koalition, eine neue Standortbestimmung und die Erarbeitung eines neuen Selbstverständnisses nicht ersparen.
Sie muß vielmehr programmatisch und gedanklich nachvollziehen, was sie unter dem Zwang der Umstände als rettenden Ausweg, der sich auch tatsächlich als solcher erwiesen hat, akzeptierte, ohne sich und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Tragweite der eingetretenen Veränderungen abzulegen.
Im Wahlkampf konnte man mit einigen gefälligen Floskeln über die eigentlichen Probleme und wunden Punkte hinweggleiten. In Zukunft wird man sich den heiklen Fragen stellen und Antworten geben müssen, die die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, die bisher bestand, beseitigt.
Vranitzky kann und muß seine gestärkte Autorität in Hinkunft in die Waagschale werfen, um die SPÖ zu diesem neuen Selbstverständnis, zu diesem Nachvollzug dessen, was an der Spitze schon geschehen ist, nun aber auch zu den Funktionären und Mitgliedern durchsickern muß, zu verhelfen.
Er darf, wenn er dieser Aufgabe historisch gerecht werden will, seine Funktion nach bewährter Manier nicht bloß darin erblik-ken, die widerstrebenden Teile und Flügel der Partei zusammenzuhalten und nach dem Motto „Für jeden etwas“ als Integrationsfigur in Erscheinung treten.
Er dürfte die Auseinandersetzung mit den konservativen und traditionalistischen Kräften in der SPÖ, die sich nicht so leicht geschlagengeben werden und versucht sein könnten, Vranitzky über kurz öder lang das Schicksal Helmut Schmidts zu bereiten, nicht scheuen, sondern müßte bereit sein, es auf eine Konfrontation und wenn nötig auch auf eine Trennung von kleinen, aber lautstarken Minderheiten ankommen zu lassen.
Denn eines ist im Laufe dieses Wahlkampfes klargeworden und ist wohl Vranitzky besonders klar: daß der Sozialismus alter, traditioneller Prägung eine unverkäufliche Ware ist, die man auch intern aus dem Verkehr ziehen sollte. Nur als linke Volksund Integrationspartei hat die SPÖ weiterhin die Chance, mehrheitsfähig zu bleiben und ihre führende Rolle im Parteiensystem zu erhalten.
Die SPÖ wäre gut beraten, wenn sie sich längst fälligen Reformen und Gesinnungsänderungen nicht länger verschließt und auch auf Reformvorschläge zur Demokratiereform eingeht, ja die Initiative zu ihnen ergreift. Denn die sprunghafte Zunahme der Stimmen für Jörg Haider und die FPÖ ist ein alarmierendes Signal, nicht nur für die ÖVP, der Haider am meisten geschadet hat, sondern auch für die SPÖ.
In diesem Sinne sind beide Großparteien, die auf absehbare Zeit über eine bequeme Mehrheit miteinander verfügen und doch beim Umsichgreifen der Tendenz dieser Wahl in echte Defensivsituationen und Notstände aller Art geraten könnten, die sie ihrer Mehrheit nicht froh werden ließen, herausgefordert und aufgerufen, zusammen und jede für sich Maßnahmen zu treffen, die geeignet erscheinen, der Erosion des Parteiensystems herkömmlicher Art, für die der Erfolg Haiders und der Grünen ein Symptom ist, entgegenzuwirken.
Die Großparteien und besonders die SPÖ haben an den Folgen jener Weichenstellung der Wahlrechtsreform 1970, die kleine Parteien begünstigte und ihnen Mandate nicht teuer, sondern billig machte, zu tragen und sich inmitten der veränderten politischen Landschaft eines Vierparteiensystems zurechtzufinden. Sie hätten es in der Hand gehabt, durch ein mehrheitsförderndes Wahlrecht ein Zweiparteiensystem zu etablieren und so die notwendige Pluralisierung und Auflockerung des Parteiensystems im amerikanischen Sinne innerhalb und zwischen den Großparteien verlaufen zu lassen.
Nun, da ein Vielparteiensystem vorhanden ist und auch durch ein persönlichkeitsbezogeneres
Wahlrecht wohl nicht mehr wegzubekommen ist, muß mit dem Vorhandenen vorlieb genommen und versucht werden, das Beste aus einer verfahrenen Situation zu machen.
Wir tragen im Guten wie im Bösen an den Spätfolgen der Ära Kreisky, die im übrigen in vieler Hinsicht inhaltlich ausgeklungen und überholt ist: so ist die Rechnung Bruno Kreiskys, die ÖVP dauernd von der Macht fernzuhalten, offenbar nicht aufgegangen.
Viel eher scheint die Rechnung, die FPÖ zu einer Mittelpartei hochzustilisieren, aufzugehen. Ob sich das allerdings als Vorteil für. die SPÖ erweist, muß füglich bezweifelt werden, denn insgesamt stellt das Wahlergebnis doch, wenn man SPÖ und Grüne auf der einen, ÖVP und FPÖ auf der anderen Seite des politischen Spektrums ansiedelt, einen Rechtsruck und jedenfalls keinen Grund zum Jubel für die SPÖ dar.
Der Autor ist Professor für Sozialphilosophie an der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!