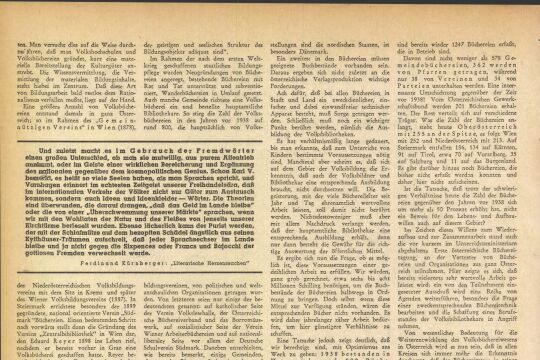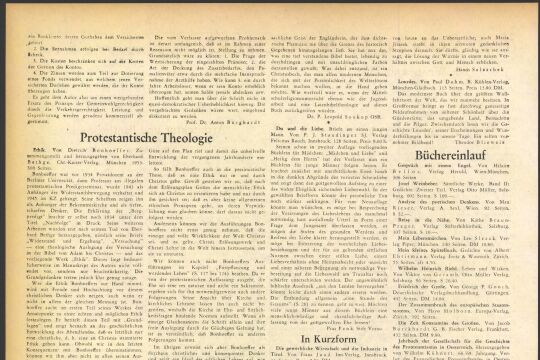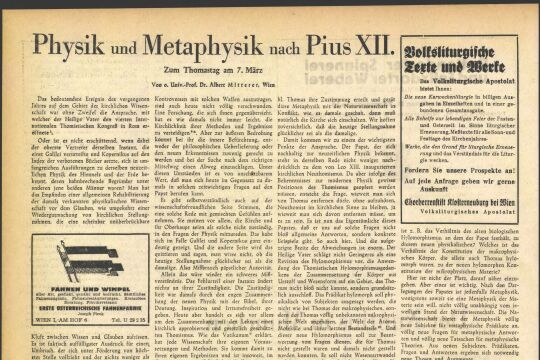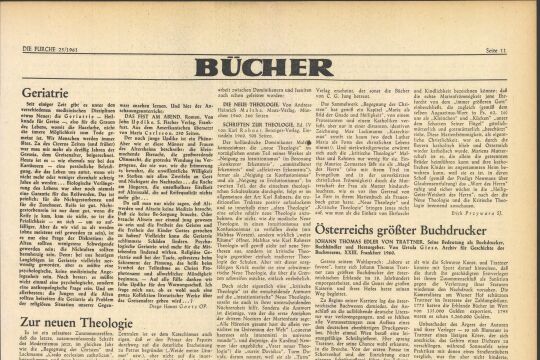Ulrich H. J. Körtner widerspricht Benedikts XVI. "polemischer Formel" von der "Enthellenisierung".
Das Christentum als "denkender Glaube" (Carl Heinz Ratschow) hat eine begrifflich argumentierende Theologie entwickelt, deren Reflexionskultur und philosophisch geprägte Lehrgestalt sich bis heute von anderen Religionen signifikant unterscheidet. Bei allen bestehenden konfessionellen Unterschieden gibt es im Christentum ein gemeinsames theologisches Erbe, das in starkem Maße durch die Begegnung des jungen christlichen Glaubens mit dem griechischen Denken geprägt wurde.
Was ist angesichts dieser historischen Umstände von der Forderung nach einer Enthellenisierung des Christentums zu halten, die seit dem 19. Jahrhundert diskutiert wird und auch von manchen Spielarten kontextueller Theologien erhoben wird? In seiner Regensburger Vorlesung vom September 2006 hat Papst Benedikt XVI. diesem Programm eine klare Absage erteilt. Er sieht darin die Aufkündigung des Bündnisses von Vernunft und Glaube, die unweigerlich zum Irrationalismus in der Religion einerseits und zum nihilistischen Materialismus und Werteverfall andererseits führen muss.
Die in seiner Rede geäußerte Kritik am Islam hat dem ehemaligen Theologieprofessor Ratzinger scharfen Protest eingehandelt. Dass sich die eigentliche Stoßrichtung seiner Vorlesung gegen das Erbe der Reformation und den modernen Protestantismus richtete, ging in der öffentlichen Erregung weitgehend unter. Die zum Teil bedenklichen islamischen Reaktionen auf die Rede des Papstes haben vor Augen geführt, wohin Theologie und Kirche geraten, wenn christlicher Freimut im Reden und Denken - das Neue Testament nennt ihn parresia - gegen eine interreligiöse "political correctness" und Denkverbote eingetauscht werden. Ironischerweise bleibt in dieser Hinsicht gerade das Erbe der protestantischen liberalen Theologie, mit der Ratzinger ins Gericht geht, vorbildhaft.
Eine komplexe Beziehung
Die Beziehungen zwischen Christentum und griechischem Denken sind einigermaßen komplex. Sie beginnen damit, dass das Neue Testament auf Griechisch verfasst worden ist. Dass sich die ersten christlichen Autoren des Griechischen, der Lingua franca der Spätantike, bedienten, kann in seiner theologischen Bedeutung ebenso wenig überschätzt werden wie die Tatsache, dass die griechische Version der jüdischen Bibel, die Septuaginta, das Alte Testament der ersten Christen war. Weil Theologie ihrem Wesen nach nichts anderes als konsequente Exegese ist, bleibt sie an die griechische Sprache verwiesen. Die Wurzeln des Christentums liegen freilich nicht im Griechentum, sondern im Judentum und im hebräischen Denken des alttestamentlichen Urtextes.
So ist auch beim griechischen Wortlaut biblischer Texte zwischen biblischem und antikem philosophischen Sprachgebrauch sorgfältig zu unterscheiden, wie überhaupt zwischen den Texten und ihrer späteren Auslegung. Jede Interpretation ist am Text zu überprüfen und darf sich nicht an seine Stelle setzen. Die fundamentale Bedeutung der griechischen Sprache für Exegese und Theologie darf nicht mit deren Festlegung auf eine bestimmte Form der griechischen Philosophie verwechselt werden. Darin hatte der vom Papst gescholtene protestantische Kirchenhistoriker Adolf von Harnack (1851-1930) völlig recht, auch wenn man seinen Vorstellungen von einem gänzlich undogmatischen Christentum kritisieren mag. Zwar kommt letztlich keine Theologie ohne Ontologie oder Metaphysik aus, aber sie ist deshalb nicht für alle Zeiten an eine einzig gültige Metaphysik gebunden. Schon historisch betrachtet war die von Benedikt XVI. favorisierte Verhältnisbestimmung von Vernunft und Glaube in der Alten Kirche keineswegs das einzige theologische Modell.
Luthers Aristoteles-"Kritik"
Schriftgebundene Theologie hat ein kritisches Verhältnis zu jeder denkbaren Metaphysik. Das zeigt exemplarisch Luthers Verhältnis zu Aristoteles. Bekanntlich hat sich Luther zur aristotelischen Philosophie teilweise recht polemisch geäußert. Allerdings kritisiert Luther in erster Linie die scholastische Aristotelesrezeption, nicht unbedingt Aristoteles selbst.
Auch nach Luthers benötigt die Theologie eine reflektierte Begriffssprache. Doch lehnt er die kritiklose Übernahme philosophischer Begriffe ab. Stattdessen fordert er nova vocabula bzw. eine Taufe philosophischer, ontologischer bzw. metaphysischer Termini. Theologie ist bei Luther Theologie des Kreuzes (theologia crucis) im Unterschied zu einer Theologie der Herrlichkeit (theologia gloriae), die von der Metaphysik dominiert wird. Daher drückt Luther sein theologisches Anliegen in der Weise aus, dass er aristotelische Begriffe zwar aufgreift, sie jedoch verfremdet und gewissermaßen gegen den Strich bürstet.
Dabei werden nicht nur einzelne Begriffe mit neuem Inhalt gefüllt, sondern das Denken ändert grundsätzlich seine Richtung. Dieser Vorgang ist zu verstehen nicht etwa als sacrificium intellectus, wohl aber als radikale Umkehr auf dem Gebiet des Denkens, d.h. als Vollzug des Rechtfertigungsglaubens im Medium der Vernunft. Während die Philosophie die Erkenntnis als Selbsttätigkeit des erkennenden Subjekts bestimmt, besteht die Erkenntnis der Theologie nach Luther in einem Erleiden (passio). Sie ist ein Widerfahrnis, derart, dass das Subjekt erkennt, wie es von Gott erkannt ist (vgl. 1 Kor 13,12). Die Subjekt-Objekt-Struktur des Erkenntnisvorgangs wird also umgekehrt. Darin besteht die erkenntnistheoretische Konsequenz der Rechtfertigungslehre und des sola gratia (allein aus Gnade).
Luthers Aristoteleskritik geht über die Tradition des ockhamistischen Nominalismus, in der er steht, erkennbar hinaus. Sie ist aber keinesfalls aus Auflösung der Verbindung von Vernunft und Glaube, sondern als deren Neubestimmung zu verstehen.
Benedikt XVI. zeichnet ein Zerrbild der Reformation und ihres Schriftprinzips. Die vielfältigen, wenngleich kritischen Bezüge reformatorischer Theologie zur griechischen Philosophie werden völlig verkannt. Schon Benedikts Begriff der Enthellenisierung erweist sich als polemische Formel, die das Konstrukt einer neuzeitlichen Verfallsgeschichte begründet. In ihr führt der Weg von den Reformatoren zu Kant, den der Papst irrtümlich mit den Worten zitiert, er habe das Denken beiseite schaffen müssen, um dem Glauben Platz zu machen. Kant hat jedoch geschrieben, er habe das Wissen beiseite schieben müssen, um dem Glauben Platz zu schaffen. Denken und Wissen sind aber zweierlei. Ihre Verwechslung führt bei Ratzinger nicht nur zu einer eklatanten Fehlinterpretation Kants, sondern beruht auch auf einem verengten Vernunftbegriff.
Eine vernehmende Vernunft
Im Begriff der Vernunft steckt das Wort "vernehmen". Eine vernehmende Vernunft ist stets geschichtlich wie auch das biblisch bezeugte Offenbarungsgeschehen und seine Interpretationen. Zur Geschichtlichkeit der Vernunft gehört ihre Pluralität. Die Idee der einen und zeitlosen Vernunft kann als gescheitert gelten. Statt der einen Vernunft gibt es eine Vielzahl von "Vernünften". Vernunft ist abhängig vom kulturellen Kontext und somit geschichtlich relativ. Gleichwohl gibt es zu ihr als kommunikativem Prinzip der Verständigung keine Alternative. Nicht Irrationalismus ist die Antwort auf die neuzeitliche Krise der Vernunft, sondern ihr kritischer und das heißt der ihrer Endlichkeit und Begrenztheit bewusste Gebrauch.
Die Synthese von Vernunft und Glaube, wie sie Benedikt XVI. favorisiert, ignoriert die grundsätzliche Pluralität menschlicher Vernunft, die sich in unterschiedlichen Formen der Rationalität und des Wissens manifestiert. Benedikts platonisch geprägtes Theologieverständnis meldet einen Geltungsanspruch an, der die Vernunft keineswegs zu ihrer eigenen Wahrheit befreit, sondern in eine neue babylonische Gefangenschaft führt. Bei allem Respekt vor dem Intellekt des Papstes läuft sein theologisches Programm auf den ziemlich schlichten Gedanken hinaus, dass die katholische Kirche definiert, was vernünftig ist und was nicht. Zum Glück ist die Bandbreite unterschiedlicher Verhältnisbestimmungen von Vernunft und Glaube in Geschichte und Gegenwart katholischer Theologie viel größer als Benedikt XVI. suggeriert. Ohne diese wäre es um den Beitrag der katholischen Theologie zum Dialog zwischen Christentum und Moderne wie auch um die Zukunft der christlichen Ökumene schlecht bestellt.
Der Autor ist Vorstand des Instituts für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!