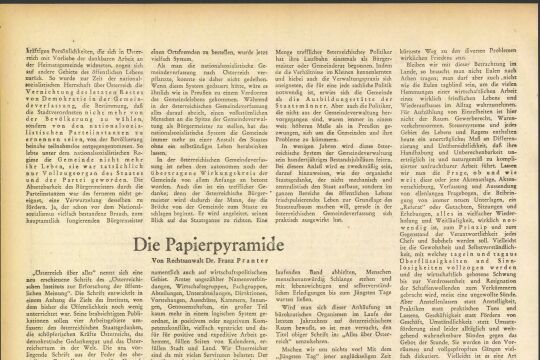Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Autofahrer unterwegs - zur Kasse
Nach seinen selbstmörderisch anmutenden Randbemerkungen zur Rentenfinanzierung, nach seiner Absage an eine Einschränkung der Steuerprogression hat sich der für den politischen Freitod gar nicht ambitionierte Finanzminister Hannes Androsch wieder einmal einige Feinde, vermutlich gar nicht wenige in seiner eigenen Partei, gemacht: Diesmal hat er den Autofahrern das Messer angesetzt. Auf dem Programm stehen die Abschaffung des Kfz-Pauschales für Fahrten unter 20 Kilometer, die Einschränkung der Pkw-Abschreibungen sowie die Transitsteuer.
Nicht besonders sachlich wäre es nun, eiligst in den Chor jener einzustimmen, die völlig undifferenziert aufheulen, wenn der Steuerzahler (wer sonst?) vom Staat zur Finanzierung seiner Aufgaben herangezogen wird. Untersuchen wir einmal die Gründe, die den Maßnahmen des Finanzministers eine positive Seite abzugewinnen scheinen:
Da wäre einmal die österreichische Handelsbilanz mit ihrem respektablen Defizit von fast 53 Milliarden, das sicherlich mit der menschlich verständlichen Sehnsucht, vermittels eines teuren Autos einige Sprossen der gesellschaftlichen Hierarchie hurtig zu überspringen, in ursächlichem Zusammenhang steht. Kleider machen eben nur Leute; Autos machen feine Leute.
Schließlich eröffnen auch die chaotischen Verkehrsverhältnisse in den Städten unabhängig von den ideologischen Positionen neue Perspektiven: Das Automobil, ehemals Visitenkarte einer freien, liberalen Gesellschaftsordnung, wird immer mehr zur einseitigen Belastung für Autofahrer, die zweimal täglich, auf dem Weg zu und von der Arbeit, ihre Nerven überbelasten, für Fußgeher und Wohnbevölkerung, die gegen Krach und Gestank der Autos ihre Gesundheit eintau- schen, und schließlich für die gesamte Gesellschaft, die langsam die bisher ungeahnten Gefahren einer grenzenlosen Energievergeudung erkennt.
Sollten also die Nachteile des aus- ufernden Individualverkehrs das Motiv für des Finanzministers Maßnahmen abgegeben haben, so kann vermutet werden, daß er zwar mit seinem Motiv, nicht aber mit der ausgewählten Therapie richtig liegt. Erstens sollte primär alles Erdenkliche zur Attraktivierung der öffentlichen Verkehrsmittel getan werden, die sich derzeit durch Unpünktlichkeit, Unregelmäßigkeit, langsames Vorwärtskommen und vor allem teure Fahrkarten (im roten Wien sind sie am teuersten) auszeichnen. Zweitens sind die öffentlichen Verkehrsmittel schon allein vom Platzangebot her nicht annähernd in der Lage, zu den Hauptverkehrszeiten einem verstärkten Ansturm standzuhalten. Erinnern wir uns nur an die Wiener Brücken-Desa- ster der vergangenen Monate zurück.
Zur Transitsteuer ist nicht viel hinzuzufügen. Es ist wirklich nicht besonders einsichtig, warum ausländische Lastwagenzüge Österreichs Straßennetz, insbesondere die vielgeprüfte Gastarbeiterroute be- und Übervölkern, und mit „Vorliebe“ Unfälle verursachen dürfen, ohne dafür auch nur einen Groschen bezahlen zu müssen. Ebensowenig einzusehen ist, daß Österreichs Transporteure in einigen dieser Staaten sehr wohl recht ausgiebig zur Kasse gebeten werden.
Bleibt nach all den positiven Teilaspekten die lähmende Frage nach dem Konzept. Oder anders formuliert: Will Hannes Androsch bej den wehrlosen Autofanatikern vielleicht nur deshalb absahnen, weil sie ihm gerade gelegen kommen, wieder einmal ein paar Löcher im aus allen Nähten platzenden Staatsbudget zu stopfen? Ist der Griff in die Brieftasche der Autofahrer nur Ausdruck einer nimmersatten Ausgabenpolitik, einer Politik, die die Wirtschaft selbst als Auto begreift, bei dem man einmal aufs Gas steigen, dann wieder mit ganzer Kraft auf die Bremse treten und schließlich im Straßengraben landen kann?
Grundsätzlich sei kein Einwand erhoben, wenn der Staat Geld zur Bedeckung seiner Aufgaben braucht. Die Frage darf nicht nur lauten: Wie viele Steuern sind dem Steuerzahler noch zumutbar? Sie muß auch lauten: Wie weit können wir den Staat noch belasten, wo sind die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht?
Um die Belastbarkeit des Staates (im weitesten Sinne) ist in letzter Zeit eine eigene Grundsatzdiskussion entstanden: Egon Matzner warnt vor bürokratischen Verfilzungen, die Volkspartei tritt für Entstaatlichung und Privatisierung kommunaler Aufgabenbereiche ein, Androsch kündigt sogar eine „Eindämmung der Zuwachsraten im Bildungs- und Sozialbereich“ an.
Der Innsbrucker Finanzwissenschaftler Christian Smekal hat sogar die sehr ernste These aufgestellt, die öffentlichen Haushaltsdefizite seien nicht ganz einfach der Preis für die Sicherung der Arbeitsplätze, wie es von der Regierungspartei bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit behauptet wird: „Auch im Zustand der Vollbeschäftigung würde ein großer Teil der gegenwärtigen Haushaltsdefizite bestehen bleiben und sich als Strukturproblem der Überforderung der öffentlichen Haushalte zeigen.“
Die Leistungsstruktur der öffentlichen Hand scheint gehörig aus dem Lot geraten zu sein. Verteilende, almo- senhafte und nivellierende Sozialmaßnahmen gehen auf Kosten einer qualitativen Sozialpolitik; kommunalpolitische Prachtbauten rangieren oft vor dem Notwendigen; klassische Staatsaufgaben, wie der Schutz der Bürger und ihres Eigentums, scheinen vernachlässigt zu sein.
Grundvoraussetzung aller weiteren Diskussionen über die Belastung der Bürger und über die Erfindung neuer Steuern scheint die Klärung folgender Schlüsselfrage zu sein: Welche Aufgaben soll der Staat, welche jeder Einzelne übernehmen. Daran haben wir schon lange genug vorbeidiskutiert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!