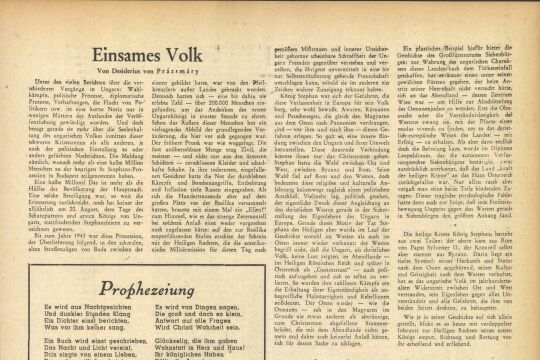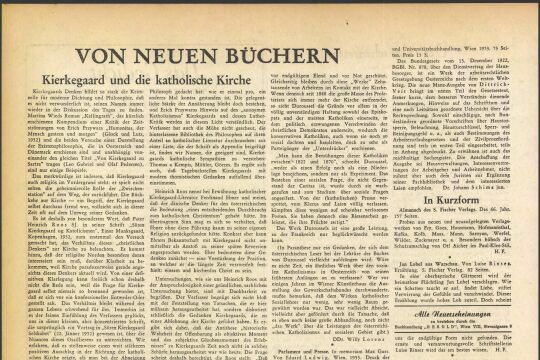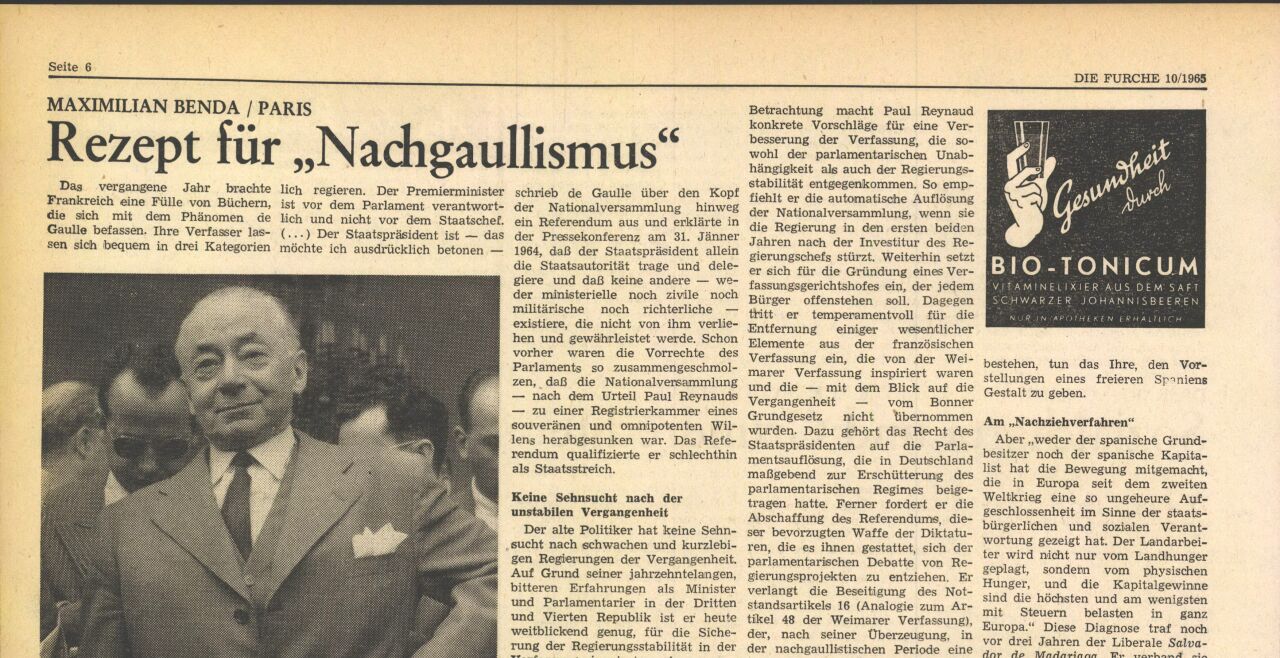
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Spanien mit revolutionärem „C“
Wie erst jetzt bekannt wird, kam es in der zweiten Jännerhälfte in der Nähe Madrids zur Gründung der „Christlich-Demokratischen. Union“ Spaniens, der UDC. Da in Spanien eine normale Parteitätigkeit noch unmöglich ist, haben die hundert Delegierten geheim tagen müssen. Der Druck dieser Illegalität war immerhin so weit gemildert, daß die Leitungen christlich-demokratischer Parteien des Auslands — so Italiens und Chiles — Glückwunschtelegramme schicken konnten; sogar der Präsident des internationalen Rings dieser Parteien meldete sich.
Dieser Gründungskongreß war die Verschmelzung der Mehrzahl der bereits bestehenden christlich-demokratischen Gruppierungen des Landes, wobei die entsprechenden Delegierten Kataloniens und des Baskenlandes als bloße Beobachter zugegen waren. Hingegen waren die Jugendgruppen sowie die militanten christlichen Gewerkschafter höchst aktive Träger dieser zweitägigen Gründungsversammlung.
Das in vierzehn Punkten ausgearbeitete Programm kennzeichnet die UDC als eine politische, nicht konfessionelle „revolutionäre echte Volkspartei“. Deren selbstgesetzte Aufgabe sei es, „die Werte christlichen Menschentums und der Demokratie im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich“ zu verteidigen. Die UDC verlangt eine neue Ordnung der Beziehungen von Staat und Kirche mit dem Verzicht auf die Privilegien, welche heute die Kirche als Nutznießerin des politischen Regimes erscheinen lassen. Der Staat soll seinerseits bundesstaatlich umgebaut werden.
Das „C“ der christlichen Bezugnahme, welches zur Zeit in Deutschlands und vorab Italiens „katholischen“ Parteien so sehr beschworen wird, hat in Spanien also einen reformerisch-revolutionären Gehalt, den konservativere mitteleuropäische Gemüter nicht so leicht mit ihren Vorstellungen von der politischen Nutzanwendung des „C“ in Einklang zu bringen vermögen. Aber man muß sich in unseren Zonen Rechenschaft geben, daß trotz unleugbarer wirtschaftlicher Anstrengungen der Regierung Franco und trotz der vom überquellenden Tourismus hervorgerufenen örtlichen Wirtschaftswunder Spanien eine Zone unberechenbarer politischer und sozialer Explosionskraft ist. Noch amtet die Regierung des alternden Generalissimus Franco. Ob sich spätestens bei seinem Ableben das heutige, ein Vierteljahrhundert alte Regime mit einer konstitutionellen Monarchie drapieren und verewigen läßt, ist fraglich. Zu stark ist der Ruf nach voller geistiger Freiheit, nach vermehrter sozialer Gerechtigkeit, welchen die Kirche, schlecht entlöhnte Arbeiter und eingeengte Intellektuelle seit Jahren erheben. Auch die Kontakte, welche heute auf allen Ebenen — nicht zuletzt auf jener der emigrierten Gastarbeiter — mit dem übrigen Europa >estehen, tun das Ihre, den Verteilungen eines freieren Spaniens Gestalt zu geben.
Aber „weder der spanische Grund->esitzer noch der spanische Kapitaist hat die Bewegung mitgemacht, iie in Europa seit dem zweiten Weltkrieg eine so ungeheure Aufgeschlossenheit im Sinne der staatsbürgerlichen und sozialen Verantwortung gezeigt hat. Der Landarbeiter wird nicht nur vom Landhunger geplagt, sondern vom physischen Hunger, und die Kapitalgewinne sind die höchsten und am wenigsten mit Steuern belasten in ganz Europa.“ Diese Diagnose traf noch vor drei Jahren der Liberale Salvador de Madariaga. Er verband sie mit der Warnung, daß die stets noch“,wachsende Kluft zwischen reich und arm“ dem Kommunismus den Weg bereite, wenn das Regime fortfahre, jeden Widerspruch als kommunistischen Umtrieb zu bestrafen.
Das Existenzminimum einer vierköpfigen Familie liege bei 5000 Peseten monatlich (zirka 500 Franken), aber nur wenige Arbeiter kämen auf die Hälfte dieser Summe, stellte ein Kenner der Verhältnisse im „Esprit“ fest. Der garantierte Mindesttages-lohn liegt heute etwas über acht Franken; er ist unverändert geblieben, während die Preise in einem Jahr um 17 Prozent gestiegen sind.
Mit dieser Benachteiligung der Massen, die zumindest als relative Verelendung bezeichnet werden muß, kontrastiert der Luxus der profitierenden Oberschicht. Noch immer gehört rund die Hälfte allen Bodens einem Kreis von 20.000 bis 30.000 Großgrundbesitzern. Daß von den 450 Grandenfamilien ihrer 370 in Madrid ihre Paläste und Luxuswohnungen haben und weitere Dutzende andernorts residieren, nur nicht auf ihren angestammten Gütern, illustriert eine Entfremdung, die in der europäischen Vergangenheit noch stets das Alarmzeichen für Umwälzungen war. Der Müßiggang im großstädtischen Milieu zieht mehr als die Bewirtschaftung des eigenen Landes. Und das schlechte Beispiel einer an der Spitze kranken Gesellschaft wirkt nach unten: im Mittelstand ist man mehr auf bequeme Posten als auf das Vorweisen persönlicher Leistung aus.
Daß all diese Rückständigkeit auch von seiten der Kirche seit Jahren laut angeprangert wurde, hat im Ausland zu der Annahme verleitet, der Einfluß der Kirche müsse groß sein; es werde ihren Organisationen gelingen, bei einem Zusammenbruch des Regimes die Millionen Derou-tierter aufzunehmen. Aber all die Stellungnahmen sozial eingestellter Bischöfe, die mutige Publizistik der Katholischen Aktion und katholischer Gewerkschaftsorgane oder etwa die Kritik seitens einiger Ordenszeitschriften (sie müssen alle auf Grund des Konkordates vom Staat toleriert werden) erreichen die Massen kaum.
Für den Durchschnittsspanier ist die Kirche eng mit dem Regime und mit den gegebenen gesellschaftlichen Zuständen verbunden. Wer an den kirchlichen Veranstaltungen, an den Kongressen und an den Prozessionen im ersten Range zu sehen ist, „sind eben jene, welche kaum das strikte Minimum der päpstlichen Enzykliken befolgen. Sie zahlen die niederen Löhne und lassen unmenschliche Arbeitsbedingungen andauern. Dabei streichen sie selber substantielle Profite ein“ („Esprit“, Februar 1964). So wird einem der Ausspruch einer Bäuerin verständlich, welche auf die Frage, ob denn in ihrem Dorfe die Leute nicht in die Kirche gehen, erklärte: „Nein, in meinem Dorf gibt es nur wenige Reiche.“
Die Statistik bestätigt es: im Arbeitermilieu bewegt sich der Anteil der praktizierenden Katholiken um die zehn Prozent. Eine Untersuchung, die allerdings schon fünf Jahre zurück liegt, ergab, daß die Hälfte der Arbeiterschaft sich als religiös uninteressiert bezeichnete, daß sie aber in der Front der 90 Prozent stand, welche sich als bewußt antiklerikal bezeichnete.
So muß man ohne Illusionen in das Land des 73jährigen Generals Franco blicken. Das Beste, was man sich in den sozial aufgeschlossenen Kreisen der Hierarchie zu erhoffen scheint, ist eine Liberalisierung ohne Gewalttätigkeit, also ein intensivierter Abbau des Regimes selber, zu welchem der Umgang mit Europa viel beitragen kann.
Solcherweise hat man es sich zu erklären, wenn der neuernannte Kardinal Herrera (einst Redakteur, dann Seminarist, als Bischof von Malaga Jahre hindurch sozialer Vorkämpfer, sein Bruder politisch Verurteilter) letzten Sonntag den Staatschef als getreuen Diener Gottes feierte, zugleich aber mahnte: „Alle unsere Übel haben ihre Ursachen im Fehlen einer gesunden sozialen Ordnung; sie rühren von der ungerechten Verteilung der Güter her, von der ungleichen wirtschaftlichen Position der Klassen und von dem Weiterbestehen völlig unzeitgemäßer gesellschaftlicher Strukturen.“
Die junge spanische „Christlich-Demokratische Union“ will hier mit den Akzenten einer revolutionären Abkehr von der Verquickung Kirche-Regime-Profltordnung einen neuen Anfang setzen. Seit „Mater et magistra“ sind die Zungen ihrer Anhänger ohnehin gelöst. Wie in den ersten Jahren des zweimaligen Beginnens der italienischen Democrazia Cristiana ist man sich hier bewußt, daß es nicht die erste Aufgabe einer solchen Partei ist, Damm gegen den „Bolschewismus“ zu sein. Sondern sie kann durch alle Kommunismen und Liberalismen hindurch auf die große Tatsache greifen, daß Demokratie überhaupt erst möglich ist, seit vor zweitausend Jahren die Freiheit und Gleichwertigkeit aller verkündet wurde. Was den Stammvater der italienischen DC, Don Luigi Stürza, einst die großzügige Feststellung treffen ließ, eine Demokratie könne und müsse sich christlich nennen, unabhängig davon, ob es in ihr christlich benannte Parteien gebe oder nicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!