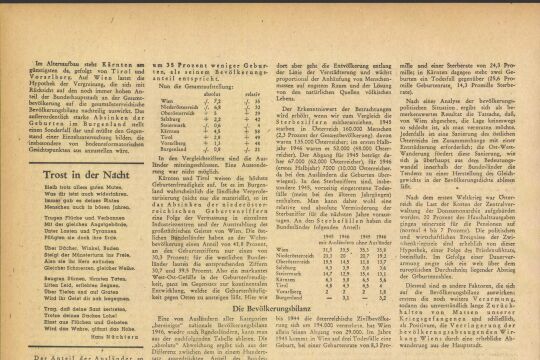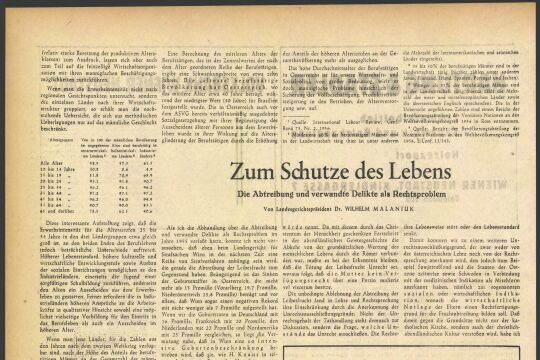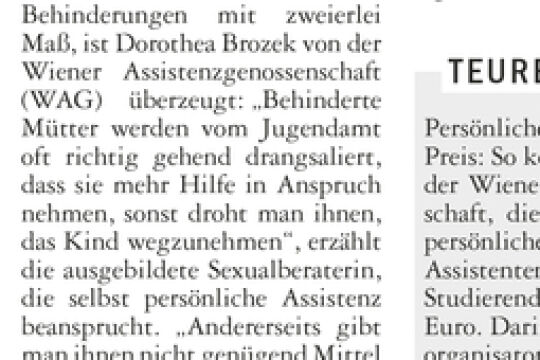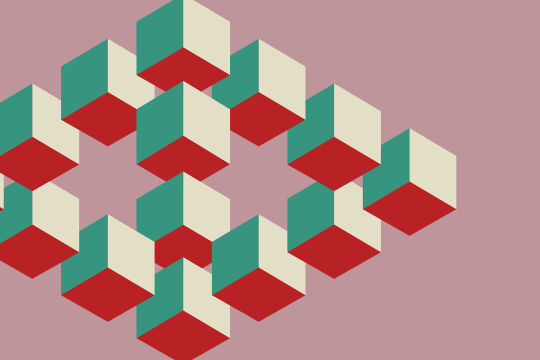Kann ein behindertes Kind ein Schaden sein? Die Behindertensprecher der Koalitionsparteien, Franz-Joseph Huainigg (VP) und Christine Lapp (SP), diskutieren über das jüngste umstrittene OGH-Urteil - und finden wenig inhaltliche Übereinstimmung.
Die Furche: Das Urteil des Obersten Gerichtshofes hat heftige Kritik ausgelöst, auch von Ihnen, Herr Abgeordneter Huainigg, wurde eine solche geäußert, dass nämlich ein behindertes Kind niemals ein Schaden sein könne. Sie, Frau Abgeordnete Lapp, sind aber mit dem Urteil einverstanden, warum?
Christine Lapp: Im Urteil steht nicht, dass das Kind ein Schaden ist, sondern im Gegenteil, es wird darauf hingewiesen: "Das Leben und die Persönlichkeit eines Kindes sind zweifellos unantastbare Rechtsgüter. Geburt und Existenz eines Kindes können nicht als Schaden betrachtet werden." Bei diesem Urteil hat sich das Gericht wesentlich mehr Gedanken gemacht als bei früheren ähnlich gelagerten Urteilen. Es geht darum, dass die Ärzte und Ärztinnen in diesem Fall die Eltern nicht gut beraten haben, dass hier Fehler bei der pränatalen Diagnostik gemacht wurden, und deshalb bestehen zu Recht Haftungsfragen.
Franz-Joseph Huainigg: Ich sehe im OGH-Urteil einen Frontalangriff auf die Existenz behinderter Menschen. Es kann zwar ein Diagnosefehler vorgelegen haben, aber der Schadenersatz ist nicht auf den behinderungsbedingten Mehraufwand ausgerichtet, sondern auf die gesamte Lebensexistenz des behinderten Kindes. Der Wert dieses Kindes ist für die Richter gleich Null. Es gibt kein Recht auf ein gesundes Kind. 2006 hat der OGH schon einmal ein Urteil in diese Richtung gefällt: Damals wurde aber Schadenersatz für den behinderungsbedingten Mehraufwand zugesprochen. Im selben Jahr gab es noch einen Fall: da kam ein ungewolltes Kind zur Welt, diesmal aber nicht behindert (nach einer misslungenen Sterilisation, Anm.). Auch diese Eltern klagten auf Schadenersatz und haben nicht Recht bekommen. Damit stellt ein gesundes Kind im Gegensatz zu einem behinderten keinen Schadensfall dar.
Lapp: Es muss für Eltern die Möglichkeit geben, dass sie sich informieren können und dass sie beraten werden. Und das war in diesem Fall nicht gegeben. Im Urteil wird klar beschrieben: "Im Rahmen des ärztlichen Behandlungsvertrages schuldet der Arzt/die Ärztin Diagnostik, Aufklärung und Beratung nach den aktuellen anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst." In diesem Fall haben die Ärzte aber gesagt, mit dem Kind sei alles in Ordnung, hätten die Fehlbildung aber erkennen müssen.
Huainigg: Es ist kein Behandlungsfehler gewesen.
Lapp: Aber die Untersuchung ist nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden. Für die Eltern hat es keine Alternative gegeben. Es ist ihnen nicht gesagt worden, so und so schaut es aus. Dann hätten sich die Eltern darauf einstellen und überlegen können, wie sie sich entscheiden.
Huainigg: Was wäre die Alternative gewesen? Es gibt keine Therapie für das Kind, auch wenn man die Fehlbildung schon vor der Geburt festgestellt hätte. Die Eltern hätten dann das Kind getötet, de facto nach der 20. Schwangerschaftswoche, zu einem Zeitpunkt, wo das Kind schon überlebensfähig gewesen wäre.
Lapp: Aber in diesen Fällen braucht es eben Beratung. Wie man den Zeitungsberichten entnimmt, ist das Kind heute quietschfidel, aufgrund seiner Behinderung eben eingeschränkt, und musste viele Operationen über sich ergehen lassen. Die Eltern lieben ihr Kind so, als wenn es kein Urteil gegeben hätte. Die Eltern brauchen Unterstützung, wenn es eine solche Diagnose gibt. Aber in diesem Fall hat es keine Diagnose gegeben.
Huainigg: Es ist ein Wahnsinn, was das Urteil für das Kind bedeutet: Du bist unerwünscht, wir hätten dich nicht auf die Welt gebracht, wenn wir gewusst hätten, dass du so bist, wie du bist. Wie dieses Kind mit dieser Belastung aufwachsen soll, finde ich sehr problematisch.
Lapp: Die Eltern werden dem Kind sicher nicht sagen, wir hätten dich nie haben wollen. Sie werden sagen: Wenn wir mehr gewusst hätten, hätten wir uns entscheiden können, aber so sind wir ins kalte Wasser gestoßen worden. Aber wir werden schauen, dass es dir im Leben bestmöglich geht und es Unterstützung für deine Therapien gibt.
Huainigg: Das Gericht folgte der Argumentation der Familie: Wir haben uns ein gesundes Kind gewünscht, wenn wir gewusst hätten, dass es so ist, wie es ist, dann hätten wir es nicht auf die Welt gebracht.
Die Furche: Ärzte und Ärztinnen stehen unter enormen Druck, werdende Eltern sind verunsichert. Was muss sich nun aus Ihrer Sicht verändern?
Huainigg: Es gibt weitreichende Folgen. Es werden nun immer mehr pränatale Untersuchungen durchgeführt und beim geringsten Verdacht auf Behinderung wird geraten werden, das Kind abzutreiben, oder die Eltern müssen unterschreiben, dass, wenn das Kind behindert zur Welt kommt, sie nicht klagen werden. Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, stehen unter enormen Druck. Es heißt, das wäre heutzutage nicht mehr notwendig.
Die Furche: Was schlagen Sie vor?
Huainigg: Ich schlage eine Regelung wie in Frankreich vor: Dass aufgrund von Behandlungsfehlern ein Schadenersatzanspruch besteht, dass aber allein die Geburt eines behinderten Kindes keinen Schadensfall darstellen kann.
Die Furche: Auch wenn die Ärzte bereits diagnostizierbare Fehlbildungen nicht sehen?
Huainigg: Dann ist schon Schadenersatz möglich, aber nur für den behinderungsbedingten Mehraufwand. Man muss aber auch sehen, dass es viele Fördermöglichkeiten für Kinder mit Behinderung gibt, die natürlich weiter verbessert werden müssen, zum Beispiel braucht es eine gerechtere Pflegegeldeinstufung.
Lapp: Für gesetzliche Veränderungen sehe ich keinen konkreten Anlassfall. Wichtig wäre aber, dass Ärzte und Ärztinnen besser darüber informieren können, wie es wirklich ist, mit einem behinderten Kind zu leben. Es geht darum, die Ärzteschaft näher an das Leben heranzuführen.
Huainigg: Ich bin ganz bei Ihnen, dass man die Beratung verbessern und dass man den Eltern Perspektiven geben muss; dass Leben mit Behinderung nicht nur schlimm und tragisch ist, sondern auch Glück bedeuten kann, dass es viele Menschen mit Behinderung gibt, die ein sehr wertvolles Leben führen. Da braucht es ein ganz anderes Bild in der Gesellschaft. Darüberhinaus soll auch über die Regelung wie in Frankreich diskutiert werden. Wir haben im Koalitionsabkommen vereinbart, dass es zu diesem Thema eine parlamentarische Enquete geben soll (Fachdiskussion im Parlament als Grundlage für eine mögliche Gesetzesänderung, Anm.).
Die Furche: Sie fordern schon lange die Streichung der eugenischen Indikation, die die Möglichkeit einer Abtreibung bis zur Geburt vorsieht, wenn der begründete Verdacht besteht, dass das Ungeborene behindert ist. Ist die Streichung realisierbar?
Huainigg: Die Fristenlösung steht außer Streit, aber es widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz gemäß Behindertengleichstellungsgesetz, wenn bei Verdacht auf Behinderung bis zur Geburt abgetrieben werden kann. Die Spätabtreibungen, speziell nach der 20. Schwangerschaftswoche, sind problematisch und zu verurteilen, weil ab diesem Zeitpunkt das Kind lebensfähig ist.
Lapp: Das passiert in Österreich sehr selten. Wenn Sie sagen, an der Fristenlösung wird nicht gerüttelt, glaube ich Ihnen das; aber trotzdem muss man sehr genau aufpassen, dass da nicht ein Sack aufgeschnürt wird. Wir haben uns im Regierungsprogramm auf die Enquete geeinigt, aber nicht unter dem von Ihnen vorgeschlagenen Titel "wrongful birth" (unerwünschte Geburt eines behinderten Kindes, etablierter Sachbegriff, Anm.). Wir möchten das differenzierter und breiter diskutieren.
Die Furche: Soll also die eugenische Indikation gestrichen werden?
Lapp: Das ist die Forderung des Koalitionspartners und vieler Behindertenorganisationen. Aber ich habe für mich noch nicht die beste Variante gefunden, mit der die Straffreiheit der Abtreibung und das Leben behinderter Menschen gesichert werden kann. In Deutschland wurde die eugenische Indikation abgeschafft, aber es finden nach wie vor Abtreibungen behinderter Föten statt, weil es aus medizinischen Gründen möglich ist. Da wurde nur der Titel geändert.
Huainigg: Die medizinische Indikation soll bleiben. Wenn die Mutter sagt, sie kann mit der Belastung, ein behindertes Kind zu gebären, nicht leben, dann finde ich das ehrlicher, und es widerspricht nicht dem Gleichheitsgrundsatz.
Lapp: Das verändert nicht den Status-quo. Den Frauen wird noch stärker eine schwierige Entscheidung aufgebürdet.
Das Gespräch moderierte Regine Bogensberger.