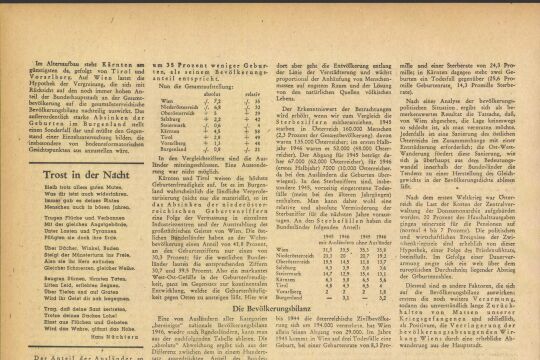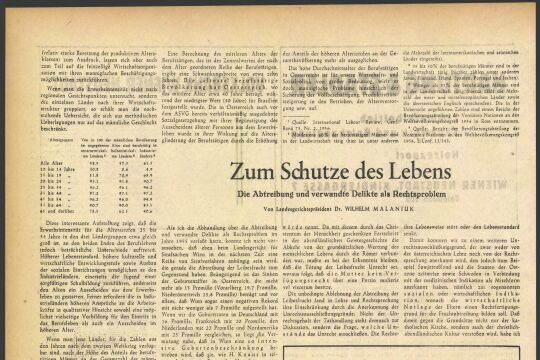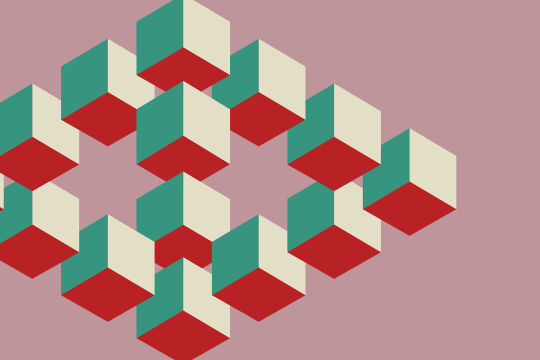Bei medizinischer Indikation kann eine Schwangerschaft bis zur Geburt abgebrochen werden. Es ist ein großes Tabu und dennoch Realität. Die Faktenlage.
Es ist ein Urteil mit großer Konsequenz: Jener Spruch der Richter des Obersten Gerichtshofes, der Eltern eines behinderten Kindes lebenslange Unterhaltszahlungen zuspricht, weil die Ärzte die Fehlbildungen des Kindes vor der Geburt nicht entdeckt hatten. Die Eltern hätten in diesem Fall einen Abbruch vornehmen lassen. Das Urteil wurde Anfang 2008 publik gemacht und hatte für große Aufregung gesorgt (siehe Furche 11/2008). Der Kern der Kritik: Die Geburt eines behinderten Kindes dürfe niemals ein "Schaden" sein.
Spricht man führende Frauenärzte und Pränataldiagnostiker auf dieses Urteil an, fallen die Reaktionen heftig aus: "Katastrophal", meint dazu der Vorstand der Frauenklinik am Landeskrankenhaus Salzburg, Alfons Staudach: "Bald wird sich niemand mehr über die Pränataldiagnostik drüber trauen. Irgendwann wird es Zustände wie in den USA geben, wo der niedergelassene Arzt keinen Ultraschall mehr macht, alles wird an Spezialisten weiterdelegiert, die hochversichert sein müssen." Ähnlich kritisch äußert sich sein Linzer Kollege, Gernot Tews: "Wenn die Gesellschaft das will, dann wird es eben bald Zentren geben, die sich mit Fetozid beschäftigen." Fetozide (die Tötung eines Ungeborenen vor einem indizierten Spätabbruch) würden aus Angst vor möglichen Schadenersatzklagen stark zunehmen und auch Ungeborene betreffen, die keine "extrem schweren Fehlbildungen" aufweisen würden.
Und Tews, Leiter der gynäkologischen Abteilung des AKH Linz, wird noch grundsätzlicher und gibt zu bedenken: "Im Mutterleib kann ein schwer kranker oder behinderter Fötus getötet werden, wäre ein Kind derselben Entwicklungsstufe im Inkubator, also bereits geboren, wäre dies Mord." Eine äußerst brisante Überlegung, denkt man an Extremfrühgeburten, um deren Leben - bei großem Risiko einer späteren Behinderung - mit intensivmedizinischen Maßnahmen gekämpft wird.
Wie also umgehen mit der letzten Konsequenz der pränatalen Diagnostik, dem Abbruch einer Schwangerschaft? Was tun, wenn der Abbruch eines als schwer krank definierten Ungeborenen nach der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche erfolgen soll? Nach dieser Zeit ist mit der Geburt eines lebensfähigen Kindes zu rechnen. Wann gilt ein Fötus als "schwer geschädigt"? Ein brisantes Thema, das jeden Gynäkologen, der Ultraschalluntersuchungen durchführt, beschäftigen muss; und plötzlich für werdende Eltern im Raum steht, wenn bei einer Schwangeren Auffälligkeiten an ihrem Kind festgestellt werden.
Spätabbruch mit Fetozid
Die Österreichische Gesellschaft für Prä- und Perinatalmedizin, also führende Ärzte auf diesem Gebiet, gab zu diesem Themenfeld bereits zwei Konsensus-Statements heraus: Richtlinien zur pränatalen Diagnostik im Allgemeinen (2006) und zum äußerst heiklen Thema Spätabbruch und Fetozid (2002). Hintergrund war, dass es zuvor nach Spätabbrüchen zur Geburt von lebenden Kindern gekommen war, für alle Beteiligten eine extreme Belastung. Angesichts des jüngsten OGH-Urteils und der damit verbundenen Verunsicherung der Ärzte aufgrund des forensischen Drucks könnte eine weitere Stellungnahme der Ärzteschaft folgen.
Der Inhalt der Stellungnahmen: Die führenden Mediziner wollen bei der pränatalen Diagnostik ausführliche Beratung und Begleitung von Frauen und Paaren sichergestellt wissen. Für Abbrüche nach Ende der 22. Woche (21 Wochen und sechs Tage nach Beginn der Schwangerschaft) wurden folgende Rahmenbedingungen festgelegt (Unterzeichner sind auch Gernot Tews und Alfons Staudach): Zunächst wird festgehalten, dass es solche "gravierenden Fälle" geben wird und dass mit Fortschreiten der Schwangerschaft der Lebensschutz des Ungeborenen zunimmt, also auch die Schwere der Indikation zunehmen muss. Der Entscheidungsprozess auf professioneller Seite muss durch eine "möglichst breite und interdisziplinär beschickte Beratungsgemeinschaft gelenkt werden". Es muss ein einstimmiger Konsens erfolgen. Wenn die Eltern sich dafür entscheiden, wird der Abbruch, also die künstliche Geburtseinleitung, nach einem Fetozid erfolgen. Dabei wird das Kind durch eine Injektion in den Herzmuskel getötet. Die Diagnose soll durch eine zweite Meinung an einem anderen Pränatalzentrum überprüft werden, bevor es zum Eingriff kommt. Der Eingriff kann nur in einem pränatalmedizinischen Zentrum erfolgen. Die betroffenen Eltern müssen während des gesamten Prozesses psychosozial begleitet werden. Zwischen Diagnose und Abbruch soll ausreichend Zeit zur Bildung einer Entscheidung sein. Die Entscheidungsfindung und die Fälle an sich müssen exakt dokumentiert werden (nachzulesen in Speculum, Sonderdruck, 4/2002).
Peter Husslein, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH, fügt dem noch hinzu, dass jedes große pränatale Zentrum auch Abbrüche durchführen müsse, wenn nach entsprechender medizinischer Indikation und Entscheidung der Eltern dieser Entschluss gefällt worden sei. "Was wir nicht wollen, ist ein Fetozid-Tourismus, dass die anderen Zentren zwar Diagnosen stellen, die Frauen aber dann weiterverweisen." Bei Nachfrage in den Bundesländern kommt es - zumindest offiziell - zu keinem derartigen "Tourismus".
Frauen weiter verwiesen
Doch das wird von Insidern bezweifelt. Der Frauenarzt und Leiter des Wiener Abtreibungs-Ambulatoriums Gynmed, Christian Fiala, gibt an, dass nach seiner Recherche jährlich ca. 100 bis 200 Frauen in Kliniken in Holland einen Abbruch vornehmen lassen, weil deren Ärzte in Österreich eine Fehlbildung des Kindes als nicht "ausreichend schwer" eingestuft haben. Das Gesetz bleibt in dieser heiklen Frage unspezifisch:
Der Konsens am Papier beruht auf der derzeit geltenden Rechtslage: Laut § 97 Absatz 1 StGB ist der Abbruch einer Schwangerschaft in den ersten drei Monaten nach Beginn der Schwangerschaft (Einnistung) straffrei (ca. bis zur 16. Woche). Ohne Zeitlimit ist ein Abbruch straffrei, wenn der Abbruch "zur Abwendung einer nicht anders abwendbaren ernsten Gefahr für das Leben oder eines schweren Schadens für die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren erforderlich ist oder eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde." Nach Geburtsbeginn, also dem Einsetzen von Geburtswehen, ist ein Abbruch nicht mehr straffrei.
Im öffentlichen Diskurs wird der Punkt, der das Kind betrifft, "embryopathische Indikation", jener, der die Mutter betrifft, "medizinische Indikation" genannt. Mediziner sprechen meist in beiden Fällen von "medizinischen Indikationen." Abbrüche wegen des Überlebens der Mutter sind Ausnahmefälle. Die embryopathische Indikation ist sehr umstritten. Allen voran Interessensvertretungen für Menschen mit Behinderungen fordern die Streichung dieser Indikation, sie werden von der ÖVP unterstützt.
So viel zu den Stellungnahmen der Ärzte am Papier. Wie schaut aber die Realität aus? Schon allein die Frage, wie viele Abbrüche es nach pränatalen Diagnosen mit auffälligem Befund gibt, ist ein Tabuthema.
Die Fälle können laut Peter Husslein in drei Gruppen geteilt werden: Abbrüche innerhalb der Fristenlösung (bis zur 16. Woche): Hier sind Zahlen nicht bekannt. "Die Zahl der Abbrüche aufgrund medizinischer Indikationen ist in dieser Gruppe klein, aber wachsend", sagt der führende Gynäkologe: Mit weiterem Fortschritt bei der pränatalen Diagnose würden viele Abbrüche dann noch innerhalb der Fristenlösung fallen und damit allein der Autonomie der Schwangeren unterliegen. Die zweite Gruppe umfasst jene Abbrüche, die nach medizinischer Indikation bis zur 22. Woche durchgeführt werden. Darunter würden, so Husslein, zur Zeit die meisten Abbrüche fallen, z. B. nach einer Chorionzottenbiopsie (ab der 11. Schwangerschaftswoche; Punktion der frühen Plazenta, um kindliche Zellen zu gewinnen; wird zunehmend eingesetzt) oder nach Fruchtwasseruntersuchungen (ab der 16. Woche, diese nehmen ab). Die dritte Gruppe sind die sehr seltenen Abbrüche mit Fetoziden. bog
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!