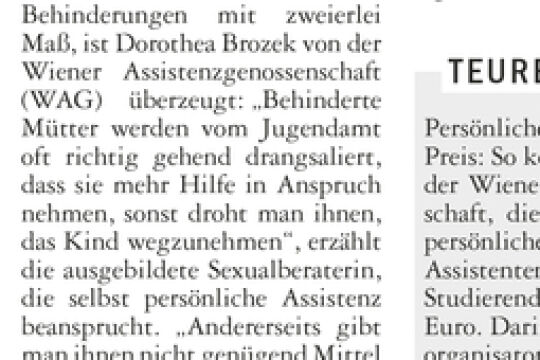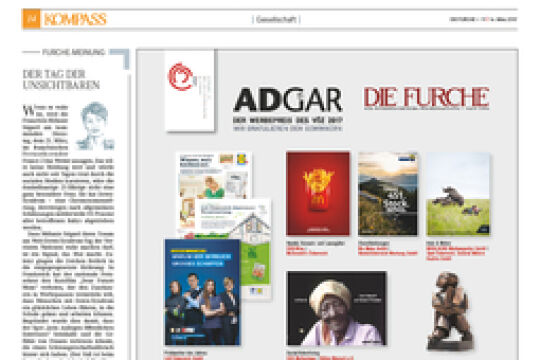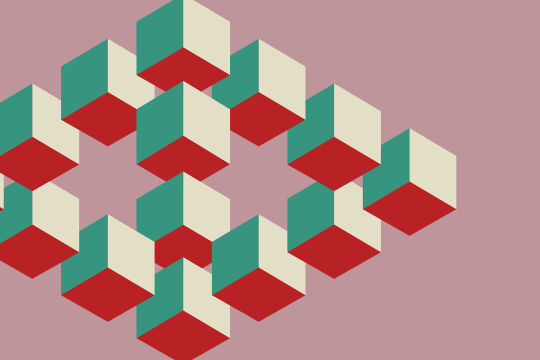Die moderne Pränataldiagnostik führt Paare in Dilemma-Situationen und lässt sie oft allein. Drei Beispiele anlässlich des Down-Syndrom-Tages am 21. März.
Anna hat heute keine Lust, auf Knopfdruck zu lächeln. Lieber legt sie ihren Kopf schief, lugt durchs Fenster und wartet auf ihr Bäuerchen. Sekunden später wird sich ein weißer Schwall auf dem Pullover ihrer Mutter ergießen. Michaela Pagler-Srnec trägt es mit Fassung: "Deshalb gibt es ja dieses Tuch“, sagt sie schelmisch und überdeckt damit das milchige Malheur.
Gemeinsam mit ihrem Mann Karl Srnec und ihrer zehn Monate alten Tochter Anna ist die 38-Jährige von ihrem Wohnort Berndorf hierher ins Familiencafé "Dschungel deli“ im Wiener Museumsquartier gekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Es ist eine Geschichte von Freude und Schock, von Angst und der verzweifelten Suche nach Gewissheit. Tausende Paare könnten Ähnliches erzählen. Und doch gäbe es bei den meisten einen völlig anderen Schluss.
Menschen, die immer mehr verschwinden
Geschätzte 90 Prozent aller Eltern entscheiden sich nach der Diagnose Down-Syndrom für einen Schwangerschaftsabbruch. Genaue Zahlen existieren nicht. Laut "Fehlbildungsregister“ der Statistik Austria wurden 2011 gerade einmal sechs Säuglinge mit Trisomie 21, also dreifachem 21. Chromosom, geboren. Dem widersprechen die Erfahrungen der Down-Syndrom-Ambulanz in der Wiener Rudolfstiftung, wo man jährlich 15 bis 20 Zuweisungen aus Wien und Nieder-österreich verzeichnet. Die Tendenz ist angesichts immer ausgefeilterer Pränataldiagnostik inklusive Gentests am mütterlichen Blut (siehe unten) trotzdem klar: Menschen mit Down-Syndrom, jener Behinderung, die mit Entwicklungsverzögerungen und oft auch Herzfehlern einhergeht, aber den Betroffenen bei entsprechender Förderung und Unterstützung ein weitgehend selbstbestimmtes und glückliches Leben erlaubt, werden immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwinden.
Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass Anna heute im "Dschungel deli“ entspannt am Schoß ihrer Mutter sitzt und ihr Mittagessen verdaut. Dass sie etwas kleiner als gleichaltrige Kinder ist, noch keine Zähne hat und die Milch wegen Trinkproblemen mit Hilfe eines Spezialsaugers aus dem Fläschchen kitzelt, bemerkt hier niemand.
Organisch ist das Mädchen kerngesund. Das zeigt sich auch bei jenem "First-Trimes-ter-Screening“, das Michaela Pagler-Srnec als 37-jährige Risikoschwangere durchläuft. Herz und Nieren ihres Babys sind in der zwölften Woche ebenso unauffällig wie die Flüssigkeitsansammlung im Nacken. Auch die Laborwerte des mütterlichen Blutes sind normal. Nur das Nasenbein lässt sich im Ultraschall einfach nicht finden. Doch das regt Pagler-Srnec, die als Sekretärin im Außenministerium 15 Jahre lang im Ausland tätig war, nicht besonders auf.
Als man nach den Weihnachtsferien in der 15. Schwangerschaftswoche das Nasenbein noch immer nicht entdeckt, steigt freilich die Irritation. Das Paar versucht, in einem spezialisierten Pränataldiagnostiklabor einen Termin zu bekommen - und wird erst in der 21. Woche in Neusiedl am See fündig. Wieder ist kein Nasenbein zu sehen, ebenso wenig tags darauf in der Wiener Semmelweisklinik. Schließlich kommt man ans AKH, wo in der 22. Woche eine Fruchtwasserpunktion (Amniozentese) vorgenommen wird. Der Eingriff, bei dem eines von hundert Kindern stirbt, verläuft gut.
Am Montag darauf warten die beiden zwei Stunden lang auf die Befundbesprechung. "Als wird dann endlich beim Arzt gesessen sind, haben wir das Gefühl gehabt, er will nur auf Mittagspause gehen“, ärgert sich Karl Srnec noch heute. Die Diagnose lautet: Down-Syndrom. Der ärztliche Kommentar dazu: "Sie werden sich ja was überlegt haben übers Wochenende: Wie ist die Entscheidung ausgegangen?“ Die beiden erklären, dass sie das Kind behalten wollen. An Abtreibung hat Michaela Pagler-Srnec nie ernsthaft gedacht: "Prinzipiell ist das eine Entscheidung, die jeder Frau freistehen muss“, sagt sie. "Aber wir haben überlegt, wie es uns gehen würde, wenn wir ein paar Jahre später ein Kind mit Down-Syndrom sehen würden, das uns anlächelt. Dann würden wir wahrscheinlich denken: Das könnte auch unser Kind sein!“
An diesem Montag im AKH, als die beiden endlich Gewissheit haben, sind sie einerseits erleichtert. Zugleich spüren sie, dass sich unter ihren Füßen ein Abgrund auftut. "Und dann fällt man“, erinnert sich Annas Mutter. "Das waren dunkelschwarze Tage.“
Die Psychologin am AKH, die sie in diesem Schockzustand eigentlich stützen soll, muss erst ihre Unterlagen suchen und hat auch dann nur Standardantworten parat. Erst bei Ingrid Teufel von der Down-Syndrom-Ambulanz in der Rudolfstiftung, an die sie verwiesen werden, erhalten sie Auskunft zu ihren brennenden Fragen: Wie wird sich mein Kind entwickeln? Wird es je fähig sein, selbständig zu leben? Was wird sein, wenn wir nicht mehr sind? "Frau Teufel hat uns durch Alltagsbeispiele die Angst genommen“, erinnert sich Karl Srnec. "Diese Frau war ein Engel.“ Die Sozialarbeiterin informiert die Eltern über persönliche oder finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, sie gibt ihnen Adressen von anderen, betroffenen Familien und Gruppen, um sich zu vernetzen, spricht über die Möglichkeiten und Grenzen schulischer Integration - und rät dem Paar, schon vor der Geburt in die Offensive zu gehen und alle Freunde in einem E-Mail über die Besonderheit dieses Babys aufzuklären. "Wir werden unser Kind weder verstecken noch schönreden“, schreiben die Srnecs daraufhin allen, die sie kennen. "Wir wissen nicht, wie es wird. Aber es gibt uns in Zukunft nur noch so!“
Menschen wie Anna, deren Behinderung schon während der Schwangerschaft diagnostiziert wurde, machen etwa ein Drittel aller rund 450 Patienten aus, die vom interdisziplinären Team der Down-Syndrom-Ambulanz betreut werden. Die anderen sind trotz umfassender Pränataldiagnostik "durchgerutscht“: Entweder, weil ihre Mütter zu jung waren, um in das engmaschige Untersuchungsraster zu fallen, oder weil sie beschlossen haben, sich keiner weiteren Diagnostik auszusetzen. Nach der Geburt überraschend mit einem Down-Syndrom-Kind konfrontiert zu werden, ist für betroffene Mütter freilich traumatisch - und für ihren betreuenden Gynäkologen schlimm: Haben sie die Behinderung fahrlässig übersehen, drohen ihnen womöglich Unterhaltszahlungen, wie sie der OGH betroffenen Eltern bereits zugesprochen hat.
Entsprechend groß ist der Druck auf die Ärzte, sich abzusichern und den Frauen im Zweifelsfall (kostspielige) Pränataluntersuchungen zu raten, die über die Routinebetreuung im Rahmen des Mutter-Kind-Passes hinausgehen: Werden Frauen dadurch zu Entscheidungen gedrängt, die sie nicht lösen können - und wollen? Oder verzichten sie von sich aus auf ihr Recht auf Nichtwissen? "Viele Eltern geben vor, dass sie gedrängt werden, aber in Wirklichkeit wollen sie die Untersuchungen selbst unbedingt”, glaubt Wolfgang Arzt, Leiter des Instituts für Pränatalmedizin an der Linzer Landesfrauenklinik. Auch die Schwangeren hätten eine "Bringschuld”, nämlich "sich mit dem Thema zu befassen und dann eine Entscheidung - möglicherweise auch gegen Pränataldiagnostik - zu treffen.” Die neue Broschüre "Pränataldiagnostik: Was? Wie? Wozu?” soll Eltern die nötigen Informationen liefern (vgl. www.pränatal-info.at).
Wie Wolfgang Arzt wünscht sich auch Ingrid Teufel eine frühzeitigere Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Pränataldiagnostik. "Das sollte am besten schon in der Schule beginnen”, fordert sie. Was die konkrete Beratung von Schwangeren betrifft, so zeigt sie sich mit den großen Kliniken und Zentren zufrieden. Im niedergelassenen Bereich brauche es jedoch mehr Ausbildung, so Teufel: "Hier gehört auch Selbstreflexion hinein: Warum geht es mir als Arzt schlecht im Umgang mit Behinderung? Was bedeutet das für mich?“
Manche Mediziner haben diese Fragen scheinbar ausgeblendet. Barbara Z. kann ein Lied davon singen. Die 35-Jährige wird in der elften Schwangerschaftswoche mit einer grenzwertigen Nackentransparenzmessung konfrontiert - und bleibt vorerst unaufgeregt. In der 14. Woche hingegen, als die Möglichkeit für die genauere Bestimmung des Down-Syndrom-Risikos endet, packt sie die Panik. Vom Büro aus bemüht sie sich um einen Termin in einem namhaften Institut. Keine Stunde später durchläuft sie dort einen Ultraschall und einen Bluttest. "Die Ärztin hat mir dann gesagt: Ihr Risiko ist sehr hoch, 1:93. Sie haben nun zwei Möglichkeiten: Entweder Sie werden Weltmeisterin in der Förderung von Down-Kindern, oder wir machen morgen eine Punktion.“
Barbara Z. ist sprachlos: Nicht nur wegen der Ausdrucksweise, sondern auch wegen dieses infamen Spiels mit Wahrscheinlichkeiten: Wie kann ein Down-Syndrom-Risiko von 1:93 "sehr hoch“ sein und als Quasi-Diagnose gelten, während man das kolportierte Fehlgeburtsrisiko von 1:100 beim Stich in die Gebärmutter herunterspielt? Eine ganze Nacht lang bespricht sie mit ihrem Partner mögliche Szenarien und eigene Ressourcen. Dann beschließen die beiden, nichts weiter zu tun. "Es hängt alles von der Kommunikation, der Zeit und der Haltung der Ärzte ab”, sagt sie heute, fünf Jahre nach der Geburt ihrer kerngesunden Tochter.
Anna Wieser vom Selbsthilfe-Dachverband Down-Syndrom Österreich kann das nur unterstreichen - und sieht die derzeit übliche Beratung nach Diagnose Trisomie 21 entsprechend kritisch: "Die existiert entweder nicht oder führt immer noch Richtung Abtreibung“,ist sie überzeugt. Wie "prenet“, ein Netzwerk für kritische Auseinandersetzung mit Pränataldiagnostik ( www.prenet.at), fordert sie vor jedem Schwangerschaftsabbruch eine verpflichtende, psychosoziale Beratung sowie eine vorgeschriebene Bedenkzeit, wie sie auch das deutsche Schwangerschaftskonfliktgesetz vorsieht.
Deutsche "Mogelpackung“
Doch auch beim Nachbarn ist nicht alles eitel Wonne. Um die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beenden, hat man die "embryopathische Indikation“, wonach Föten bei Verdacht auf Schädigungen über die zwölfte Schwangerschaftswoche hinaus abgetrieben werden können, in eine "medizinische Indikation” umgewandelt: Ein Abbruch bleibt demnach straffrei, wenn durch das behinderte Kind "Gefahr für das Leben oder den seelischen Gesundheitszustand“ der Mutter besteht.
Wie sich diese viel kritisierte "Mogelpackung“ auswirkt, hat Monika Hey erlebt. Die ehemalige Journalistin und nunmehrige Supervisorin schildert im Buch "Mein gläserner Bauch“, wie sie nach der Diagnose Down-Syndrom schließlich gegen ihren Willen ein Formular unterschrieb, wonach das Leben mit einem behinderten Kind für sie "unzumutbar sei“. "Unausgesprochen befinden sich alle Beteiligten in einer Abwehrhaltung. In einem Prozess von Verleugnung und Verdrängung, von Nichtwirklich-wissen-Wollen und dem Vorenthalten von Informationen. Einer Abwehrhaltung, um der im Grunde unmöglichen Entscheidung über Leben und Tod des ungeborenen Kindes aus dem Weg zu gehen“, schreibt Hey.
Auch die Eltern von Anna Srnec sind vor dieser "unmöglichen Entscheidung“ gestanden. "Da kommt man in eine schlimme Patt-Situation”, sagt Karl Srnec im "Dschungel deli”, während seine Tochter ihn in die Nase zwickt. "Nach rationalen Kriterien ist so ein Kind eine Belastung. Aber wenn ich mir die Anna dann anschaue, wie sie brabbelt und kuschelt und überall dabei sein will, dann ist schnell klar: Sie ist die Unsere!“
Mein gläserner Bauch
Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. Von Monika Hey. Deutsche Verlags-Anstalt 2012, 224 Seiten, geb., e 20,60