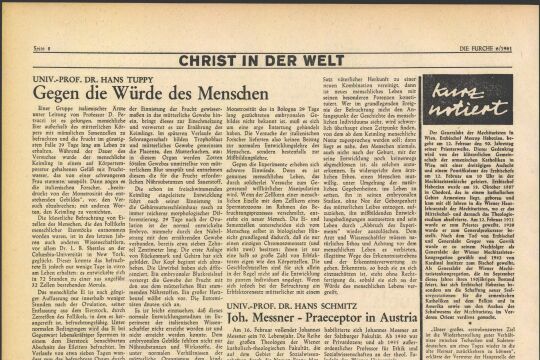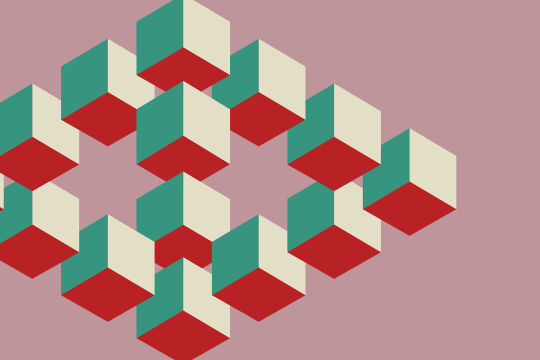Für die Erfüllung ihres Kinderwunsches nehmen betroffene Frauen und Männer immer mehr in Kauf. Zwei typische Geschichten - mit höchst unterschiedlichem Ende.
Eigentlich passt gerade alles: Der Dreijährige tollt neben ihr auf dem Boden herum, und der Zehnmonatige hockt auf ihrem Schoß und wartet auf die nächste Ladung Brei. Sie selbst, nennen wir sie Martha, hat alles im Griff: den Löffel, den Kleinen und im Augenwinkel den Großen. Längere Geschichten zu erzählen, ist für die 33-jährige Salzburgerin trotzdem nicht leicht. Und es ist eine ziemlich lange Geschichte, von der sie berichten will: jene vom unendlichen Glück und der unendlichen Mühsal, denen sie die Existenz ihrer Kinder verdankt.
Die Geschichte beginnt 2004, als Martha ihren Mann fürs Leben findet. Schon ein Jahr später sind die beiden offen für Kinder. Die Chancen stehen gut, schließlich ist die Kindergartenpädagogin damals erst 26 Jahre alt, drei Jahre jünger als die durchschnittliche Österreicherin bei ihrer ersten Geburt.
Der Natur auf die Sprünge helfen
Dennoch will es nicht klappen. Um sich abzulenken beschließt das Paar 2008 zu heiraten. 2010 entscheidet man sich schließlich, in einem öffentlichen Spital der Natur auf die Sprünge zu helfen. Schon bald ist die Ursache der Unfruchtbarkeit geklärt: Laut Spermiogramm finden sich bei Marthas Mann nur wenige, kaum bewegliche Samenzellen. "Er hat sich damals nicht gedacht: Mein Gott, ich bin kein Mann!“, erinnert sich Martha. "Er war als rationaler Denker einfach an den Auslösern interessiert.“ Lag es am kindlichen Hodenhochstand? Oder am exzessiven Radfahren? Die Antwort bleibt offen. Klar ist, dass eine In-vitro-Fertilisation kaum glücken wird. Bessere Chancen verspricht die "Intrazytoplasmatische Spermieninjektion“ (ICSI), bei der man die Samen- direkt in die Eizelle injiziert.
Zuvor muss sich Martha freilich einer Hormonstimulation unterziehen. Drei Wochen lang spritzt sie sich drei Mal täglich in den Oberschenkel - bis ihre Eierstöcke so groß sind wie Orangen. Viele Frauen empfinden das als Tortur, drei bis fünf Prozent entwickeln ein gefährliches Überstimulationssyndrom. Martha jedoch findet das - gemessen an ihrem Kinderwunsch - "nicht so schlimm“. Nur die Follikelpunktion, bei der ihr mit einer langen Nadel neun Eibläschen abgezogen werden, hat sie äußerst schmerzhaft in Erinnerung: In fünf Bläschen befinden sich tatsächlich Eier, zwei davon entwickeln sich nach der Befruchtung bis zum fünften Tag so gut, dass sie für einen Transfer in die Gebärmutter in Frage kommen. Angesichts ihrer Jugend wird Martha nur ein Embryo eingesetzt - der zweite wird eingefroren. "Andere Frauen wissen nicht, wieviele Embryonen abgehen“, erzählt sie heute. "Aber wenn du genau weißt, da liegt noch wer, das ist schon etwas gruselig.“
Vorerst überwiegt freilich das Glück allen Grusel: Bereits der erste Behandlungszyklus ist erfolgreich, auch die Schwangerschaft verläuft unkompliziert. Die Geburt selbst ist hingegen traumatisch: Nach einem Notkaiserschnitt hält Martha erst zwölf Stunden später ihr Kind in ihren Armen.
Dennoch wünscht sich das Paar schon bald ein zweites Kind. Wieder durchläuft Martha die Hormonprozedur, wieder ist sie gleich beim ersten Mal schwanger. Drei weitere Embryonen werden eingefroren. Doch diesmal steht die Schwangerschaft unter keinem guten Stern: Als sich der riesige Eierstock zurückbildet, schiebt er sich an der Gebärmutter vorbei und verursacht höllische Schmerzen. Jede Woche folgt ein Ultraschall, dazu kommt ein Gebärmutter-Hämatom und eine Streptokokken-Infektion. Als beim Organscreening kein Magen sichtbar wird, ist die Panik perfekt. Auch die Geburt wird wieder zum Desaster.
Dass sie "den Kleinen nicht loslassen kann“, führt Martha auf all diese Erfahrungen zurück. In einer Gesprächstherapie will sie sich ihren Gefühlen stellen. Dazu kommt die Frage, was mit den vier kryokonservierten Embryonen geschehen soll. Trotzdem steht sie zu ihren Entscheidungen: "Bei uns hat es geholfen, dass wir in die Natur eingegriffen haben - aber man sollte aufpassen, dass es nicht ausartet.“
Die Meinungen, wo es "auszuarten“ beginnt, sind freilich höchst unterschiedlich - und abhängig vom individuellen Leidensdruck. Viele Paare sind mittlerweile bereit, alle Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin zu nutzen, um sich ihren unerfüllten Kinderwunsch zu erfüllen. Allein in Österreich werden jährlich rund 20.000 Paare behandelt, etwa 6000 davon mittels IVF oder ICSI. Immer mehr fahren zudem ins Ausland, um die - in Österreich verbotene - Pränataldiagnostik, Eizellspende oder Fremdsamenspende bei In-vitro-Fertilisation in Anspruch zu nehmen, je nach den Ursachen ihrer Unfruchtbarkeit. Diese sind übrigens bemerkenswert "gerecht“ verteilt: Zu 30 Prozent liegen sie bei der Frau, zu 30 Prozent beim Mann und zu 30 Prozent bei beiden. Der Rest bleibt ungeklärt.
Endpunkt für das "Projekt Kind“
Mit der Krise des Nicht-schwanger-werden-könnens gehen die Paare höchst unterschiedlich um: "Manche würden nie eine IVF in Anspruch nehmen, andere durchlaufen bis zu neun Versuche“, weiß die Psychiaterin und Psychotherapeutin Astrid Lampe, die an der Innsbrucker Uniklinik für Frauenheilkunde Betroffene betreut. Viele ihrer Patientinnen fühlten sich wegen ihrer Kinderlosigkeit "als Frau beschämt und minderwertig“, nicht wenige seien nach oft mehrjährigen Behandlungen erschöpft und ausgelaugt. Auch die Beziehung wird belastet: "Es gibt Männer, die fühlen sich regelrecht ausgegrenzt und sagen, sie könnten nur zuschauen, wie ihre Frau leidet“, erzählt Lampe. Von "pathologischem Kinderwunsch“ möchte sie nicht sprechen. "Aber die Verheißung ist so groß, dass manche den Druck verspüren, immer weiter zu machen. Wir versuchen dann in der Beratung, einen Endpunkt festzulegen.“ Der Abschied vom "Projekt Kind“ sei ein schmerzhafter Trauerprozess, doch notwendig, um neue Alternativen und Perspektiven für das eigene Leben zu entdecken, so die Psychotherapeutin. "Für manche kann das ein bewusster Karriereschritt sein, ohne ständig mit einer Schwangerschaft zu kalkulieren. Für andere die Entscheidung zur Adoption.“
Wann bei ihr diese Entscheidung gefallen ist, weiß Andrea noch genau. Es war 2008, als die damals 39-jährige Wienerin gerade zum dritten Mal wegen ihrer starken Endometriose operiert worden war, einer häufigen Erkrankung, bei der sich Gebärmuttergewebe auch an anderen Stellen des Körpers findet. Fünf ICSI-Versuche und einen künstlichen Wechsel hatte sie damals bereits hinter sich - Prozeduren, die sie auf Grund ihres unbedingten Kinderwunsches gerne auf sich nahm. Fiel ein Schwangerschaftstest negativ aus, habe sie das immer "wie ein bisschen Sterben“ empfunden, erzählt Andrea: "Da denkst du dir: Milliarden von Frauen können das, nur du nicht!“
Die innerliche Neuorientierung beginnt schließlich im Donauspital, irgendwann gegen 23 Uhr: "Da ist ein Arzt ins Zimmer bekommen und hat zu mir gesagt:, Sie werden nie Kinder haben, weil Ihre Gebärmutter ein Kind gar nicht austragen kann.‘ Das war schlimm, aber erst da habe ich es begriffen.“ Gleich am nächsten Tag nehmen Andrea und ihr Mann Kontakt zum Verein "Eltern für Kinder Österreich“ auf, eineinhalb Jahre später halten sie den kleinen Luca im Arm: Weil bei ihm anfangs der Verdacht einer schweren Stoffwechselerkrankung besteht und weil Andreas Mann Diabetiker ist, werden sie spontan vorgereiht. Ein großes Glück nach all den Verletzungen.
Irgendwann will Andrea ihrem Luca diese, seine Geschichte gern erzählen. Auch die Salzburgerin Martha hat sich das bei ihren beiden Buben vorgenommen. Nur bei den vier "Geschwistern“ auf Eis ist sie sich nicht sicher. Erst dieser Tage hat sie ein Schreiben erhalten, dass künftig für die Lagerung eine jährliche Gebühr von 200 Euro fällig wird. Spätestens nach zehn Jahren müssen die Embryonen "verworfen“ werden. Doch bis dahin? Ihr Mann ist unschlüssig, sie selbst mutet sich eine dritte Schwangerschaft samt Kaiserschnitt nicht zu. Auf belastende Entscheidungen wie diese, die zu den körperlichen Strapazen dazukommen, sollten Paare vor einer künstlichen Befruchtung besser vorbereitet werden, meint die 33-Jährige. "Das soll sie nicht entmutigen. Aber sie sollten wissen, dass es sehr wahrscheinlich schwer werden wird.“