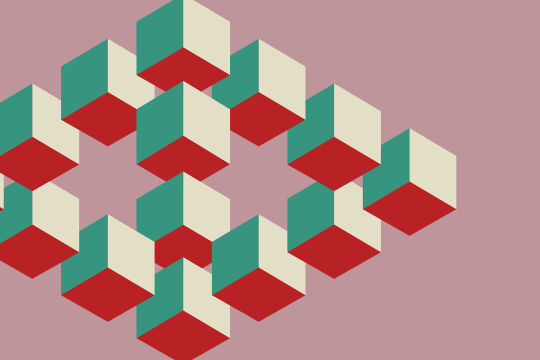Renate Mitterhuber, Lehrhebamme an der Wiener Semmelweis-Frauenklinik, über ihren herausfordernden Beruf, die zunehmende Technisierung von Schwangerschaft und Geburt - und Männer im Kreißzimmer.
Tausende Kinder haben mit ihrer Hilfe das Licht der Welt erblickt. Entsprechend groß ist der Erfahrungsschatz, den sich Renate Mitterhuber seit Beginn ihrer Hebammentätigkeit im Jahr 1978 erworben hat. Als Lehrhebamme an der Hebammenakademie der Ignaz-Semmelweis-Frauenklinik in Wien gibt die selbst kinderlose, 48-jährige Mitbegründerin des Geburtshauses Nussdorf ihr Wissen heute an den Hebammen-Nachwuchs weiter - und gönnt sich den Luxus, nicht mehr wie früher Geburten zu betreuen und deshalb "Tag und Nacht standby" zu sein. Vielmehr hat sich die ausgebildete Psychotherapeutin und Trauerbegleiterin auf die Betreuung von Frauen in Schwangerschaft und Wochenbett sowie nach Tot-und Fehlgeburten spezialisiert.
Die Furche: Frau Mitterhuber, der Hebammen-Beruf ist einer der ältesten der Welt. Würden Sie sagen, dass er auch einer der schönsten ist?
Renate Mitterhuber: Ich weiß es nicht. Aber wenn ich noch einmal auf die Welt käme, würde ich wieder Hebamme werden. Ich komme ja aus einer Hebammen-Familie: Meine Mutter hat in Oberösterreich ein Entbindungsheim geleitet und das Entbindungszimmer war unter meinem Zimmer. Mit zwölf war ich schon bei den ersten Geburten dabei. Das liegt bei mir in den Genen.
Die Furche: Sie haben tausende Geburten erlebt: Wie viel Routine - und wie viel Emotion - war von Ihrer Seite jeweils dabei?
Mitterhuber: Bei allen 4500 Kindern, die ich dabei begleitet habe, auf diese Welt zu kommen, war es nicht ein einziges Mal Routine. Jede Frau und jeder dazugehörige Partner geht mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt anders um. Wobei ich diese 4500 Geburten aber nicht in einem Spital "abgedient" habe, sondern viel in der freien Praxis, bei Hausgeburten, im Entbindungsheim und im Geburtshaus Nussdorf tätig war. Und dabei hatte ich immer die Möglichkeit, die Frauen schon in der Schwangerschaft kennen zu lernen. Dieser ganzheitliche Zugang ist ja institutionell gar nicht möglich.
Die Furche: Wenn Sie die Geburtshilfe seit 1978 überblicken: Welche Tendenzen fallen Ihnen auf?
Mitterhuber: Was mir vor allem auffällt ist, dass die Betreuung der Frauen während der Schwangerschaft sehr technisiert worden ist - und nicht zu ihrem Wohl. Man glaubt dadurch mehr Sicherheit zu haben - was verständlich ist: Jeder wünscht sich ein gesundes Kind. Aber intrauterin kann man nur ganz wenige Dinge beim Kind erkennen. Zugleich werden die Frauen enorm verunsichert: Sie hören nicht mehr auf ihren Körper, sondern schauen nur noch auf den Ultraschall und das, was ihr Arzt sagt. Ich habe noch eine Zeit erlebt, wo die Frauen sich auf die Füße gestellt haben. Das war vor 20 Jahren rund um die Gründung des Geburtshauses Nussdorf. Jetzt gibt es einen riesigen Rückschritt, der aber den Frauen nicht bewusst ist. Es wird sehr viel mit Angst gearbeitet und mit einer fragwürdigen Sicherheit.
Die Furche: Immerhin sind die Möglichkeiten, die anfangs nur in Nussdorf angeboten wurden, mittlerweile in jedem Krankenhaus Standard: von der Möglichkeit des Vaters, bei der Geburt dabei zu sein, über alternative Gebärhaltungen bis zum "Rooming in" der Neugeborenen im Zimmer der Mutter ...
Mitterhuber: Wobei laut Statistik nur ganz wenige von den Angeboten, die von den Spitälern versprochen werden, auch eingesetzt werden. Es läuft eben alles nach der Devise: Hauptsache das Kind ist gesund - was aber niemand garantieren kann. Umgekehrt haben wir so viele Schreikinder wie noch nie - trotz der "guten Geburtshilfe". Die Kinder bekommen die Ängste ihrer Mütter eben intrauterin mit. Außerdem haben wir eine sehr hohe Kreuzstich-Rate, wobei wir nicht wissen, wie es den Kindern dabei geht. Wir wissen, dass sie oft mit schlechteren Herztönen reagieren und dass dann ein Kaiserschnitt notwendig ist. Aber was es auf der psychischen Ebene mit sich bringt, wenn die Mutter bei der Geburtsarbeit nicht mehr mitgehen muss, sondern nur noch das Kind, wissen wir nicht. Ein Kreuzstich ist natürlich auch für mich als Hebamme einfacher: Dann hänge ich die Frau an den Wehenschreiber an, und wenn die Wehen weniger werden, bekommt sie eine Infusion. Wenn ich das nicht habe, muss ich die Frau motivieren, dass sie gut mit ihrem Schmerz umgeht, ich muss sie beim Atmen unterstützen, sie massieren, sie auf und ab schleppen. Das ist viel mehr Aufwand. Aber das ist Geburtshilfe. Durch all die technischen Interventionen geht das verloren.
Die Furche: Was sagen Sie zur aktuellen Kaiserschnittrate von 25 Prozent und zum Trend zur "Wunschsectio"?
Mitterhuber: Natürlich soll jede Frau so gebären, wie sie möchte. Was ich der "Wunschsectio" aber ankreide ist, dass die Frauen im Vorfeld schlecht informiert werden. Ich habe selbst einmal einen Tag in der Ambulanz des Wiener AKH mitgearbeitet. Tatsache ist, dass die Frauen gar nicht, schlecht oder einseitig über die Risiken und Folgen eines Kaiserschnitts aufgeklärt werden - und dann ist es ein Oneway-Ticket, wo die Chance einer natürlichen Geburt beim nächsten Mal reduziert ist.
Die Furche: Wie erleben Sie die Aufklärung vor Pränataldiagnostik?
Mitterhuber: Pränataldiagnostik ist ein riesiges Thema. Und die Aufklärung ist sehr schwierig, weil oft nur mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird. Meistens wissen die Frauen ja gerade erst, dass sie schwanger sind - und dann beginnt schon das volle Programm. Das halte ich für eine völlige Überforderung der Frauen.
Die Furche: Untersuchungen wie die Nackendickemessung sind nicht vorgeschrieben, sondern freiwillig. Wie viele Frauen lehnen das ab?
Mitterhuber: Vor ein paar Jahren haben noch ein paar gesagt: Nein, ich will das nicht. Mittlerweile gibt es bei uns an der Semmelweis-Klinik kaum noch Frauen, die das nicht machen. Dahin werden sie auch von der Gesellschaft gedrängt: Wenn man heute ein Kind mit Down-Syndrom bekommt, und man hat keinen Abbruch gemacht, dann muss man sich fast rechtfertigen. Es wird also konsumiert - in einem Manko an Wissen. Und wir Hebammen sind damit konfrontiert und tragen dann mit den Frauen das große Elend aus.
Die Furche: Sie tragen als Psychotherapeutin und Trauerbegleiterin mit betroffenen Frauen auch das Leid nach Spätabtreibungen, Fehl-und Totgeburten sowie bei postpartalen Depressionen aus. Wie oft kommt es zu solchen Depressionen nach der Geburt?
Mitterhuber: Weltweit liegt die Häufigkeit bei zehn bis 15 Prozent. Das entspricht der Anzahl der Frauen, die unabhängig davon Depressionen bekommen. Das Tragische an der postpartalen Depression ist aber, dass sie tabuisiert wird und es den Frauen dadurch schwer gemacht wird, rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Wenn man schwanger ist, hat man ja immer glücklich zu sein, und wenn das Baby dann geboren und gesund ist, soll man erst recht glücklich sein. Schwangerschaft und Geburt sind aber irre Life-Events. Nichts ist mehr so, wie es war: Man wird vom Paar zu Eltern, man muss sich seine Karriere überlegen, man ist stärker finanziell abhängig, und wenn man einen Freundeskreis ohne Kinder hat, ist man plötzlich isoliert. Außerdem sind viele überhaupt keine Kinder mehr gewöhnt: Man weiß nicht, dass es normal ist, dass Kinder alle zwei oder drei Stunden Hunger haben, dass sie Blähungen haben, dass sie schreien. Hier schleudert es einen sehr durch die Gegend.
Die Furche: Auch die Väter schleudert es hin und her - vor allem bei der Geburt. Wie hilfreich oder störend ist es für Sie als Hebamme, wenn die Väter im Kreißzimmer dabei sind?
Mitterhuber: Prinzipiell ist es sehr erfreulich, dass immer mehr Männer bei der Geburt dabei sind. Gleichzeitig merke ich aber, dass sie eher auf Interventionen drängen, wenn es lange dauert. Sie sind ja oft sehr unterbeschäftigt. Und vielen wird es auch zu viel: Wenn sie direkt von der Arbeit kommen und die Geburt dann noch 36 Stunden dauert, dann sind sie echt erledigt. Wirklich vorgesehen ist es von Mutter Natur also offenbar nicht, dass sie dabei sind - sonst hätten sie ein paar Hormone mehr mitbekommen. Die ideale Lösung wäre, wenn ein Vater das nicht alleine mittragen muss, sondern wenn es noch jemanden gibt. Eine Geburt ist einfach eine Grenzerfahrung - für die Frauen und für die Männer. Hier ist Geduld nötig, denn die wichtigen Dinge im Leben brauchen Zeit - und Sterben und Geborenwerden gehören dazu.
Das Gespräch führte Doris Helmberger.