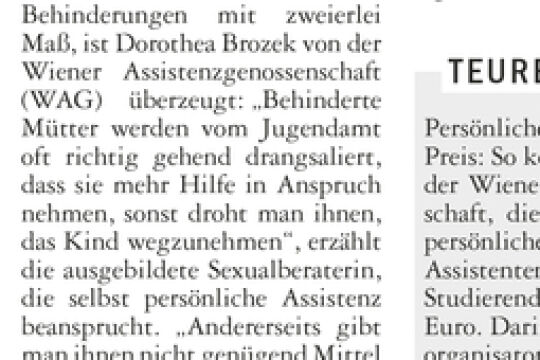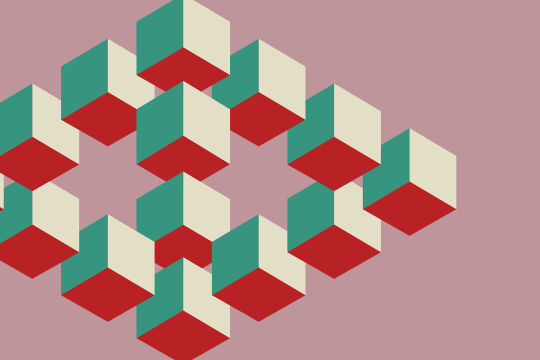Jahrelang warten sie, dass sich Nachwuchs einstellt. Schließlich entscheiden sie sich für eine Adoption - und das Warten geht weiter. Bis das Telefon klingelt ... Der lange Hürdenlauf zweier Paare zum ersehnten Kind.
Es hätte alles so gut gepasst: Die innere Reife, die äußeren Rahmenbedingungen, die harmonische Ehe. Nur noch eines fehlte zum Glück: ein Kind. "Vier, fünf Jahre haben wir es probiert", erinnert sich Magdalena R.* Vier, fünf Jahre, in denen die heute 38-jährige Wissenschafterin und ihr Mann nicht nur "probierten", ein Kind zu zeugen, sondern sich auch eingehend untersuchen ließen. Ohne Erfolg: Organische Ursachen für die ausbleibende Schwangerschaft waren nicht zu finden. Eine Ohnmachtserfahrung, die bis zu zehn Prozent aller ungewollt kinderlosen Paare teilen.
Schätzungen gehen davon aus, dass in Österreich jedes sechste Paar wider Willen ohne Kinder bleibt. Nicht wenige von ihnen nützen nach jahrelangem, erfolglosem Warten die Möglichkeiten der modernen Fortpflanzungsmedizin (siehe Kasten Seite 3). Magdalena R. hat freilich anders entschieden. Auslöser war ein Klinikaufenthalt zur Abklärung ihres Sterilitätsproblems. "In meinem Zimmer ist eine Frau gelegen, die acht erfolglose Befruchtungs-Versuche und auch Fehlgeburten hinter sich hatte", erinnert sie sich. "Als ich gesehen habe, welchen Druck das bedeutet, habe ich entschieden, dass das für mich nicht in Frage kommt."
Zehn Jahre warten
Gemeinsam mit ihrem Mann beschließt sie, lieber ein fremdes Kind zu adoptieren. Das Wiener Paar wendet sich an das Referat für Adoptiv- und Pflegekinder der Magistratsabteilung 11 - mit einem guten Gefühl im Bauch: Schließlich beträgt die Wartezeit auf ein Adoptivkind in Wien nur rund zwei Jahre - gegenüber bis zu zehn Jahren in anderen Bundesländern, was dazu führen kann, dass Adoptivmütter am Ende mit 45 Jahren zu alt sind. "In Wien ist aber die Anonymität größer. Frauen fällt es hier leichter, ihr Kind freizugeben", erklärt die Leiterin des Adoptionsreferats, Martina Reichl-Roßbacher. Auch die Einführung der "Babyklappe", in die verzweifelte Mütter ihr Neugeborenes stecken könnten, und die Möglichkeit zur "anonymen Geburt" hätten die Wartefrist verkürzt.
Bei den R.s sollte es dennoch länger dauern. Obwohl sie den vorgeschriebenen Kurs für werdende Adoptiv- und Pflegeeltern besucht und auch die nötige Pflegestellenbewilligung erhalten hatten, ließ das ersehnte Adoptivkind auf sich warten. "Wenn wir die zuständige Sozialarbeiterin gefragt haben, woran das liegt, hat es einfach geheißen: Das ist Fügung!", ärgert sich Magdalena R. noch heute. Erst nach dem Wechsel der Sozialarbeiterin besserte sich das Verhältnis zur Behörde - und die Transparenz der Vergabekriterien. Sechs Monate später (und vier Jahre nach der Anmeldung zur Adoption) war es schließlich im Frühjahr vergangenen Jahres so weit: Das Telefon klingelte und eine Stimme sagte den Satz, auf den das Paar so sehnsüchtig gewartet hatte: "Wir hätten da ein Mädchen für Sie!"
Die Kleine hieß Raina* und war von ihrer Mutter, einer Bulgarin, die in ihrer Heimat nichts als Not zu erwarten hatte, anonym im Wilhelminenspital geboren worden. "Aber Raina und wir hatten dabei Glück", erzählt Magdalena R. "Schließlich hat ihre Mutter einen Brief hinterlassen, in dem sie zwar nicht ihren Namen, aber ein paar Fotos hineingegeben und ihren Wohnort aufgeschrieben hat." Wenn Raina je nach ihrer "Bauchmama" fragen wird, hat sie also gute Chancen, sie zu finden.
Vielen der zehn Kinder, die 2005 in Wien "anonym" geboren wurden, war dieses Glück nicht beschieden. Von den zwei "Findelkindern" in der Babyklappe nicht zu reden. "Weil es hier keine Möglichkeit zur Nachforschung über die eigene Herkunft gibt, sind diese Angebote auch umstritten", erklärt Martina Reichl-Roßbacher vom Referat für Adoptiv- und Pflegekinder. Auch die leiblichen Mütter hätten keine Chance mehr, sich nach ihren Kindern zu erkundigen.
13 Monate bangen
Doch Rainas Mutter wird eines Tages diese Möglichkeit besitzen. Sie wird erfahren können, dass die neue "Mama" das Kind gleich in der Geburtenabteilung besuchte und "wie alle anderen Mütter den Baby-Blues hatte"; dass die Sozialarbeiterin ein Mal wöchentlich die Entwicklung des Kindes verfolgte; und dass die neuen Eltern nach einem halben Jahr einen Adoptionsantrag stellten und das mittlerweile 13 Monate alte Mädchen schließlich adoptieren konnten. "Ich werde ihr von Anfang an sagen, dass sie adoptiert ist", hat sich Magdalena R. vorgenommen. "Ich werde sagen: Das ist deine Bauch-Mama', die dich zur Welt gebracht hat, und ich bin die Mama, die heute für dich sorgt und dich liebt."
Dass eine "Bauch-Mama" in nächster Nähe die Situation nicht unbedingt erleichtert, muss indes Elisabeth K.* erleben. Seit Februar dieses Jahres ist die 31-jährige Intensivkrankenschwester aus Niederösterreich die Pflegemama der kleinen Thandi*. Deren leibliche Mutter, eine 18-Jährige aus zerrütteten Familienverhältnissen, wollte das Mädchen eigentlich behalten. Das zuständige Jugendamt lehnte freilich "zum Wohl des Kindes" ab und kontaktierte einen Monat vor Thandis erwarteter Geburt Elisabeth K. und ihren Mann. "Wir wollten eigentlich nie ein Pflegekind, weil einem das ja wieder weggenommen werden kann", erzählt die 31-Jährige. "Aber wir haben schon so lange auf ein Adoptivkind gewartet. Da sagt man nicht einfach so nein."
Jahrelang hatten Elisabeth K. und ihr Partner versucht, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen. Als auch zwei künstliche Befruchtungen erfolglos blieben und bekannt wurde, dass in ihrem Bezirk auf ein Adoptivkind 16 Bewerber kamen, entschloss sich das Paar für eine Auslandsadoption. Ein Kind aus Südafrika sollte es sein: Schließlich hatte Elisabeth K. dort kurze Zeit AIDS-Weisen betreut.
Mit dieser Entscheidung waren die K.s nicht allein: Nach Schätzungen des Vereins "family for you", der Menschen bei Auslandsadoptionen unterstützt, werden in Österreich jährlich 400 ausländische, aber nur rund 100 inländische Kinder adoptiert. Der schnellere Weg zum Kind hat freilich seinen Preis: Zur Pauschale von 4600 Euro kommen etwa noch Reisespesen oder Zahlungen für den Sozialbericht über die potenziellen Eltern. "Mit diesen Unterlagen wollen sich die Länder gegen Kinderhandel absichern", erzählt Helena Planicka, Geschäftsführerin des Vereins "Eltern für Kinder", der ebenfalls Adoptivwerber berät.
Spontan entscheiden
Auch die K.s mussten tief in die Tasche greifen: 8000 Euro hatten sie bereits an "Eltern für Kinder" gezahlt, 8000 Euro standen noch aus. Und dann dieser Anruf vom Jugendamt: "Nächsten Monat wird bei uns ein Langzeitpflegekind geboren. Wollen Sie es?" Die beiden wollten. "Sie haben gesagt, dass es zu 99 Prozent bei uns bleibt", erinnert sich Elisabeth K. In einer Mischung aus Freude und Schuldgefühl gegenüber der leiblichen Mutter wartete sie auf Thandis Geburt - und nahm das Baby überglücklich mit nach Hause. "Es ist ein Fehler der Behörden, Paare, die ein Adoptivkind wollen, wegen eines Pflegekindes anzurufen", meint indes Helena Planicka. "Man kann ja nicht versprechen, dass sie das Kind behalten' können." Auch wenn dies bei 80 Prozent der Pflegekinder so sei.
Neun Monate nach ihrer Geburt schläft die kleine Thandi freilich noch immer in der Wohnung der K.s. Die vorgesehenen Treffen mit der leiblichen Mutter machen den Pflegeeltern jedoch zu schaffen. "Beim ersten Kontakt nach fünf Monaten hat die Sozialarbeiterin telefoniert statt zu moderieren, und die leibliche Mutter hat ständig gesagt: Ich will mein Kind wieder zurück'", klagt Elisabeth K.
So schlimm das gewesen sei: Heute gehe es ihnen gut. Die Kleine sei quietschvergnügt und gesund. Nur die Abhängigkeit vom Jugendamt, das nach wie vor Thandis Vormundschaft innehabe, strapaziere die Nerven. "Aber insgesamt haben wir unsere Entscheidung nicht bereut", lächelt die junge Frau. "Wir möchten sogar noch ein Geschwisterchen. Auf welchem Weg, wissen wir nicht. Aber vielleicht geschieht ja ein Wunder!"
*) Name von der Redaktion geändert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!