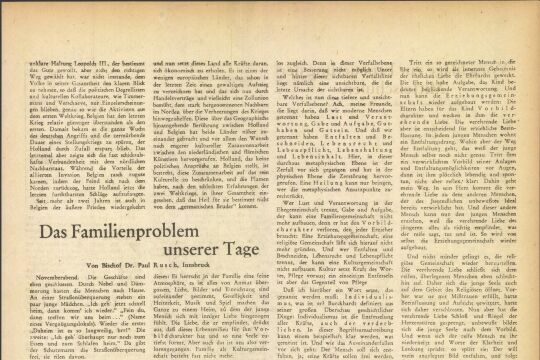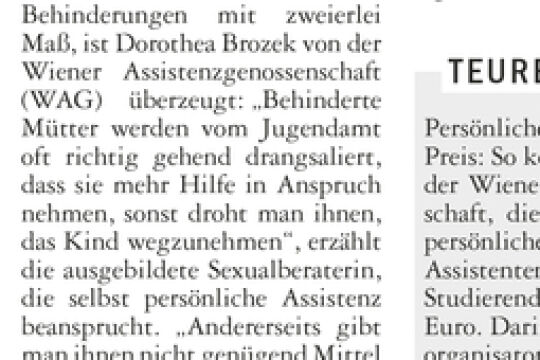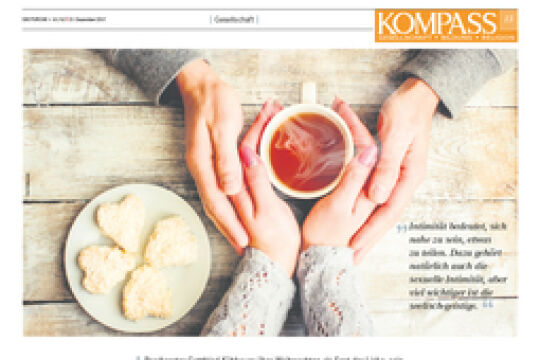GESELLSCHAFT • Lernbehinderte Menschen stoßen mit ihren emotionalen und sexuellen Bedürfnissen oft an Grenzen. Was möglich wäre, zeigt das Institut Hartheim.
Goldene Eheringe, mit der Kutsche ins Schlosscafé und Spalier-stehende Gäs-te: Reinhard und Andrea (Namen von der Redaktion geändert) haben am 7. Juli 2006 in einer Kapelle geheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Ausflug. "Ich habe sie gefragt, ob sie einen Freund haben will“, erinnert sich der 57-jährige Reinhard. "Und sie hat gesagt: Ja, eigentlich schon.“
"Ich wollte einfach einen Menschen an meiner Seite haben“, erzählt seine 55-jährige Frau Andrea. Eine Sehnsucht, deren Erfüllung für Menschen mit Lernbehinderung wie Reinhard und Andrea nicht selbstverständlich ist. Auch eine "normale“ Hochzeit nicht: Denn obwohl es sich so anhört, hat das Paar gar nicht geheiratet. Die katholische Kirche ist zurückhaltend bei der Trauung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, denn laut Kirchenrecht muss für dieses Sakrament volle Einsichtsfähigkeit vorliegen - wie bei einer staatlichen Eheschließung. Ein Priester hat das Paar aber gesegnet.
Seit einem Motorradunfall im Alter von 17 Jahren, bei dem er sich einen frontalen Schädelbruch zugezogen hat, ist Reinhard blind und kognitiv beeinträchtigt. Andrea ist von Geburt an und durch schwere Vernachlässigung in ihrer intellektuellen Entwicklung zurückgeblieben. Beide leben in einer teilbetreuten Wohnung des Instituts Hartheim im oberösterreichischen Alkoven.
Diskrete Begleitung
Hier, in der Nähe von Schloss Hartheim (siehe kleines Foto rechts), wo die Nazis einst tausende behinderte Menschen ermordet haben, ist man sensibilisiert für die Rechte der Bewohner. Seit den 1990er-Jahren setzt man sich passiv und aktiv mit Liebe und Sexualität auseinander. 2009 wurden die Grundsätze in einem sexualpädagogischen Konzept festgehalten, ausgehend von den "Sexuellen und reproduktiven Rechten“, die von der WHO 2002 für alle Menschen definiert worden sind - und die das Recht auf freie Partnerwahl sowie auf die Entscheidung für oder gegen eigene Kinder einschließen. "Was alle anderen für sich in Anspruch nehmen, darf Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung nicht vorenthalten werden“, sagt Stefan Mandlmayr, Psychologe am Institut.
Viele der rund 300 Klientinnen und Klienten leben ihre Sexualität: für sich allein oder zu zweit. Der Anteil jener, "die wirklich wissen, wie es geht“, sei jedoch klein, erklärt Mandlmayr. Und dann gebe es noch diejenigen, die gerne würden, aber nicht könnten. Jeder Klient hat einen Bezugsbetreuer, zudem erklären Sexualpädagogen, wie man angemessen Kontakt aufnimmt, geben Tipps für gutes Zusammenleben und erläutern Sexualpraktiken und Verhütungsmethoden. Auch die Dienstleistungen von Sexualbegleitung können Klienten auf Wunsch in Anspruch nehmen. In Hartheim bestehen Kontakte zu zwei Frauen, die beide die Ausbildung der "Libida-Sexualbegleitung“ in der Steiermark absolviert haben: Streicheleinheiten und Anleitungen zur Selbstbefriedigung sind in diesem Rahmen möglich, Geschlechtsverkehr und Küsse nicht. Der Zugang ist pragmatisch und diskret. "Wir hängen das nicht an die große Glocke, weil es von vielen vielleicht nicht verstanden wird“, erklärt Stefan Mandlmayr. Insgesamt habe man aber mit Sexualbegleitung gute Erfahrungen gemacht.
Es bleibt freilich ein Balanceakt: Ab wann beginnt Unzucht mit Unmündigen? Ist der Klient fähig zu sagen, was er will und was nicht? "Die Kontakte müssen dem Willen des Klienten entspringen und sind mit dem Sachwalter abgesprochen“, betont der Psychologe. Regelmäßiger Austausch im Team und Supervision sollen Missbrauch verhindern.
(Un)freiwillige Verhütung
Ein weiteres, schwieriges Thema ist der Kinderwunsch. So sehr man sich der Selbstbestimmung behinderter Menschen verpflichtet fühlt, so sei dieser Bereich doch eine Gratwanderung, erklärt Stefan Mandlmayr: Nicht nur wegen der Frage der Betreuung eines Kindes, sondern auch wegen der 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass etwa eine Frau mit Down-Syndrom ein Kind mit eben dieser Behinderung zur Welt bringt.
In Hartheim wird Verhütung deshalb empfohlen, die Entscheidung trifft jedoch der Klient. Eltern haben informell oft großen Einfluss, und der Sachwalter redet mit, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Spirale einzusetzen. Derzeit lebt keine Familie am Institut. Doch wenn Menschen mit Behinderung ein Kind wollen, steht ihnen das zu. Die Behörden müssen dann für eine geeignete Betreuung im Sinne des Kindeswohls sorgen.
Für Erika G., Mutter einer 25-jährigen Tochter mit Down-Syndrom, wäre es "unvorstellbar und belastend“, wenn ihre Tochter schwanger werden würde. "Wir lieben sie innig, und ich vergönne ihr ihre Sexualität, aber wer würde das Kind aufziehen? Sie kann es nicht, und ich mit 52 Jahren auch nicht.“ Anfangs ließ sie ihrer Tochter ein Verhütungsstäbchen einsetzen; nun nimmt die junge Frau die Pille. "Mein Anliegen wäre eine Eileiter-Unterbindung, aber ich habe kaum Chancen, das durchzusetzen“, sagt die Mutter. Einen solchen irreversiblen Eingriff würde ein Sachwalterschaftsgericht bei mangelnder Einsichtsfähigkeit der Betroffenen nicht genehmigen.
Liebe nach dem Tod der Mutter
"Eltern werden als höchste Autorität angesehen, und wenn sie gegen gelebte Sexualität ihrer Kinder sind, dann halten sich die Söhne und Töchter meist daran“, weiß Stefan Mandlmayr. Auch bei Andrea war das so: "Mama wollte nie, dass ich einen Mann bekomme“, erzählt sie. Erst nach ihrem Tod war es der Tochter möglich, eine Partnerschaft einzugehen.
Wie wichtig elterlicher Rückhalt ist, kann indes auch Hana Zanin, Leiterin des Vereins "Ich bin O.K.“, unterschreiben: "Wenn die Eltern und die Umgebung nicht dahinterstehen, gelingt vieles nicht“, weiß sie. Rund 90 junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren sind derzeit im Verein engagiert. Sich verlieben, Beziehungen knüpfen und seinen Platz in der Gesellschaft finden sind wichtige Themen - auch im Tanztheater "Ost Side Story“, das zuletzt nach der Vorlage von Shakespeares Drama "Romeo und Julia“ im Wiener Theater Akzent aufgeführt worden ist. In der Inszenierung hießen die beiden Protagonisten, deren Liebe am Hass zwischen ihren Familien zu scheitern drohte, Rosi und Milan; gespielt wurden sie von zwei Jugendlichen mit Down Syndrom (siehe Probenfoto). "Wir hoffen“, sagt Hana Zanin, "dass es uns durch dieses Stück gelungen ist, etwas mehr Akzeptanz für Menschen mit Behinderung und ihre Sehnsüchte zu erreichen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!