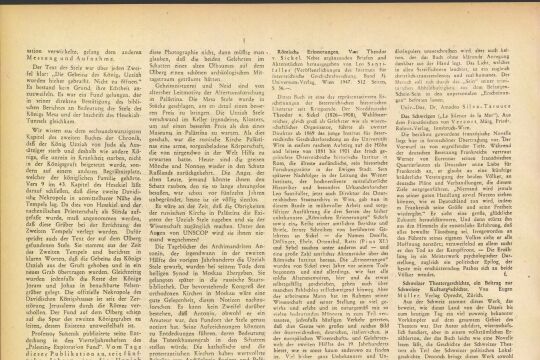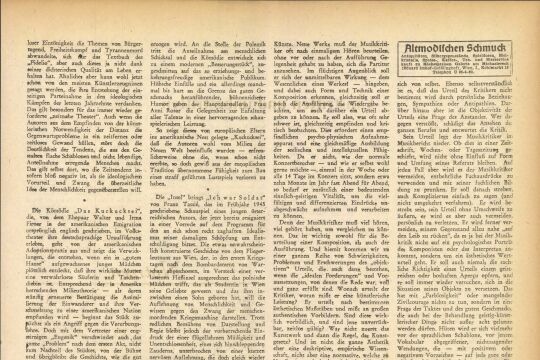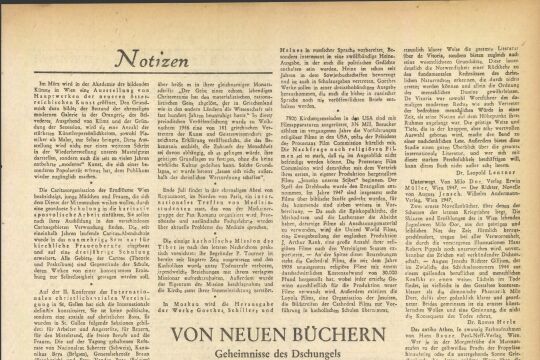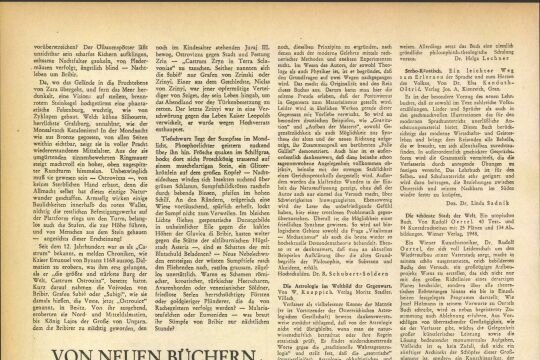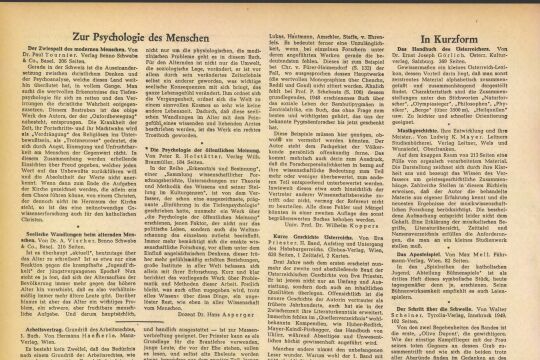Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musik und ihre Wirkungen
Zwischen der Kompositionstechnik eines Johann Sebastian Bach und der Art und Weise, wie eine Mutter zu ihrem Baby spricht, gibt es gewisse Entsprechungen. Diese Ansicht vertrat Prof. H. PapouSek vom Max-Planck- Institut in München, Abteüung für Entwicklungspsychobiologie, auf einem Symposion der Herbert-von-Ka- rajan-Stiftung in München. Bach habe ein Thema so oft wiederholt, bis sich die Erwartung darauf einstellte und dann erst etwas Neues eingeführt, auf „angenehm-aufregende Weise”. Ähnlich „komponiere” imbewußt die Mutter, wenn sie dem Säugling einfachste vorsprachliche Denkprozesse einübe. Diesen musikalischen Elementen in der mütterlichen Sprache antworte gleichsam eine musikalische Entwick-’ lung in den Lautäußerungen des Säuglings: deutlicher als in den verbalen Ausdrucksformen spiegelt sich - PapouSek zufolge - in den vorsprachlichen Äußerungen, im Reichtum der Intonation, der Melodik, der nicht-semantischen (bedeutungsfreien) Laute die ursprüngliche Einheit der kommunikativen Beziehungen wider.
Musik sei somit, zitierte PapouSek den Renaissance-Pädagogen und böhmisch-mährischen Bischof Joh. Amos Comenius, für den Menschen „die natürlichste Ausdrucksform”. Eine derart wertfreie Betrachtungsweise, deren biologische Fundierung übrigens in der Diskussion als sachlich unzutreffend heftigen Widerspruch erregte, traf sich (ungewollt) mit der für diese Salzburger Symposien offenbar vorausgesetzten Annahme: daß gesellschaftlich bedeutungsarme „Festspiele” durch die Verbindung mit „konkreter” Wissenschaft ihre Scheinhaftigkeit verlieren könnten. Von Milieuprägungen beispielsweise war bei PapouSek nicht die Rede, ebensowenig von Einsichten der Tiefenpsychologie, vom Fehlverhalten der Eltern ihren Kindern gegenüber, gerade in der frühkindlichen Phase. Zweifellos: Musik kann eine grundlegende Erfahrung sein, doch dieser Aspekt darf gewiß nicht derart verabsolutiert werden, unter Zurücksetzung aller anderen Erfahrungen. Davon abgesehen, konnte PapouSek zwar seine empirischen Beobachtungen, nicht aber seinen wissenschaftlichen Ansatz bringen.
Freilich gab es auch andere Töne auf dem Symposion. Bei Prof. Hermann Rauhe, dem Hamburger Musikwissenschaftler und Pädagogen, ging es ebenfalls um musikalische Grundmuster. Die Wirkungsfaktoren „populärer Musik” haben sich - so Rauhe - seit dem Jahre 1810 nicht verändert, und das gelte für alle Sparten. Er nannte es eine „anthropologisch-biologische Gesetzmäßigkeit – selbstverständlich auf dem Hintergrund sozio-kultureller Prägungen”. Und diese Faktoren (zwei davon: der Sextsprung und der abgebogene Leitton) wirken als Antriebsstrukturen, das heißt, sie lösen ein mimisches und gestisches Verhalten aus. Das ist das Stichwort für eine Anwendung dieser Erkenntnisse in der „Musiktherapie”; Rauhe hat sie zusammen mit einem namhaften Neurologen am Rehabilitationszentrum einer Klinik in Hamburg-Harburg praktisch ausgewertet.
Der dritte Beitrag: Prof. Jobst Fricke (Köln) führte ein von ihm entwickeltes Gerät zur klangfarbengerechten Steuerung der Dynamik vor: Jedes Instrument kann damit nachträglich aus der Klangmasse hervorgehoben, ja „veredelt” werden. Möglich sind Korrekturen einzelner Instrumente oder Instrumentgruppen, wenn die Durchsichtigkeit zu wünschen übrig läßt - ohne daß die räumliche Anordnung des Klangbildes sich ändert. Die übüche Lautstärkeregelung hingegen hebt immer den ganzen „Sound” gleichmäßig an; auch Geräte, wie sie heute schon in der Schallplattenproduktion Verwendung finden („Equilizer”), können nicht in gleicher Weise bestimmte Ausschnitte aus dem jeweiligen Klangspektrum modellieren.
Die auf gründlichen gehörpsychologischen Forschungen basierende Erfindung hat - wird sie erst industriell genutzt - eine mögliche Folge: der Solist kann künstlich noch mehr herausgestellt, als „Star” präsent gemacht werden. Fricke hat auf solche Einwände eine bedenkenswerte Antwort parat: Alles, was aus dem Lautsprecher tönt, ist bereits „künstlich”; es sei eine Illusion vieler Hörer, daß sie per Schallplatte oder Radio den „originalen” Konzerteindruck ins Haus geliefert bekämen. Dem Hörer könne mit dem neuen Gerät eine ästhetisch befriedigende Wiedergabe geboten werden, unter den Bedingungen seiner eigenen vier Wände. Mit anderen Worten: Manipuliert ist fast jeder Klang, nur eben schlechter… Es bestehe, meint Jobst Fricke, der Trend zur Perfektion, zum äußeren Klangreiz. Der Beitrag derWissenschaft ist somitnur, den Bedingungen des Hörens und Empfindens gerecht zu werden.
Tatsächlich wäre der „moralische Zeigefinger” verfehlt. Klagen über die „Technisierung des Klanges” verschleiern nur die Situation. Sie ist gekennzeichnet durch eine (überwiegend profitgesteuerte) Musikberieselung, die mehr als einmal in den letzten Jahren als „Umweltverschmutzung” gekennzeichnet wurde - so auch von Hermann Rauhe in einer (vom österreichischen Rundfunk veranstalteten) Podiumsdiksussion „Erziehung zur Musik”, die sich an das Symposion anschloß. Sie verlief so widerspruchsvoll und uneffektiv wie die meisten Gespräche dieser Art. Bedenkenswert erschien mir nur ein Beitrag von Dr. Hermann Regner, dem Leiter des Orff-Institutes der Hochschule Mozarteum: Er hat von Achtjährigen das Personal und die Kundschaft eines Warenhauses „interviewen” lassen, welche Wirkung die pausenlos ausge- strahlte Werbemusik auf den einzelnen habe - nicht um der „Ergebnisse” willen, sondern um die Kinder zu kritischem Reagieren anzuleiten. „Es reicht heutę nicht aus, Intervalle zu unterrichten - man muß die Umwelt einbeziehen.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!