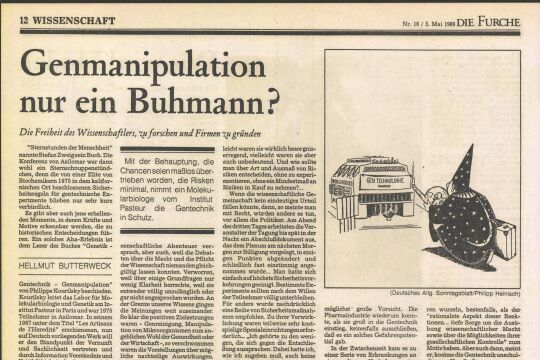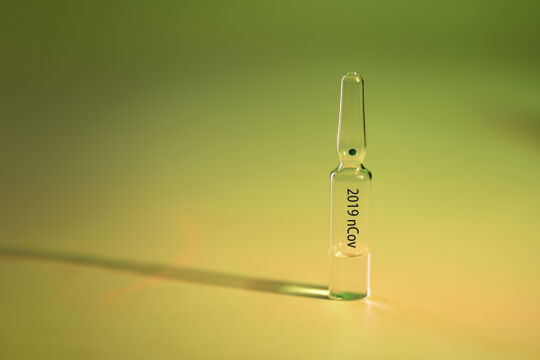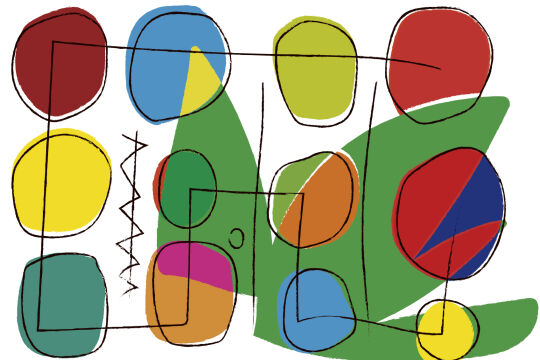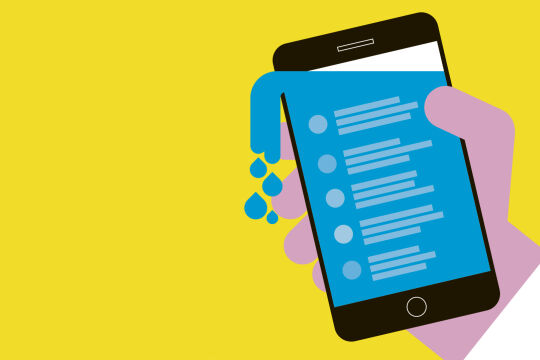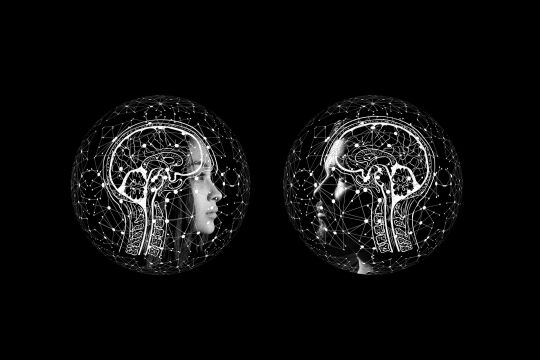Digitaler Rohstoff im Druckkochtopf
"Science 2.0" steht auf der Agenda der österreichischen Universitäten: Der Kern ist "Big Data" - als Herausforderung, Versprechen und magische Beschwörung.
"Science 2.0" steht auf der Agenda der österreichischen Universitäten: Der Kern ist "Big Data" - als Herausforderung, Versprechen und magische Beschwörung.
Das oberste Stockwerk des Raiffeisen-Hochhauses am Wiener Stadtpark gewährt einen majestätischen Ausblick. Leicht abgehoben schwebt man über dem urbanen Leben; mit der Abenddämmerung glitzern die Lichter der Stadt durch die großen Glasfronten herauf. Hier fand letzte Woche ein Workshop der Österreichischen Universitätenkonferenz statt, bei dem Weitblick geradezu angesagt war. Rektoren, Wissenschafter, Forschungsförderer sowie Vertreter des Wissenschaftsministeriums und der EU-Kommission trafen zusammen, um über eine Entwicklung zu diskutieren, die voll im Gange, aber noch schwer zu erfassen ist: Als "offene" oder "vernetzte Wissenschaft" wird sie bezeichnet; auch der Begriff "Wissenschaft 2.0" macht die Runde. Manche sprechen gar von einer Revolution, bei der kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und die daraus resultierende Verunsicherung wird in einer höchst authentischen Aussage der Wiener Veranstaltung auf den Punkt gebracht: "Wir wissen noch nicht, wo das Ganze hinführen wird."
Erforschung sozialer Netzwerke
Die Ursachen dieser Entwicklung sind jedenfalls bekannt, wie Robert-Jan Smits, EU-Generaldirektor für Forschung und Innovation, in Wien erläuterte: "Dazu zählen die verstärkte Verfügbarkeit digitaler Technologien, die zunehmende Globalisierung des Wissenschaftssystems, verbunden mit einer stark steigenden Zahl an aktiv Forschenden, sowie der Druck der Gesellschaft, rasche Lösungen auf die drängenden Probleme der Zeit zu finden." Und es ist vor allem ein Befund, der dem prognostizierten Umbruch zugrunde liegt: der digitale Wandel der Wissenskultur und das rasante Wachstum der Datenmengen - jenes Phänomen, das heute unter dem Begriff "Big Data" diskutiert wird.
Wissenschaftliche Einsichten mussten früher oft aus bescheidenen Datenbeständen abgeleitet werden. Heute stellt sich die Problemlage eher umgekehrt dar: Es sind enorme, dynamische und vielfältigste Datensammlungen zu bewältigen. Soziologen zum Beispiel finden heute in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter viel versprechendes Terrain zur Erforschung sozialer Praktiken. Allein in Facebook werden pro Tag etwa 2,5 Milliarden Einträge, 2,7 Milliarden "Likes" und 300 Millionen Fotos verarbeitet. "Big Data" ist jedenfalls Herausforderung und Versprechen zugleich: Datenverarbeitung im großen Stil soll heute dazu beitragen, aktuellen Herausforderungen effektiv zu begegnen, vom Klimawandel über die Medizin bis zur Energieversorgung. Dazu sei letztlich der offene Datenaustausch über Disziplinen, Technologien und Staaten hinweg anzustreben, wie es in der "Research Data Alliance", einer 2013 von der Europäischen Kommission mitbegründeten Initiative heißt.
"Deponien des Wissens"
Die neue Datenflut hat manche Denker des digitalen Zeitalters auch zu magisch anmutenden Visionen inspiriert. Chris Anderson, früherer Chefredakteur des Technologie-Magazins Wired, sah mit "Big Data" eine neue Ära der Wissensproduktion heraufdämmern, in der Theorien völlig überflüssig werden: Algorithmen würden nun dort Muster erkennen, wo die Wissenschaft bisher nur blinde Flecken sah. Und die Relationen und Verknüpfungen der Daten würden bereits für sich sprechen und aus sich heraus bedeutungsvolles Wissen offenbaren. Das Zauberwort "Big Data" verleitete manche Forscher zu der Vorstellung, nunmehr alles aus der Adlerperspektive wahrnehmen zu können, von der aus bislang verborgene Zusammenhänge klar zu erkennen wären. Ganz abgesehen von den sozialen Ideen und Utopien, die gerne mit "Big Data" verbunden werden, etwa die Demokratisierung des Wissens im Sinne einer schnelleren und besseren Verteilung der weltweit zugänglichen Informationen.
Diese Euphorie ist heute weitgehend verpufft. Auch bei der Wiener Veranstaltung war eine kritischdifferenzierte Sichtweise vorherrschend. "Es besteht die Gefahr, dass wir Wissensdeponien statt Wissensressourcen entwickeln", warnte etwa die Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt von der Universität Wien. Sie sieht die wachsende Datenflut als "unglaubliche Chance", aber auch als Problem, sofern die Fragen der Forschung nur noch quantifiziert beantwortet werden und eine tiefer gehende Betrachtung auf der Strecke bleibt. Zudem würden durch die Beschleunigung der Wissenschaft neue Formen der Exklusion entstehen. "Die Produktionsdichte wissenschaftlicher Artikel hat ein Ausmaß erreicht, dass man nur mehr extrem selektiv lesen kann und damit eine immer engere Auswahl, oft zugunsten der renommiertesten Zeitschriften, getroffen wird", bemerkte Felt. "Generell weisen Studien darauf hin, dass wir den neuen Medien angepasste Selektionsverfahren entwickeln. So werden meist nur die ersten Einträge in Google gelesen und damit etablieren sich neue Machtverhältnisse im Aufmerksamkeitswettbewerb."
Sorge um Datenqualität
Herausforderungen, die im Zeitalter von "Big Data" unter den Nägeln brennen, sind Datenschutz und Datenqualität. Dass es selbst in besonders heiklen Bereichen wie der klinischen Forschung nicht immer zum Besten um die Datenqualität bestellt ist, war 2013 in der britischen Wochenzeitung The Economist nachzulesen: Demnach konnten Pharmakonzerne nur einen Bruchteil ihrer Studienergebnisse reproduzieren, auch in der Krebstherapie. Hinzu kommt, dass Replikationsversuche zur Kontrolle in der biomedizinischen Forschung kaum durchgeführt werden.
Dass Daten "mit Liebe gekocht" werden sollten, hatte der amerikanische Computer-Forscher Geoffrey Bowker bereits vor zehn Jahren gefordert. Im Zeitalter der Datenflut bedarf es eines umso sorgsameren Umgangs mit dem neuen Rohstoff der "Bits &Bytes", so auch ein Fazit der Diskussion in Wien. Heinrich Schmidinger, Rektor der Universität Salzburg und Präsident der Universitätenkonferenz, verwies dabei auf den besonderen Stellenwert der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: "Bei Diskussionen zur Wertschöpfung blickt man oft nur auf die angewandte Forschung. Es gibt aber auch eine andere Art der Wertschöpfung in Form eines kritischargumentierenden Wissens, das gleichsam als Dauerauftrag an die Gesellschaft zu vermitteln ist."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!