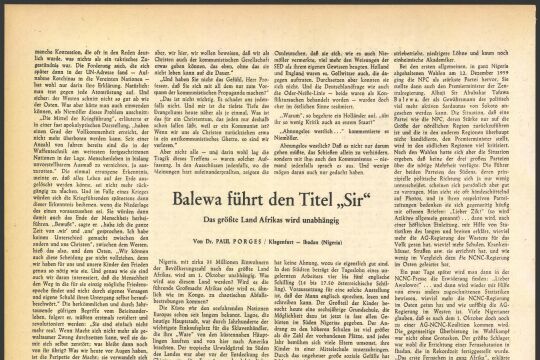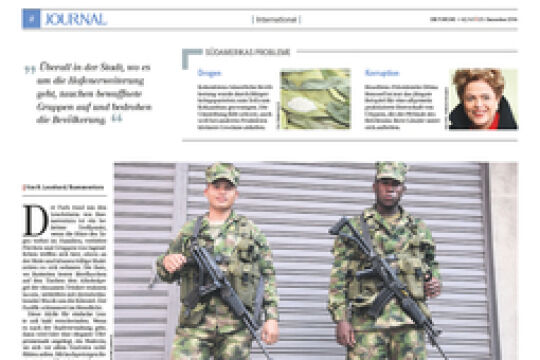Kolumbien: ein zerrissenes Land, seit 50 Jahren im Zeichen des Guerillakriegs. Jetzt gibt es Verhandlungen. Ihr Schauplatz: Die Diözese San Vicente de Caguàn, 40.000 dem Urwald abgetrotzte Quadratkilometer, derzeit entmilitarisiert. Über die Perspektiven der Annäherung ein Gespräch mit dem Diözesanbischof.
die furche: Ihre Diözese liegt mitten in der entmilitarisierten Zone. Wie kann die Kirche hier im Guerillagebiet arbeiten?
Javier Franciso M]nera: Bisher haben wir mit gegenseitigem Respekt zusammengelebt. Ich habe mich immer für den Dialog und die friedliche Konfliktlösung ausgesprochen. In gewisser Weise fällt uns auch eine Vermittlerrolle zu. Es ist nicht immer einfach. Die demokratischen Spielregeln werden nicht immer respektiert, zum Beispiel in der Rechtsprechung.
die furche: Die Guerilla forderte einmal den Abzug des Pfarrers.
M]nera: Das war am Anfang, in den ersten Monaten der entmilitarisierten Zone, gleichzeitig am Anfang meiner Tätigkeit hier als Bischof. Der Sicherheitschef der FARC forderte die Entfernung des Pfarrers, der sich gegen die entmilitarisierte Zone ausgesprochen hatte. Außerdem predigte er gegen die Praxis des Rekrutierens von Minderjährigen. Der Konflikt war letzten Endes fruchtbar. Die Kirche lehnte es ab, den Pfarrer abzuziehen, aber es gab Kontakte, die beiderseits zu größerer Gesprächsbereitschaft führten.
die furche: Das Departement Caquetá gilt als ziemlich wilde Gegend.
M]nera: Der Caquetá ist ein junges Departement, das erst in den letzten Jahrzehnten erschlossen wurde. Die meisten Einwohner sind aus anderen Landesteilen zugewandert. Dort wurden sie von der politischen Gewalt vertrieben. Seit jeher war die Region, die im Amazonasbecken liegt, Objekt aggressiver Ausbeutung: zuerst Kautschuk und Chinin, dann Edelhölzer und Felle von Raubtieren, zuletzt der massive Anbau der Coca-Pflanze. Die Menschen sind also kulturell entwurzelt und geprägt von der Kultur des Raubbaus.
die furche: Die Guerillapräsenz ist ja auch nicht wirklich neu hier.
M]nera: Vor langer Zeit schon entstand hier eine Bastion der Aufständischen. Die erste Guerilla entstand Ende der fünfziger Jahre, als die beiden großen Parteien sich nach dem Bürgerkrieg einigten und alle anderen Kräfte vom Spiel um die Macht ausschlossen. Liberale und kommunistische Selbstverteidigungsmilizen, aus denen später die FARC wurden, hatten hier eine Art befreites Gebiet. In den achtziger Jahren operierte im Caquetá die Bewegung 19. April (M-19). Und der Staat war nie wirklich präsent. Nach und nach konnten die Guerillaorganisationen das gesamte Urwaldgebiet unter ihre Kontrolle bringen.
die furche: Wie ist denn das mit den Minderjährigen in der Guerilla?
M]nera: Dieses Gebiet ist immens groß, so groß wie die Schweiz. Daher ist es schwierig, über alles im Bilde zu sein. Viele Familien sprechen auch nicht darüber. Wer kann schon sagen, ob ein Jugendlicher durch Versprechungen, unter Zwang oder freiwillig zur Guerilla geht? Mit zwölf, 13 oder 14 Jahren hat einer nicht die Reife, wirklich frei zu entscheiden. Bei den Campesinos hier ist der Übergang von der Kindheit zur Jugend sehr kurz. Die Kinder sind es gewohnt, zu arbeiten und treffen auch eigenständige Entscheidungen. Wenige machen die Schule fertig und Alternativen gibt es kaum. Dazu kommt, dass die Familienstrukturen schwach sind. Viele Kinder leben nicht bei ihren Eltern oder mit einem Elternteil und einer Stiefmutter oder einem Stiefvater. Die innerfamiliäre Gewalt ist groß. Mit 13 gehen die meisten Mädchen nicht mehr in die Schule und viele werden von Stiefvätern oder Nachbarn sexuell missbraucht. Da laufen viele weg.
die furche: Wie wirkt sich all das auf das Wirtschaftsleben aus?
M]nera: Die sogenannte informelle Wirtschaft ist angewachsen, vor allem der Handel. Früher war die Zone ganz von den großen Viehweiden geprägt. Die Rinderzüchter aus der Nachbarprovinz Huila hatten hier ihre Weiden oder ließen ihre Rinder auf den Grundstücken der lokalen Bauern weiden. Viele Leute roden noch immer, um den Urwald in Weideland zu verwandeln. Die Guerilla hat das teilweise abstellen können. Aber noch immer ist das hier eine der Regionen, die am stärksten von der Geißel der extensiven Viehwirtschaft heimgesucht wird. Die Monokulturen sind äußerst schädlich für dieses labile Ökosystem. Wer das nicht versteht, der ist zum Scheitern verurteilt. Das trifft auch auf die Politik der Regierung zu, die Coca-Felder durch legale Monokulturen ersetzen will.
die furche: Auch die Stadt ist merklich gewachsen.
M]nera: Die Gemeinde San Vicente hat viele Leute aus allen Landesteilen aufgenommen. Leute, die hier Zuflucht suchen. Letztes Jahr sind zwischen 200 und 300 Familien zugezogen. Wir sehen diese Entwicklung mit Sorge, weil sie große soziale Probleme mit sich bringt. Die Leute siedeln zum Teil in unwirtlichen Zonen, wo die Wasserversorgung schwierig und die Kanalisation unmöglich ist.
die furche: Es heißt, das seien mehrheitlich Angehörige von Guerilleros.
M]nera: Nicht unbedingt. Es wäre falsch, die Leute zu stigmatisieren. Viele kommen einfach aus Gegenden, wo die rechten Paramilitärs operieren. Wer verdächtigt wird, mit der Guerilla zu kooperieren, gilt dort als militärisches Ziel. Diese Siedlungspolitik wird sicher von den FARC gefördert.
die furche: Vor kurzem stand der Friedensprozess auf der Kippe. Es war unsicher, ob der Status der entmilitarisierten Zone verlängert würde. Was würde es denn bedeuten, wenn das passiert?
M]nera: Die Guerilla ist stärker geworden. Wenn die Armee die Stadt wieder unter ihre Kontrolle brächte - anderswo hatte sie vorher auch keine Kontrolle - dann wäre es für sie schwieriger, sie auch zu halten. Das Schlimmste wäre, wenn die Paramilitärs hier eindrängen. Sie praktizieren den schmutzigen Krieg, der darin besteht, dem Fisch das Wasser abzugraben, also die Zivilbevölkerung zu massakrieren und zu vertreiben. Das wäre schrecklich. Alle die hier leben, gelten ja automatisch als Sympathisanten oder Kollaborateure der Guerilla.
die furche: Welche Rolle spielt die Kirche heute im Friedensprozess?
M]nera: Seit letztem Jahr gibt es eine neue Situation. Bei früheren Dialogversuchen spielte die Kirche die Rolle des Mittlers. Diesmal wurde der Vorsitzende der Bischofskonferenz von Präsident Pastrana eingeladen, als Verhandler teilzunehmen. Das wurde auch vom Heiligen Stuhl gutgeheißen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat aber klargestellt, dass er nicht im Namen der Regierung verhandelt, sondern im Namen des kolumbianischen Volkes und der Kirche. Diese Position hat dem Prozess größere Glaubwürdigkeit verliehen.
die furche: Die Spaltung der kolumbianischen Kirche zwischen einem Camilo Torres, der in den Reihen der Guerilla fiel, und dem erzkonservativen Kardinal Alfonso LU]pez Trujillo ist also nicht mehr so tief?
M]nera: Was die doktrinäre Perspektive betrifft, gibt es immer noch große Differenzen. Noch immer sympathisieren manche Priester und Ordensleute mit der Guerilla. Es sind heute weniger, denn die meisten haben die perverse Logik der Gewalt erkannt. Was uns alle über die doktrinären Differenzen hinweg eint, ist die Notwendigkeit, Antworten auf die drängenden Fragen des Landes, im besonderen den Friedensprozess, zu finden. Als Kirche und als Land müssen wir die Toleranz und Bereitschaft zur Versöhnung stärken. Die Frage ist, inwieweit wir bereit sind, soziale Gerechtigkeit zu schaffen und die entsprechenden Reformen einzuleiten. Die radikalen Gruppen innerhalb der Guerilla sind da sehr unbeweglich und die wirtschaftlich Mächtigen sperren sich gegen tiefgreifende Reformen.
die furche: Es scheint, als lebten viele in einer anderen Welt.
M]nera: In Kolumbien kann es sich niemand mehr leisten, die Augen vor der Realität zu verschließen. Nur eine winzige Elite kann ihre Söhne nach Miami ausfliegen. Der Konflikt betrifft alle. Die enorme Zahl von Vertriebenen, die täglich in die marginalen Zonen der Städte strömen, sind nicht länger zu übersehen. Keiner kann sagen, er kenne den Konflikt nur aus dem Fernsehen. Alle sind betroffen: sei es durch Kidnapping und Erpressung oder durch Zwangsrekrutierung ihrer Kinder, durch Guerillakontrolle oder die blutige "Befriedung" durch die Paramilitärs. Dazu kommt noch der soziale Konflikt: die hohe Arbeitslosenquote: 21 Prozent offiziell plus 23 Prozent Unterbeschäftigung. Fast die Hälfte des menschlichen Potentials liegt hier brach. All das macht eine Verhandlungslösung unentbehrlich. Wir brauchen einen Frieden, der die wirtschaftliche Entwicklung stärkt. Wenn wir die endemische Korruption und die soziale Ungerechtigkeit als weitere Gewaltfaktoren dazuzählen, müssen wir Kolumbien als schwerkranken Patienten sehen.