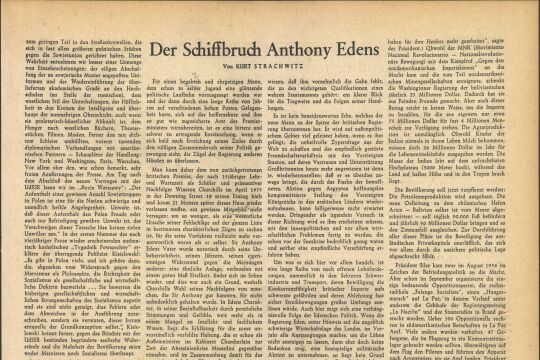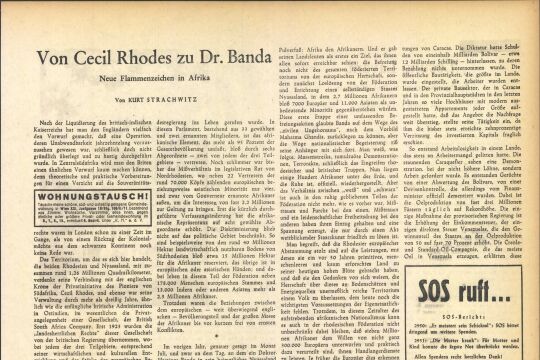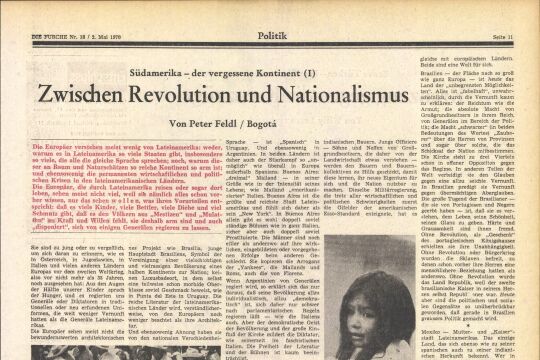Das Erbe der Conquista
Lateinamerikas demokratische Elite stammt von wenigen Familien einer Oligarchie von Eroberern ab. Sie teilen sich Reichtum und Macht seit mehr als 200 Jahren.
Lateinamerikas demokratische Elite stammt von wenigen Familien einer Oligarchie von Eroberern ab. Sie teilen sich Reichtum und Macht seit mehr als 200 Jahren.
Bei den kolumbianischen Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr traten zwei Kandidaten und eine Kandidatin an, die mehr als die gemeinsame Aspiration auf das höchste Amt gemeinsam hatten. Juan Manuel Santos, Rafael Pardo Rueda und Clara López Obregón stammen alle von den Schwestern Nicolasa und Bernardina Ibáñez ab, die vor 200 Jahren den Befreiungshelden Simón Bolívar und Francisco de Paula Santander die Köpfe verdrehten. Unter ihren Nachkommen finden sich nicht weniger als sechs Präsidenten sowie eine unübersehbare Anzahl an Abgeordneten, Ministern und Bürgermeistern. Daneben bekannte Künstler, Schriftsteller, Journalisten und selbst Guerilla-Führer.
Daniel Samper Pizano, ein prominenter Journalist, Bruder von Ex-Präsident Ernesto Samper (1994-1998) und ebenfalls Nachfahre der Ibáñez-Schwestern, hat kürzlich in einem Interview nachdenklich einbekannt, "dass wir zu einer Gruppe gehören, die fast das ganze Land lenkt". Er wird dann noch deutlicher: "Wir sind Teil einer Oligarchie, die in diesem Land befiehlt". Seit der Unabhängigkeit herrscht ein kleiner Klüngel, in dem die Macht von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. "Die Konsequenz", so folgert Samper, "ist eine Demokratie mit schweren Einschränkungen".
Kolumbien rühmt sich, das Land mit der längsten demokratischen Tradition Südamerikas zu sein. Während in den 1960er-und 1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts fast überall auf dem Subkontinent Generäle und Putschisten regierten, lösten einander in Kolumbien die gewählten Präsidenten ab. Militärisches Einschreiten im Interesse der Eliten war nicht notwendig, da die wirtschaftliche und politische Macht in den Händen einer kleinen Oligarchie konzentriert war. Als der Populist Jorge Eliécer Gaitán die Oligarchie 1948 mit seiner Präsidentschaftskandidatur herausforderte, wurde er in Bogotá auf offener Straße ermordet.
Traditionen der Brutalität
Unter Oligarchen versteht man heute vor allem skrupellose Männer osteuropäischer Transformationsstaaten, die dank Beziehungsnetzwerken und Insiderinformationen in den Wirren der politischen Umbruchsjahre schnell zu viel Geld gekommen sind. Ganz ähnlich entstanden die lateinamerikanischen Oligarchen vor 200 Jahren. Mit ehrlicher Arbeit kann man kaum große Vermögen anhäufen. Fast immer beginnt es mit Landraub. In einigen Ländern vermochten sich die Machteliten seit den Zeiten der spanischen Eroberung zu halten. In anderen entstanden sie mit der Unabhängigkeit von Spanien. Sie haben den Winden der Veränderung entweder erfolgreich getrotzt, oder sich ihnen angepasst. Das Ergebnis ist, dass die politischen Ämter in vielen Staaten immer noch von Mitgliedern derselben alten Familien besetzt werden.
Der südamerikanische Befreiungsheld Simón Bolívar, selbst Spross einer spanischen Adelsfamilie, hatte nichts weniger als eine Agrarrevolution im Sinne, als er in den Gebieten, die er den Spaniern militärisch abtrotzte, das Land konfiszierte und an seine Soldaten verteilte. Allerdings hatte er die Rechnung ohne seine Generäle gemacht, die den Soldaten statt der Landtitel nur Gutscheine in die Hand drückten. Diese kauften sie ihnen zu einem Bruchteil des Wertes ab und verkauften sie später zum Nennwert dem Staat. So entstand die venezolanische Oligarchie, die den neuen Staat als ihr Eigentum betrachtete und den "Libertador" Bolívar ins Exil schickte.
Der Reichtum der Eliten gründete auf Großgrundbesitz oder der Ausbeutung der mineralischen Rohstoffe. In beiden Fällen waren die europäischen Märkte, vor allem der britische, Ziel der Exporte von Zucker, Kaffee, Rindfleisch, Tabak, Gold, Silber, Zinn oder Kupfer. Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 brachte dieses Modell ins Wanken. Mit den USA als neuem Absatzmarkt konnten sich die Oligarchien aber bald wieder erholen. Der Zweite Weltkrieg war hilfreich.
Der US-amerikanische Soziologe Samuel Z. Stone hat vor 20 Jahren in Costa Rica, wo er lange lebte, nachgezählt und fand, dass nicht weniger als 33 der bis damals 44 Präsidenten von nur drei Erobererfamilien abstammten. Ähnliche Forschungen könnte man in anderen Republiken anstellen. Sehr kleine Cliquen lösen einander im Präsidentenpalast ab. In El Salvador pflegte man von den "14 Familien" zu sprechen, die den Reichtum und die politische Macht des Landes untereinander aufteilten.
Jede Krise wurde auf dem Rücken der indigenen Bevölkerung ausgetragen. So wälzte man den 1929 einsetzenden Preisverfall von Exportkaffee durch Lohnkürzungen auf die Landarbeiter ab. Ein darauf einsetzender Aufstand wurde im Blut von 30.000 vorwiegend indianischen Kleinbauern und Landarbeitern erstickt.
Von der Familie zum Konglomerat
Aus den 14 Familien sind inzwischen acht oligarchische Konglomerate geworden. Längst sind nicht mehr Latifundien die Grundlage ihres Reichtums, sondern die Banken. Nach zehn Jahren Bürgerkrieg und US-gesteuerter Reformpolitik, die mit Verstaatlichungen und Landreform den revolutionären Bewegungen den Wind aus den Segeln nehmen sollte, kam 1989 Alfredo Cristiani an die Macht. Er ist Spross einer Kaffeepflanzerfamilie und war lange Zeit Generalvertreter des Saatgut-und Agrochemieriesen Monsanto. Unter seiner Regierung wurden die verstaatlichten Banken zuerst auf Staatskosten saniert und dann zugunsten oligarchischer Familien privatisiert. Heute ist die Konzentration des Reichtums, die vor 40 Jahren das Entstehen linker Guerillas ausgelöst hatte, noch extremer als vor dem Bürgerkrieg.
Die aus der Guerilla hervorgegangene Partei FMLN regiert zwar, doch gegen die Wirtschaftsmacht der Oligarchie ist sie machtlos. Im benachbarten Honduras wurde vorexerziert, was passiert, wenn ein Präsident glaubt, er kann die Wirtschaftsmacht der Elite schmälern. José Manuel Zelaya, der die Privatisierungspolitik stoppen wollte, wurde vor sechs Jahren weggeputscht. Heute wirtschaftet in Honduras die Oligarchie wie eh und je. Ähnlich erging es 2012 dem reformistischen Präsidenten Fernando Lugo in Paraguay, der den oligarchischen Interessen nicht gehorchen wollte. Er musste einem institutionellen Coup weichen.
Nur die Revolutionen in Kuba und Mexiko haben die Oligarchien nachhaltig zerschlagen. In Venezuela, wo Hugo Chávez die oligarchischen Parteien in ungezählten Wahlen schlagen konnte, ist der Machtkampf noch immer nicht entschieden. In Kolumbien kämpfte die Guerilla 50 Jahre für eine sozialistische Revolution. Heute verhandelt sie mit der Machtelite über einen Frieden mit Reformprogramm. Man kann davon ausgehen, dass die Wirtschaftsinteressen der Oligarchie nicht angetastet werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!