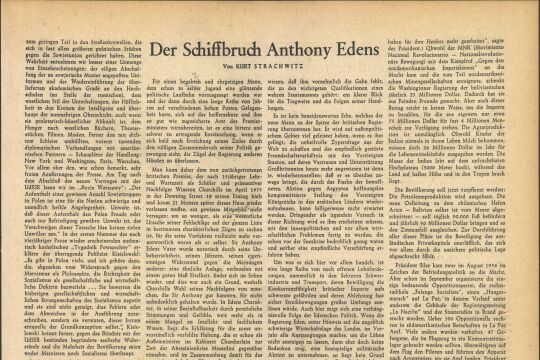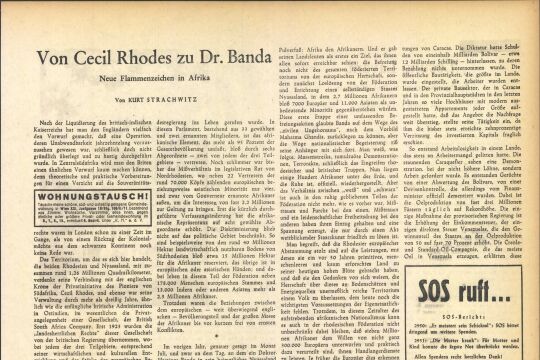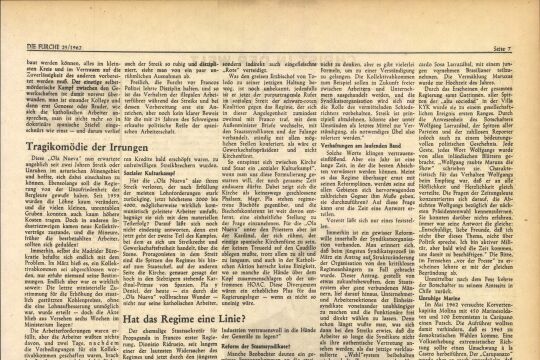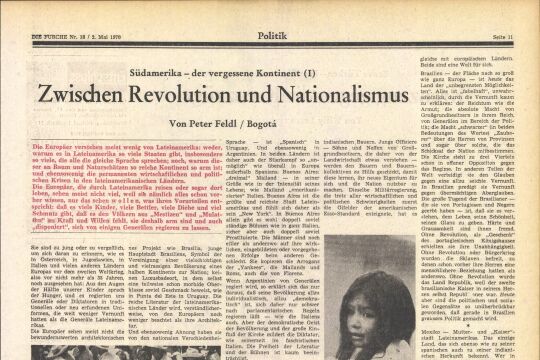Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Putsch, der nicht viel ändert
Überrascht war niemand, als am. 8. August gegen Guatemalas Präsidenten Rios Montt geputscht wurde. Sein Nachfolger General Mejia dürfte einen nicht weniger harten politischen Kurs verfolgen.
Überrascht war niemand, als am. 8. August gegen Guatemalas Präsidenten Rios Montt geputscht wurde. Sein Nachfolger General Mejia dürfte einen nicht weniger harten politischen Kurs verfolgen.
Guatemala hat eine lange Tradition einander abwechselnder Perioden selbsternannter starker Männer (meist stabil) und gewählter Präsidenten (meist chaotisch): In 94 von den 162 Jahren der Unabhängigkeit herrschten Diktatoren, wobei die vier mächtigsten alleine 86 Regierungsjahre konsumierten, während in den insgesamt 64 Jahren geübter De-
mokratie viele Präsidenten gewählt, aber die meisten abgesetzt oder umgebracht wurden.
Guatemala hat, wie die anderen mittelamerikanischen Republiken auch, ein altes soziales Problem: Noch 1950 besaßen zwei Prozent der Landbesitzer 70 Prozent des kultivierten Bodens, während sich 76 Prozent der Landbesitzer zehn Prozent des Bodens teilen mußten (die, welche besitzlos sind und in Pachtfron arbeiten, werden bei diesen Zahlen gar nicht berücksichtigt). Der Bananen-, Kaffee- und Baum- wollboom, der im 20. Jahrhundert dem armen Land Wohlstand brachte, kam nur einem kleinen
Teil der Bevölkerung zugute.
Guatemala, mit der gleichen Einwohnerzahl wie Österreich, aber um ein Viertel größer und neben fruchtbaren Hochtälern und Wald auch mit ertragreichen Küstenstreifen am Pazifik und Atlantik und mit Landreserven gesegnet, unterscheidet sich aber in einem Punkt wesentlich von seinen Nachbarrepubliken:
Nur 3 Prozent der Bevölkerung sind Weiße, eine unbedeutende Minderheit stellen Neger und Negermischlinge, an die 40 Prozent sind „Ladinos“, Mestizen, und die Mehrheit der Bevölkerung sind reine Indianer. Letztere leben in selbstversorgenden Dorfgemeinschaften, während die Ladinos in den Städten leben und mit den Weißen die staatstragenden Geschäfte betreiben.
Diese innere Zweiteilung des Landes, bei der die Mehrheit isoliert und dem modernen Staat gegenüber abstinent lebt, sich aber mit 20 verschiedenen Indianersprachen in 100 Dialekten und eigener Wirtschaftsform trotz oberflächlicher Katholisierung ihre eigenen Kulturen erhalten hat, mag eine Ursache für die blutige Geschichte des Landes sein. Eine andere Ursache ist eben die Kon zentration der Staats- und Wirtschaftsgeschäfte auf Ladinos und Weiße, welche die enge Verquik- kung zwischen Besitz, Wirtschaft und Staat erklärt.
Immer wieder waren es Versuche zur Beseitigung der krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich, die zum Sturz von Regierungen geführt haben. So begann .1944 der durch Wahl eingesetzte Präsident Juan Jose Arėvalo, ein Lehrer, mit einem radikalen Reformprogramm. Als sein, ebenfalls demokratisch an die Macht gekommener Nachfolger, Jacobo Arbenz, das Reformprogramm mit einem Landreformgesetz fortsetzen wollte, kam er in den Geruch der „roten Gesinnung“.
Mit der Unterstützung der betroffenen Großgrundbesitzer machte das Militär dem Experiment ein gewaltsames Ende. Die Geschichte ist bekannt: es ist der Juniputsch von 1954, bei dem US- Bananen- und US-Sicherheitsin- teressen wesentlich mitspielten. Dem Kolonel Castillo Armas wurde mit kräftiger Militärunterstützung unter die Arme gegriffen.
So blieb denn Stabilität das oberste Interesse auch für diese „Bananenrepublik“: Und zwar durch alle Verwicklungen hindurch: 1957 Attentat auf Armas; im selben Jahr Wahl eines Generals zum Präsidenten; 1963 wieder Armee-Eingreifen; 1966 Rückzug der Militärs in den einflußreichen Hintergrund, Wahl eines Zivilisten; 1978 zwar Wahl, aber wieder eines Generals.
Bestehen blieben bis heute auch die alten Kämpfe zwischen den Konservativen und den antiklerikalen Liberalen. Und weil die „soziale Sünde“ (wie die lateinamerikanische Bischofskonferenz die soziale Ungerechtigkeit so treffend benennt) nicht beseitigt wurde, gesellte sich zu den blutigen Parteikämpfen noch eine Guerilla. Die Unsicherheit im Lande nahm zu, am 23. März 1982 griff wiederum die Armee ein.
Diesmal waren es jüngere Offiziere, die in der politischen Mitte anzusiedeln sind. Sie versprachen soziale Reformen und erkauften sich die Zustimmung auch der rechten Generäle, indem sie General Efrain Rios Montt nominell zum Chef der Dreimannjunta machten.
General Rios machte sich alsbald zum alleinigen Chef, ließ die jungen Offiziere zwar an Reformen basteln, stoppte zwar die pa ramilitärischen Todesschwadronen, tat aber nichts gegen den Massenmord in den indianischen Dörfern, der im Namen der Subversionsbekämpfung von Soldaten begangen wurde (und wird).
Der Generalpräsident durchstand innerhalb von 16 Monaten zehn Putschversuche, geriet aber zunehmend zwischen die schwer durchschaubaren Fronten innerhalb der Armee. Der letzte mißlungene Putsch Ende Juni vervollständigt das Frontenwirrwarr: angeblich wurde er von den reformfreundlichen Jungoffizieren geplant, aber der Anlaß war ein Steuergesetz, das nur die Reichen belastet hätte; die Jungoffiziere, so verlautete, hätten zudem die Absetzung des Verteidigungsministers gefordert.
Wie immer, der Verteidigungsminister, General Oscar Mejia Victores, der von den jungen Offizieren für die Massaker unter der Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht wird, kam jeder Aktion zuvor und setzte Rios Montt am 8. August in einem fast unblutigen Handstreich ab. Sein Preis an den wachsamen Großen Bruder in Washington ist ein demokratisches Zuckerl: Er hob rasch den Ausnahmezustand auf, den Rios Montt Ende Juni verhängt hatte.
Das Weiße Haus schickte seinen Botschafter als ersten offiziellen Besuch in die Wohnung des Generals, und Präsident Reagan drückte kaum 24 Stunden nach dem Putsch dem neuen Herrscher in Guatemala-City sein Wohlwollen aus. Nicht ohne Grund: Während von Reformen in der bisher mageren Regierungsagenda Me- jias nicht die Rede ist, steht der Kampf gegen die linke Subversion an oberster Stelle. Die USA dürften Mejia dabei mit Finanz- und Militärhilfe zur Seite stehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!